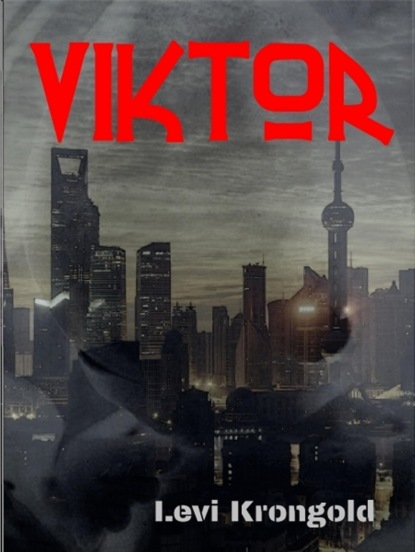- -
- 100%
- +
»Sind Sie mit irgendetwas unzufrieden, Sie wirken angespannt?«
»Oh, wirklich?«
»Ja, wir dachten, vielleicht gefällt Ihnen unsere Simulation nicht.«
»Oh, doch, doch vielen Dank, sie ist wirklich gut. Wirklich gut. Danke.«
»Wie schön, wenn wir irgendetwas tun können, um Ihren Aufenthalt hier so angenehm wie möglich zu machen, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Für nur 24 Quian können wir Ihnen zum Beispiel eine Wohlfühl-App anbieten, entstressen auf höchstem Niveau, oder eine Harmoniser-XXL-App, neuestes Update, für nur 34 Quians. Gegebenenfalls könnten sie auch eine Libidoseur-Applikation erhalten, im günstigen Jahresabonnement um zehn Prozent günstiger, die erste Rate wird erst nach einer unverbindlichen Probewoche abgebucht.«
»Oh, danke, ich weiß nicht so genau.«
Die Dame lächelte ein entzückendes Lächeln. »Na, dann melden Sie sich einfach, wenn Sie möchten. Einen weiterhin schönen Aufenthalt wünsche ich Ihnen.«
Ich ließ mich ermattet zurücksinken und blickte auf das abstrakte Bildschirmmuster, welches auf dem Screen erschienen war und sich im Rhythmus von Vivaldi. »Vier Jahreszeiten« bewegte. Seltsamerweise wurde ich etwas ruhiger. Ich blickte wie im Traum auf die bizarren Figuren, die sich bildeten und wieder vergingen. Auch wenn sie zufällig entstanden, so waren sie doch auch faszinierend. Obwohl es keine ausgeprägte geistige Tätigkeit verlangte, sie anzusehen, brachten sie doch einige Free-bits ein, die ich zu einem kleinen Prozentsatz in mein Arbeitskonto einbuchen konnte und die zum Teil auch mein Payback-Quians-Konto vermehrten. Nach einer geraumen Weile, es war inzwischen schon dunkel geworden, beschloss ich, doch in die häuslichen Gefilde zurückzukehren. Ich schüttelte ein paarmal den Kopf, um die Müdigkeit loszuwerden, rieb mir kräftig über das Gesicht und bestellte ein Abendessen im Nutri-Shop nach Hause, danach ein AuTaX zum Café. Ich blickte nochmals auf den Bildschirm, der nun zwei potentielle Gesprächspartner anzeigte. Einer Frau im Alter meiner Exfrau simste ich eine Offerte für später und checkte mich aus. 50 Quians von meinem Konto für den hiesigen Aufenthalt waren nicht wenig, aber seis drum. Das Ausgangsterminal fragte diesmal nicht nach einem Trinkgeld, der Service gehe aufs Haus. Seit das Bargeld nun endgültig abgeschafft worden war, hätte zwar nur ein Druck auf die Trinkgeldtaste genügt, andererseits wüsste ich nicht, wem ich es in einem automatisierten Café hätte zuweisen sollen. Ich war eben noch ein wenig altmodisch in dieser Beziehung.
Auf dem Rückweg flimmerten die Lichter der abendlichen Stadt an mir vorbei. Überdimensionale Leuchtreklamen lenkten die Aufmerksamkeit von den Niederungen dieser Welt in eine virtuelle bessere Welt. Die Kabine nahm einige merkwürdige Umwege, wahrscheinlich weil ihr auf der berechneten Route Hindernisse gemeldet worden waren. Tatsächlich stauten sich auf der Hauptstraße die individuell gesteuerten Autos bereits, was zu dieser Tageszeit in Richtung Zentrum normal war. Einige hatten sich sogar auf die Fahrspur der Automatischen gewagt, was üblicherweise mit empfindlichen Geldbußen oder monatelangem Führerscheinentzug geahndet wird.
Der Himmel über der Stadt, der rötlich leuchtend die von den Wolken reflektierten Lichter zurückwarf, zeigte noch einige schwache Versuche der untergegangenen Sonne, sich mit einem letzten fernen Leuchten zu verabschieden. Jetzt waren wieder mehr Menschen auf den Straßen, obwohl dies eigentlich die riskanteste Zeit ist, das Haus zu verlassen und sich in die Öffentlichkeit zu wagen. Über 80 Prozent aller Anschläge werden nach Einbruch der Dämmerung verübt! Wir passierten die gelblich blinkenden Lichter eines Polizeifahrzeuges und eines wartenden Sanitätswagens. Aber da kein olivgrünes Fahrzeug des Terrorschutzes zu sehen war, handelte es sich wohl nur um einen Unfall. Ich zählte die Anzahl der Videokameras, die auf dem Weg zu entdecken waren, in Abwandlung eines alten Kinderspieles, bei dem wir früher die Autos einer bestimmten Automarke abgezählt hatten.
Die Welt hat sich in den letzten 20 Jahren sehr verändert. Ich frage mich, ob das Leben leichter geworden ist, seit die neue Regierungsform notwendig wurde? Ich weiß es nicht. Andererseits konnte es so auch nicht weitergehen. Die diversen demokratischen Parteien und Splitterparteien hatten sich im Parlament nicht zu einer konstruktiven Lösung zusammen tun können, sondern sich nur gegenseitig blockiert. Bis auf das gemeinsame Interesse, bei jeder Kleinigkeit die Steuern oder Staatsschulden zu erhöhen, gab es keine erkennbare Gemeinsamkeit. Jeder gut gemeinte Reformansatz wurde daher im Mahlwerk der eigennützigen Interessen bis zur Unkenntlichkeit deformiert, durch eine Heerschar eifriger Juristen und Bürokraten ins glatte Gegenteil gekehrt und schließlich als neue Zumutung der Bevölkerung auferlegt. Wen wundert es, wenn die Netzmedien überwiegend von Hassbotschaften dominiert wurden? Bis zur Wahlreform, die lediglich die Möglichkeit einer einzigen Regierungspartei zuließ, versank das Land im Chaos sich gegenseitig bekämpfender Parteien, revoltierender Bürgerinitiativen, litt unter Terroranschlägen verschiedenster Gruppierungen und Wirtschaftskriminalität, so dass es ein Glück war, als ein chinesischer Konzern seine Wirtschaftsmacht ausnutzend, das Ruder herumriss und die dortigen zentralistischen Strukturen auch bei uns einführte. Nicht, dass dies auf allgemeine Zustimmung gestoßen wäre, aber unleugbar ging es seitdem auch bei uns wieder langsam bergauf.
Aber war das Leben auch leichter geworden? Es war geordneter, das wohl. Die persönlichen Probleme blieben einem allerdings treu, wie ehedem.
Mein persönliches Problem bestand aus der Ereignislosigkeit, aus der ermüdenden Routine des Alltags und der privaten Perspektivlosigkeit. Meine Familie hatte wenigstens die Illusion der Notwendigkeit eines derartigen Zustandes erzeugt, aber seit der Trennung wurde dieses Gefühl zunehmend zur Last.
Vor dem Wohnblock, in dem ich mein neues Zuhause gefunden hatte, checkte ich mich aus der Kabine aus, die sofort zum nächsten Einsatz fuhr, sog die kühle Abendluft noch einmal kräftig ein und wollte mich gerade mittels Daumenabdrucks an der Pforte identifizieren, als mein Arm-Pad sich meldete. »Bitte Rückruf, dringend. Raskovnik«.
Ich stutzte. Raskovnik rief mich privat an? Woher hatte der meine Privatnummer? Soweit ich mich erinnern konnte, hatten wir nie unsere privaten Nummern ausgetauscht.
Ich tippte die Antworttaste. Der kleine Bildschirm flammte auf. »Entschuldige, dass ich dich in deiner Freizeit störe...«
»Woher hast du meine Nummer?«
»Ist die nicht im System hinterlegt...?«, fragte er zurück.
»Nicht das ich wüsste...«, überlegte ich.
»Hör mal, es gibt eine geringe Chance. Es wäre wichtig, dass u diese Montenièr schnellstmöglich aufsuchst. Sie weiß dir einiges zu berichten, was ich dir hier nicht am Pad mitteilen kann. Es gibt eine Chance, dass du sie heute Abend in der Nähe vom ,Fleur' antriffst. Ich habe ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass sie sich dort aufhält.«
»Weshalb?«
»Kann ich dir nicht sagen, gerade. Aber du weißt schon. Es könnte wichtig sein für dich!«
Merkwürdig!
»In welchem Bezirk liegt das ‚Fleur‘?«
»Im 14.«
»Willst du mich etwa in diesen Abgrund schicken?«
»Es ist nun mal dort, tut mir leid.«
Das gefiel mir gar nicht, da ich es nicht gewohnt war, aus meinem Bezirk herauszugehen.
»Aber ich habe keinen Dienst jetzt.«
»Ich weiß, ich weiß. Nur das Problem liegt darin, dass es sonst schwer werden wird, sie überhaupt irgendwo anzutreffen.«
»Ich hab gar keine Akte dabei.«
»Levi, es geht um dich. Vertrau mir! Es ist von größter Wichtigkeit. Vielleicht ergibt sich eine Kontaktmöglichkeit. Mach dir mal ein Bild vom Zustand dieser Frau.«
»Randaliert sie?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Hör mal, das schmeckt mir überhaupt nicht. Wenn die Sicherheit ohnehin weiß, wo sie ist, warum schickt sie dann nicht einen ihrer Leute hin.«!«
Er räusperte sich. »Ist sozusagen eine private Angelegenheit... verstehst du?«
»Wieso?«
»Ich erklär es dir später. Ich schicke dir nochmals ein Bild von ihr, damit du sie erkennst. Gehst du?«
Was war nur mit Raskovnik los? Irgendwie passte die Art, wie er mir dies mitteilte, nicht zu dem Bild, das ich mir von ihm gemacht hatte. Ob er etwas wusste, was mit Eschner und dessen obskuren Rolle in dieser Sache zu tun hatte?
Offenbar konnte er nicht offen reden am Pad. Andererseits, überlegte ich, hatte ich ohnehin nichts mehr vor heute und vielleicht entwickelte sich ja daraus die Perspektive, die mir gegenwärtig so dringend fehlte.
»Okay. Aber nur kurz.«
»Gut! Das AuTaX ist informiert.«
Kurz danach öffnete sich ein Anhang, in dem das Bild der schizophrenen Klientin angezeigt wurde. Missmutig schaltete ich das Teil aus.
Was ging hier eigentlich vor und warum um alles in der Welt ließ ich mich auf diese merkwürdig. »Begutachtung« ein? Ich hatte einige Zeit im AuTaX darüber nachzugrübeln, insbesondere da dort Fahrziel und Einbuchung schon vorgenommen worden waren. Die Antwort lag wohl im Konterfei dieser Suzanne Montenièr. Sie war mir nämlich irgendwie sympathisch. Genaugenommen konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie an dieser Wahnerkrankung leiden sollte, zumindest wünschte ich es ihr nicht. Obwohl das biometrisch korrekt erstellte Foto eher wie ein Auszug aus einer Verbrecherkartei wirkte, beeindruckten mich in dem schlanken Gesicht die großen Augen und markanten Augenbrauen, die dem Gesichtsausdruck etwas Sanftes verliehen. Aber man soll sich nicht täuschen! Schizophrene sind nicht grundsätzlich dumm oder geistig minderbemittelt. Im Gegenteil. Ich habe in meiner Laufbahn als Psychiater viele äußerst intelligente, phantasievolle Patienten erlebt, die erst durch die lange Einwirkung von Medikamenten oder den chronischen Krankheitsverlauf geistig abgebaut hatten. Mit anderen Worten, ich war neugierig auf die Frau. Andererseits war die amtliche Herangehensweise an diesen Fall mehr als seltsam.
Bis zu dem Punkt, wo die Klientin vor Ort aufgesucht werden sollte, konnte ich noch routinemäßig mitgehen. Aber diese merkwürdige Annäherung, ohne dass die betreffende Person von ihrer Ausforschung erfahren sollte, schmeckte mir nicht. Ich bin zwar nicht scharf darauf, gleich mit eine. »Verpiss dich« abgefertigt zu werden, andererseits billige ich meinem Gegenüber noch so viel Menschenwürde zu, dass es wissen sollte, worum es geht.
Stellen wir uns nur einmal vor, Suzanne Montenièr könnte die Geheimleute wirklich zu einem Terroristennetzwerk führen, dann würde ich annehmen, dass die sich Tag und Nacht an ihre Fersen heften und schauen, wo sie sich aufhält. Aber statt dessen eine psychiatrische Begutachtung zu veranlassen erschien mir wenig zielführend. – Es sei denn, dass dies nur ein Vorwand für etwas anderes war – oder dass die Beobachtung durch mich genauso wirkungsvoll wäre, nur andere aus der Schusslinie brächte. An diesem Punkt begann eine gewisse Verärgerung in mir aufzukeimen. Ich beschloss, ihr, sollte ich ihr begegnen, gleich reinen Wein einzuschenken. Andererseits... Eschner eins auswischen, indem ich Schleimipunkte irgendwo ganz oben einsammelte, war auch nicht schlecht.
Der Platz vor de. »Fleur«, ein in die Jahre gekommenes kleines französisches Restaurant, war genauso runtergekommen wie alle anderen Gebäude auch. Ich befand mich im Botanikerviertel, einer Promeniermeile aus besseren Zeiten, ganz in der Nähe des Botanischen Gartens und des kleinen Kanals, der die Metropole im Norden teilt. Einige imposante restaurierte Jugendstilbrücken führen zur anderen Seite des Viertels. Dahinter liegt heute das ehemalige Studentenviertel, aufgrund der Nähe der Universität so benannt und der Tatsache, dass dort wegen der damals schon heruntergekommenen Bausubstanz billige Wohnungen zu haben waren. Inzwischen wohnten dort in enger Nachbarschaft mit imposanten Büroneubauten vor allem Sozialhilfeempfänger in städtischen Sozialwohnungen, die ihnen zugewiesen worden waren. Die ganze Gegend weist eine mindestens doppelte Dichte an Überwachungskameras aus, wie der restliche Teil der Stadt zusammengenommen. Allerdings gibt es auch hier die höchste Kriminalitätsrate der gesamten Stadt. Hier und da kreisen plötzlich Polizeidrohnen über den Plätzen, scannen alles mit Infrarotkameras, um kurz darauf blitzartig wieder zu verschwinden. Nicht gerade ein Ort, wo man gerne nachts alleine rumsteht, so wie ich jetzt. Ich hatte kaum eine Minute unschlüssig auf dem Platz gestanden, als schon eine dieser Drohnen über mir kreiste. Ich setzte mit meinem Arm-Pad meinen Code ab, worauf sie sich entfernte. Wie sollte ich Frau Montenièr hier finden? Ich schaute mich um, ob irgendwo eine ausgeflippte Person die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zog oder in einer Ecke oder am Fuß einer Brücke eine zusammengekauerte Gestalt hockte. Fehlanzeige. Zweimal verfolgte ich eine Person, die die Gesuchte hätte sein können, sich jedoch als Prostituierte herausstellte. Die hätte aber ebensowenig hier sein dürfen. Immerhin wies diese Tatsache darauf hin, dass die staatliche Überwachung der Plätze doch nicht so lückenlos sein konnte, wie allgemein angenommen. Eine Überlegung, die die ganze Angelegenheit in ein anderes Licht rückte. Vielleicht war gar nichts Geheimnisvolles am Verschwinden der Frau, sondern die Überwachung war nur einfach lückenhaft. Dieser Gedanke beruhigte mich insofern, als die Wahrscheinlichkeit, unliebsamen Kontakt mit einer Terrorgruppe zu bekommen, etwas geringer erschien. Ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt. Ich hatte die Nase voll, war frustriert und müde und hungrig, deshalb beschloss ich, in. »Fleur« zu gehen, um dort etwas zu mir zu nehmen.
Trotz des antiquierten Eindrucks, den das kleine Restaurant machte, öffnete sich die Tür erst, nachdem Chip und Iris gescannt waren. Drinnen umfing mich gedämpftes Lampenlicht, in dem einige wenige Holztische zu sehen waren, die in kleinen mit riesigen Tonvasen und künstlichen kalkweißen Mauern dekorierten Nischen untergebracht waren. Überall hingen Sträuße getrockneten Lavendels an den Wänden und von der Decke allerlei antikes landwirtschaftliches Gerät, welches zweckentfremdet dort angeschraubt war.
Es dauerte eine Weile bis ein runtergekommener Wirt mit Baskenmütze und schmierigem Hemd nach meinen Wünschen fragte.
»Was Kleines, bitte!«, forderte ich müde. Er stieß einen kurzen Lacher aus.
»Das findest du eher draußen!« Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass er die Nutten auf dem Platz meinte. Ich lächelte verlegen.
»Ich möchte speisen, was Kleines.«
»Mon dieu, Sie befinden sich in einem französischen Restaurant, da ist alles klein, wissen Sie?«
Ich lächelte zurück. »Lassen Sie mich raten, nur die Preise sind groß?«
Er lachte kurz auf, wobei sich sein fast zahnloser Mund unter einem kleinen Schnäuzer öffnete, aus dem ein so derartig pestilenzartiger Tabakgeruch entströmte, dass ich kurz den Atem anhalten musste. Dann klopfte er mir herzhaft auf die Schulter, drehte sich um, um eine Karaffe mit einer roten Flüssigkeit auf einer Anrichte hinter sich zu ergreifen und mir wortlos auf den Tisch zu stellen.
Ich schaute ihn fragend an. »Was ist das?«
»Rotwein!«, gab er wie selbstverständlich zurück, wobei sein Blick einen stillen Triumpf ausdrückte, als er meine Überraschung bemerkte. Alkoholhaltige Getränke sind seit Langem nicht mehr legal zu bekommen!
Danach reichte er mir das Pad mit der Speisekarte. »Wenn ich etwas empfehlen dürfte, das Lamm muss noch weg«, lachte er, um danach wieder mit enthusiastischem Blick beide Hände an die Lippen zu führen. »Es ist süperb. Aber diese Trottel hier können das nicht richtig schätzen, deshalb hebe ich es für Gäste wie Sie auf.«
»Richtiges Fleisch?«, fragte ich überrascht.
Er verzog beleidigt das Gesicht. »Aber natürlich, was halten Sie von mir?«
Ich war erstaunt. Richtiges Fleisch hatte ich schon lange nicht mehr gegessen.
»Sie sind nicht von hier?«, fragte er beiläufig.
»Nicht aus diesem Viertel.«
Er nickte. »Also das Lamm?«
Ich gab mich geschlagen, weil ich mich viel zu erschöpft fühlte, es noch in einem anderen Lokal zu versuchen.
Nachdem ich die Lippenstiftspuren an dem Glas auf meinem Tisch mittels einer Ecke des Tischtuches beseitigt hatte und mich bediente, stellte ich fest, dass der Wein ausgezeichnet schmeckte.
Es dauerte allerdings gut zwei komplette Baguettebrote, die der Wirt mir reichte, um mir die Wartezeit zu verkürzen und über 30 Minuten, bis er mit einer kleinen Steingutschale zurückkehrte, in der eine winzige Portion würzig duftenden Lammfleisches neben einigen winzigen Bratkartoffelwürfeln und Bohnen ‚übersichtlich‘ dekoriert war. Darüber lag ein Rosmarinzweig, dessen Ende in einer Knoblauch-Kräuter- Paste unterging.
Ich schaute ihn fassungslos an, als er diese in der Geste eines Fünfsterne-Chefkochs vor mir plazierte.
»Fehlt etwas?«, fragte er mit gespieltem Erstaunen.
Ich zögerte. »Die Lupe?«
Er brach in ein wieherndes Gelächter aus, schlug mir wiederum mehrfach auf die Schulter und entfernte sich dann kopfschüttelnd und laut lachend.
Wider Erwarten schmeckte das Lamm köstlich, ich möchte sogar sagen, es war wohl das beste, was ich jemals gegessen hatte. Dies und die Tatsache, dass der Wein ein Übriges dazugab, verbesserte meine Stimmung erheblich. Einer plötzlichen Eingebung folgend, beschloss ich, den Wirt ins Vertrauen zu ziehen und nach Frau Montenièr zu fragen. Vielleicht kannte er sie ja zufällig?
Als er mir das Terminal reichte, um abzurechnen und ich mich überschwänglich einschließlich eines reichlichen Trinkgeldes bedankte, zeigte ich ihm das Bild von Frau Montenièr.
»Kennen Sie diese Frau vielleicht? Ich sollte mich mit ihr hier treffen.«
Er stutzte einen Moment, schaute erst das Bild, dann mich an, während sich seine Miene schlagartig verdüsterte. Dann kratze er sich geräuschvoll am Hinterkopf, wobei er seine Baskenmütze bis nach vorne in die Stirn schob. »Ne, nie gesehen!«, antwortete er schroff. »Sind Sie 'nen Bulle?«
»Nein, ein Bekannter«, log ich. Er schaute mich grimmig an und schnaubte scharf durch die Nase aus. »Ein Bekannter«, echote er, dann rief er in Richtung Küche. »Claude, hilf dem Herrn doch mal in den Mantel, der Herr möchte gehen!«
Verblüfft schaute ich zur Küchentür hinüber, aus der ein Bulle von einem Koch trat. Dessen Kittel war noch schmutziger als der Fußboden, doch sein kantiges Gesicht ließ erkennen, dass er sich nicht nur als Hilfskoch betätigte, sondern mindestens eine langjährige Karriere als Boxchampion hinter sich haben musste.
Auf ein Kopfnicken in meine Richtung durch den Chef des Hauses setzte sich dieser wortlos in meine Richtung in Bewegung.
»Entschuldigen Sie, vielleicht ist das ein Missverständnis?«, versuchte ich es.
»Hau ab!«, brummte der Riese.
»Aber, ich bitte Sie...«, weiter kam ich nicht, dann gingen bei mir die Lichter aus.
Ich wachte einige Zeit später durchnässt vom Regen mit teuflisch schmerzendem Kopf auf dem Straßenpflaster einer Seitenstraße liegend auf.
Ich brauchte einige Zeit, bis ich mich erheben konnte, weil mir schwindelte und höllisch übel war.
Als ich es schließlich geschafft hatte, mich an einer Hauswand aufzurichten, musste ich mich übergeben. Benommen blieb ich stehen, mich mit dem Arm an der Wand abstützend, bis ich wieder einigermaßen klar sehen konnte. Ich muss hier weg! Wo sind diese verdammten Polizeidrohnen, wenn man sie braucht? Benommen torkelte ich einige Schritte weit. Ich musste ein AuTaX rufen! Allerdings stellte ich fest, dass mein Arm-Pad und mein Touch-Phone fehlten und auch mein Chip verschwunden war.
Wie sollte ich jetzt mit jemandem Kontakt aufnehmen? Verzweifelt hielt ich mich an einer Laterne fest, um nicht wieder umzufallen.
Verdammte Scheiße!
Was danach kam, ist nur noch bruchstückhaft in meiner Erinnerung. Irgendwann fragte ein Frauengesicht. »Was ist mit ihm?«
»Komm da weg, Suzanne, komm da weg«, hörte ich wie aus weiter Ferne eine schroffe Männerstimme befehlen. Dann vernahm ich ein Dröhnen, später meinte ich, blinkende Lichter wahrzunehmen, bis ich schließlich in einem mäßig verdunkelten Raum aufwachte.
Dieser stellte sich als Krankenzimmer in einer Überwachungseinheit heraus. Ein Infusionsschlauch schien zu meinem linken Handgelenk zu führen, ich konnte ihn allerdings nur aus einem Auge sehen, dass linke war monströs zugeschwollen. Neben meinem Bett flimmerte ein Monitor, der jedoch stumm geschaltet war und irgendeine Soap Opera im Programm hatte.
Wenig später kam eine uniformierte Frau von der Sicherheit in Begleitung eines Krankenpflegers und erkundigte sich nach meinen Identitätsausweisen und meinem Befinden, in dieser Reihenfolge. Ich stellte fest, dass mir das Sprechen schwerfiel, deswegen sagte ich nur. »Raskovnik, bitte benachrichtigen Sie Raskovnik von der Abteilung III der Personenschutzbehörde.«
Es dauerte eine geraume Weile, während der ich mich bemühte, wieder Anschluss an die Geschehnisse zu bekommen, um meine jetzige Lage richtig einzuschätzen. Das Erste, woran ich mich erinnerte, war ein zahnloser Mund, dem ekelerregender Tabakgeruch entströmte und an ein schrilles Gelächter, in das sich eine weibliche Stimme mischte, die immerz. »Was ist mit ihm?«, ausrief. Ich konnte mich nur nicht besinnen, in welchem Zusammenhang diese Erinnerungsfetzen standen. Wenig später allerdings, nachdem sich die SecurityDame in Begleitung eines Mediziners vor meinem Krankenbett einfand, wurde ich auf unangenehme Weise an die Zusammenhänge erinnert.
»Ich bin Dr. Ramso, Herr Kollege Krongold, können Sie mich verstehen?«, ließ er sich neben mir vernehmen.
»Woher kennen Sie meinen Namen?«, versuchte ich mühsam zu artikulieren. Er lachte. »Das war in der Tat etwas mühsam. Wissen Sie, dass Sie kurz davor standen, in einer Arrestzelle zu landen?«
Ich verneinte, denn mein Unterkiefergelenk schmerzte zu sehr, um es mit unnötigen Worten zu foltern.
»Erst durch den Iris- und Daumenscan konnten wir Ihre Identität ermitteln. Wo sind denn ihre Identitätsnachweise geblieben? Sind Sie ausgeraubt worden?«
»Scheint so«, flüsterte ich.
»Sie haben offenbar ganz schön was abbekommen«, fuhr er fröhlich fort. »aber keine Angst, es ist zum Glück nichts gebrochen. Wir erwarten keine bleibenden Schäden. Allerdings haben sie einige unschöne blaue Flecken im Gesicht.«
Ich betastete meinen Kopf, an dem ich nun ein dickes Mullpflaster über dem linken Auge feststellen konnte. Je mehr ich wieder zu mir kam, desto mehr schmerzende Stellen stellte ich stöhnend überall am Körper fest.
»Möchten Sie ein Schmerzmittel haben?«, fragte er nach.
Als ich nickte, ordnete er etwas dem im Hintergrund wartenden Krankenpfleger an, der sich daraufhin rasch entfernte.
»Gut, Herr Kollege, ich lasse Sie jetzt mit der netten Dame von der Sicherheit alleine, die hat noch einige Fragen an Sie, nicht wahr?«
Die Dame von der Sicherheit, eine Polizistin in Zivil, stellte sich als Frau Meyerring vor. Sie hatte einen unangenehm nach saurem Schweiß riechenden Körpergeruch, was wohl auch von ihrem erheblichen Übergewicht herrührte. Das maskenhaft geschminkte Gesicht mit den nach oben ausgezogenen tätowierten Augenbrauen und dem Permanent Make-up der Augenlider und der schmalen Lippen passten insgesamt zum negativen Eindruck, den sie auf mich machte.
»Herr, ähem, Krongold, richtig?«
Ich nickte.
»Ich muss Ihnen einige Fragen stellen.«
Diesmal verzichtete ich auf das Nicken. Sie fuhr allerdings auch bereits mit der Fragerei fort.
»Sie haben uns gebeten, einen gewissen Raskovnik in Ihrem Amt zu benachrichtigen?«
Wieder nickte ich brav.
»Nun«, hüstelte sie und sah mich streng an. »Ein solcher Herr ist dort nicht bekannt.«
Hä? Ich glaubte mich verhört zu haben.
»Tut mir leid. Er ist im Personalverzeichnis ihrer Dienststelle nicht aufgeführt.«
»Nicht meine Abteilung, Referat Gefährdung und Sicherheit«, korrigierte ich sie.
»Ja, ja, das haben wir schon verstanden, nein, auch dort ist er nicht aufgeführt.«
»Ich bitte Sie, ich treffe ihn jeden Tag in der Cafeteria!«, entgegnete ich entrüstet, was ich sofort bereute, da es in meinem Kopf unangenehm zu brummen begann.