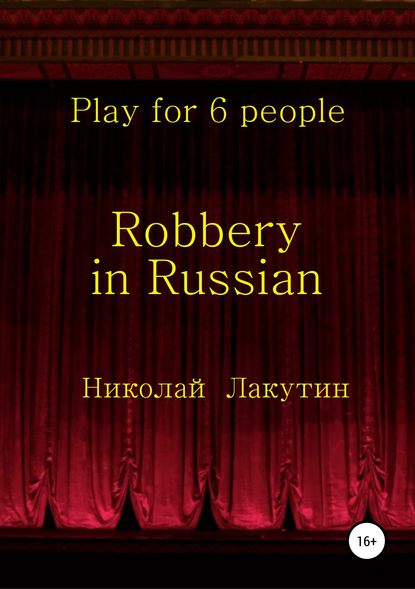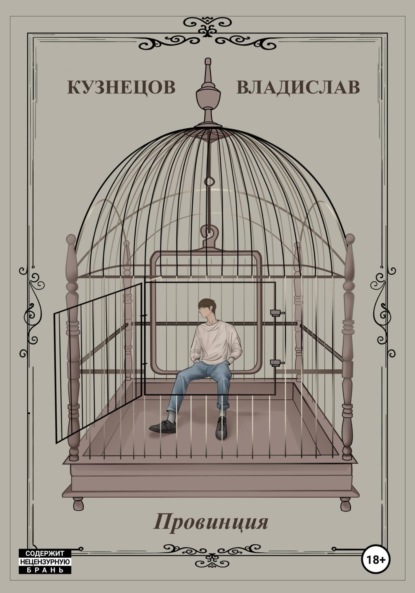- -
- 100%
- +

Schlichte und unkomplizierte, manchmal bis ins Mark ehrliche Geschichten eines sibirischen Jägers. Für den Sibirier hat die Jagd eine ganz andere Bedeutung, eine, die den Menschen von heute längst abhandengekommen ist. Diese besondere Bedeutung versucht der Autor in diesem Buch mit seinen Lesern zu teilen.
.1
Wundersame Rettung
Im mittleren Priobje, wo sich heute die Stadt befindet. Njagan – Mitte der 1960er Jahre gab es dort einen kleinen Forstbetrieb Njagan, der sich mit der Holzgewinnung beschäftigte. Im Frühling wurde dieser Wald auf dem Fluss getriftet, und in der Gegend von d. Bei Wasjas Datscha wurden die Baumstämme zu Bündeln gebunden und mit Booten auf die Ob und weiter bis nach Salechard gebracht.
Die Arbeit der Waldhüter war richtig hart, die Männer waren kaum jemals zu Hause – sie waren immer unterwegs, von früh bis spät. Die Frauen gingen arbeiten oder kümmerten sich um Kinder und Haushalt. Die Schule ging nur bis zur fünften Klasse, dann kam man ins Internat im Bezirk.
Die Kinder waren meistens komplett auf sich allein gestellt. Alle Spiele, Beschäftigungen und das Angeln konzentrierten sich am Flussufer, wo immer ein Lagerfeuer brannte, Fisch gebraten wurde, wir badeten, in den Wald zum Pilzesammeln gingen, die Älteren auf die Jüngeren aufpassten – auf alle, und Streit gab es praktisch nie. Jeder kannte jeden, und auch die Eltern und anderen Erwachsenen wurden mit Namen angesprochen und erkannt, denn die Dorfgemeinschaft war damals winzig.
Ende der sechziger Jahre ging das Gerücht um, dass zur alten Teerbrennerei – die so zwei, drei Kilometer vom Forst entfernt lag – eine Eisenbahn gelegt werden sollte. Und tatsächlich, bald darauf begann dort das große Bauen. Für uns Kinder war das einfach unglaublich: Eine Eisenbahn nur im Kino zu sehen war das eine, sie dann tatsächlich mit eigenen Augen zu erleben, etwas völlig anderes. Im ganzen Dorf wurde nur noch darüber gesprochen, wie sich das Leben ändern würde, wenn die Züge fahren. Das alles machte uns ganz kribbelig, aber so richtig glauben konnte man nicht, dass in der abgelegenen Taiga tatsächlich Züge fahren sollten – das klang viel zu unwirklich.
Es war Ende September, ich war damals in der vierten Klasse, und wir betrachteten unsere Lehrer fast wie Eltern.
Eines Tages kamen mein Freund Jura Kljapow und ich auf die Idee, zur Teerbrennerei zu laufen und uns diese Eisenbahn anzusehen. Wir beschlossen, den Ausflug mit einer Jagd zu verbinden – damals konnten wir schon ganz selbstverständlich die Flinten unserer Eltern nehmen, das war eigentlich nicht wirklich verboten. Wir sind früh aus dem Dorf los, im ersten Frost, mit dabei ein Hund von vielleicht acht Monaten und eine einläufige Flinte; so zehn Schrotpatronen hatten wir eingepackt.
Der Weg war schlecht und schmal, schlängelte sich durch den Wald und bog um die sumpfigen Stellen. Damals gab es besonders im Herbst viele Waldvögel, die jungen Schwärme waren schon flügge, und unser Hund fand fast ständig Auerhähne oder Haselhühner und bellte sie. Aber weil er noch so jung war, hockten die Vögel nicht richtig unter ihm, sondern flogen immer wieder auf – und er fand sie aufs Neue und bellte erneut. Wir rannten dem Hund hinterher, versuchten, auf Schussweite heranzukommen, und entfernten uns dabei oft ziemlich weit von der Straße. Wir trugen warme Jacken und hatten Streichhölzer, einen Patronengurt, ein Messer und Proviant dabei. Gegen Mittag kam die Herbstsonne heraus, das Wetter wurde klar, es war die Hoch-Zeit des goldenen Herbstes, und es wurde richtig warm. Nach einer kurzen Besprechung beschlossen wir, die warmen Jacken, den Rucksack und den schweren Patronengurt auszuziehen, alles an einer auffälligen Stelle am Straßenrand zu verstecken – bis zur Pechhütte war es ja nicht mehr weit, und auf dem Rückweg konnten wir alles wieder einsammeln. Noch leicht bepackt, mit der Flinte und drei Patronen, gut gelaunt und voller Elan, machten wir uns schwungvoll auf den Weg zu unserem Ziel.
Nach ein paar Schritten hörten wir wieder das Bellen des Hundes und sahen rechts, unweit der Straße, wie er einen großen Auerhahn anbellt.
Ganz aufgeregt von der Jagd, pirschten wir uns an den Vogel heran. Doch bevor wir auf Schussweite herankamen, flog der Auerhahn vom Baum auf und setzte sich ein Stück weiter auf einen anderen. Der Hund spürte ihn erneut auf und begann wieder zu bellen. Wir versuchten es noch einmal, doch wieder hatten wir kein Glück. Das Auerhuhn trieb seinen Spott mit dem Hund und mit uns: Direkt vor unseren Augen flog der Vogel von Baum zu Baum, nie weit weg, ließ uns aber auch nicht dichter heran. Im Jagdfieber drehten wir uns kreuz und quer durch den Wald – das Glück schien uns schon greifbar, immer wieder versuchten wir, näherzukommen, aber alles blieb vergeblich.
Anscheinend wurde das Auerhuhn unser irgendwann überdrüssig und flog schließlich ganz davon.
Fluchend schlugen wir, wie wir glaubten, den Weg zur Straße ein. Aber nachdem wir ein gutes Stück gegangen waren, fanden wir keinen Weg. Nach kurzer Beratung änderten wir die Richtung, beschleunigten unsere Schritte und versuchten, die Straße zu finden. So wechselten wir erfolglos die Richtung, liefen planlos durch den Wald und suchten nach dem Weg, bis es anfing zu dämmern. Der Hund bellte fast ununterbrochen den Vogel an, aber wir achteten schon gar nicht mehr darauf. Als es fast ganz dunkel war, merkten wir, dass wir uns verlaufen hatten. Aber Angst hatten wir keine – wir waren nur auf den Hund wütend und waren uns sicher, dass wir morgen die Straße finden würden. Nachdem wir wieder zu Atem gekommen und uns beruhigt hatten, stellten wir fest, dass wir praktisch nur in unseren Flanellhemden dastanden – Streichhölzer, Messer, Essen und Patronen, alles war am Wegrand versteckt. Da kamen Angst, Kränkung, Verzweiflung – wie konnten wir nur so unvernünftig sein. Ohne Streichhölzer im Wald, in der Taiga zu bleiben – das war einfach zu viel. Uns wurde schlagartig bewusst, in was für eine üble Geschichte wir da geraten waren.
Im Wald war es inzwischen dunkel und kalt geworden, wir mussten irgendwie die Nacht überstehen. Wir begannen, Tannenzweige zu brechen und uns daraus eine Schlafstatt zu basteln. Als wir uns auf die Zweige gelegt hatten, rückten wir ganz nah zusammen, warfen Zweige über uns, aber das half alles nichts – wir zitterten vor Kälte. Mit klappernden Zähnen verfluchten wir den Hund und unsere eigene Dummheit; Wenn es gar nicht mehr auszuhalten war, sprangen wir auf, liefen um unser Lager, legten uns wieder hin, und so ging es die ganze Nacht. Es kam uns vor, als wäre diese Nacht endlos und würde niemals enden. Die ganze Nacht haben wir kein Auge zugemacht und uns nur herumgequält. Übernächtigt, erschöpft und wie benommen begrüßten wir den ersten Morgen im Wald mit großer Freude und der Hoffnung auf einen guten Ausgang unseres Abenteuers. Am Morgen kam wieder Frost, doch bis zum Mittag wurde es sehr warm, und die Sonne strahlte hell.
Wir hatten uns für eine Richtung entschieden und gingen jetzt unbeirrt weiter, ohne auf das Hundebellen zu achten. Nun merkten wir schon, dass sich die Taiga, der Wald, die ganze Gegend verändert hatten. Auf unserem Weg stellten sich uns Hügel in den Weg, dazwischen lagen steile Bachläufe, und der Abstand zwischen den Hügeln war ziemlich ordentlich – etwa 1,5 bis 2 Kilometer. Uns kam es vor, als könnten wir, wenn wir in den Bachlauf hinab- und den Hügel hinaufklettern würden, vielleicht endlich die Gipfel sehen, oder die Eisenbahn, oder das Dorf, oder den Fluss Njagan. Das war unsere Hoffnung (unsere fixe Idee). Mit aller Kraft krochen wir auf den nächsten Hügel, aber da war nichts, außer wieder ein Hügel, bedeckt mit Wald, und dazwischen große Bachläufe – und das alles schien endlos zu sein. Moore sind uns keine begegnet. Der Wald war stellenweise ziemlich verwildert, besonders in den Bachläufen, aber manchmal gab es weißen Rentiermoos (Jägel), wo der Wald sauber war und das Gehen richtig leicht fiel.
So richtig Hunger hatten wir nur am ersten Tag, den stillten wir mit Beeren, die es im Überfluss gab. Die Preiselbeeren waren groß, kirschrot, von einem einzigen Busch hatte man gleich eine ganze Handvoll, aber irgendwann bekamen wir davon so einen widerlichen Nachgeschmack, dass es schwerfiel, sie noch zu essen. Dann sind wir auf Hagebutten umgestiegen, fanden Zedernzapfen, und ein paar Mal entdeckten wir die Vorratslager der Streifenhörnchen – da gab es richtig feine Nüsse. Wir haben versucht, die Wurzeln der Gräser zu essen, die wir kannten (Binsengewächse und so weiter). Hin und wieder fanden wir noch nicht abgefallene Heidelbeerbüsche, aber Preiselbeeren haben wir nie gefunden. So wurde der Hunger irgendwie gestillt, und an richtiges Essen dachten wir kaum noch.
Die Patronen wollten wir lieber nicht vergeuden, weil wir Angst vor Bären hatten und sie für den Notfall aufbewahrten. Es gab den Vorschlag, mit dem Auslöser unseres Unglücks – dem Hund – abzurechnen, ihn zu erschießen. Aber es gab keine Streichhölzer, um das Fleisch zu nutzen, kein Messer, um das Fell abzuziehen. Wir begriffen immer mehr, wie groß unsere Not war.
Mit Entsetzen gingen wir jeder neuen Nacht entgegen – das war unsere härteste Prüfung, ein wahrer Albtraum, schlichtweg unerträglich. Die Kälte ließ uns nicht schlafen, die Nacht zog sich endlos, und manchmal fielen wir in einen Halbschlaf, doch der Frost riss uns immer wieder heraus. Wir zitterten wie im Fieber, alles daran war einfach furchtbar.
Nach einer zweiten gequälten Nacht im Wald sanken wir gegen Morgen, von der Schlaflosigkeit übermannt, in einen tiefen Dämmerzustand. Als wir wieder vom Frösteln und Zittern erwachten, stellten wir fest, dass wir vom Schnee bedeckt waren – in der Nacht hatte es geschneit. Auch tagsüber war es trüb und kalt, von der Sonne keine Spur, und wir mussten uns bloß durchs Gehen warmhalten.
Vor lauter Schlaflosigkeit und Hunger fehlte uns jede Kraft fürs schnelle Gehen, wir krochen wie Kakerlaken durch den Wald, wichen den Sturmschäden schon nur noch aus, die Apathie kam, das Gleichgültige – wir gingen nur weiter, weil wir uns irgendwie warmhalten mussten.
Uns packte wieder diese fixe Idee: Einen beliebigen Bach finden, an ihm runter bis zu irgendeinem Waldbächlein, und das bringt uns dann schon zu einem richtigen Fluss, vielleicht sogar zum r. Njagan, und wenn wir ein Floß bauen, lassen wir uns einfach irgendwohin treiben. Heute, wenn ich auf die Karte schaue und den Bezirk kenne, in dem wir uns damals verirrt hatten, wird mir klar: Es wäre für uns unmöglich gewesen, auch nur zehn oder hundert Kilometer weit zu kommen. Es war eine dichte, wilde Taiga, und weit und breit gab es kein einziges Haus. Das wäre der sichere Tod gewesen, selbst für Erwachsene. Die Lage war katastrophal, aber wir ahnten nichts davon. Und so irrten wir weiter durch den Wald, voller Hoffnung, dass wir jeden Moment hinausfinden würden.
Erschreckt haben uns sowohl die Spuren der Bären, denen wir begegneten, als auch der Gedanke, dass inzwischen alle Männer vom Forst ihre Arbeit niedergelegt hatten, um uns zu suchen – und dass wir dafür noch ordentlich Ärger bekommen würden.
So etwas war schon einmal passiert: Damals suchte das ganze Dorf tagelang nach einem jungen Pilzsammler, niemand ging arbeiten, und als sie ihn dann fanden, rannte er vor den Leuten weg. Die Mücken hatten ihn völlig zerstochen, er war ganz angeschwollen, und mit seinem Kopf stimmte auch nicht mehr alles.
Kurzum, wir haben uns ausgemalt: Selbst wenn wir rauskommen und gerettet werden, wenn sie uns finden, erwarten uns riesige Schwierigkeiten. In einer weiteren dunklen Nacht fingen wir einen Hund und legten ihn, während wir seine Pfoten hielten, auf uns: Jurka hielt die Hinterläufe, ich die Vorderläufe, und wir kuschelten uns an ihn und schliefen ein wenig ein. Anfangs wehrte er sich, biss und zappelte, doch nachdem er ein paar Hiebe bekommen und die Wärme unserer Körper gespürt hatte, hörte er auf, sich zu sträuben. Das war eine Erleichterung für uns.
Stur stapften wir durch den Wald, bis wir am Abend unser Nachtlager erreichten – und waren wie vor den Kopf gestoßen: Nach all den Mühen und der vergeudeten Kraft standen wir wieder an genau unserem alten Rastplatz. Unsere Kräfte waren dahin, wir fielen zu Boden, und ich spürte plötzlich, dass ich dem Schicksal nicht mehr widerstehen, nicht mehr umherirren und nicht weiter durch die Taiga wandern konnte – und offen gesagt, wollte ich das auch nicht mehr. Gleichgültigkeit und Apathie hatten sich breitgemacht. Nachts war es nicht mehr so kalt, auch die Angst war weg, selbst die Tiere erschreckten uns nicht mehr. Wir unterhielten uns nicht mehr, schmiedeten keine Pläne – es war wie eine echte Krise.
Am Morgen beschlossen wir, die Patronen nicht zu sparen, sondern stattdessen zu versuchen, ein Feuer zu machen und den Hund zu braten.
Wir holten das Schrot aus der Hülse, sammelten trockene Zweige, mischten sie mit morschem Holz, Birkenrinde und trockenem Gras, legten alles unter einen trockenen Baumstumpf, drückten den Lauf der Flinte dagegen und gaben einen Schuss ab. Vom Schuss mit bloßem Pulver flog unser ganzer Haufen davon, aber nicht einmal einen Funken oder Rauch konnten wir entdecken. Es war klar – so würden wir kein Feuer anzünden. Wir stritten nicht, weinten nicht, hatten das Gefühl für Gefahr verloren, den Glauben an ein gutes Ende aufgegeben und wollten uns dem traurigen Schicksal einfach nicht mehr widersetzen.
Jurka war ein rothaariger, hagerer Junge – richtig dürr, aber am Ende war er kräftiger als ich, nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Er bestand darauf, dass wir einfach weitergehen und uns zur Orientierung immer an der Sonne halten, damit wir bloß keine Kreise drehen.
Bis heute wundert es mich, warum man uns in der Schule, obwohl alle wussten, dass wir im Wald leben, nie wenigstens die Grundlagen der Orientierung oder vom Überleben beigebracht hat. Solche Situationen kamen ja immer wieder vor, selbst in unserem Forstabschnitt – und dabei sind schon erwachsene Leute ums Leben gekommen. Wir sind damals durch den Wald gelaufen wie blinde Kätzchen, ohne das geringste Wissen, wie man sich in so einer Situation zurechtfindet.
Vier Tage lang sind wir wie im Trance durch die Taiga gestolpert, schon längst ohne jede Hoffnung auf ein gutes Ende, und haben immer wieder gerufen: „Auu! Auu!“
Am Ende des fünften Tages veränderte sich die Landschaft, die Berge und Hügel waren verschwunden, wir stapften über ebenes Land, der Wald war lichter geworden und man konnte weit nach vorne sehen.
Ich kletterte auf einen umgestürzten Baum und rief wieder mal – ohne Erwartung, ohne Hoffnung – einfach so: „Auu-au“. Aber was war das – nach einiger Zeit klang von weit her eine Antwort herüber. Es war, als hätte uns der Blitz getroffen, wir starrten uns an, ob wir uns verhört hatten oder verrückt wurden, ganz still und regungslos schwiegen wir, doch plötzlich sahen wir, dass der Hund nicht mehr herumrannte, sondern in genau diese Richtung starrte. Nach einer Weile hörten wir deutlicher ein „A-u, a-u“.
Da hob es uns fast vom Boden, wir brüllten beide wild durcheinander „A-u-a-u-a-u“ und rannten los, zwei verrückte Jungs und der Hund. Während wir rannten, hörten wir ganz deutlich die Stimme, die uns leitete. „Au-au!“ Im Vorbeilaufen, ganz benommen, platzten wir direkt auf einen Menschen. Es war ein Mann mit einer doppelläufigen Flinte, ohne Hund, Rucksack auf dem Rücken, aber dennoch hatte er nichts Jägerisches an sich. Er war nicht wie wir angezogen, überhaupt nicht wie ein Jäger – und er war uns vollkommen fremd. Dabei gab es weit und breit, dutzende Kilometer ringsum, kein einziges bewohntes Haus. Wir stürzten uns ihm an die Brust und fingen an zu weinen, redeten völlig durcheinander – und zwischen den Tränen versuchten wir ihm klarzumachen, dass wir schon den fünften Tag umherirrten. Doch das Gesicht des Fremden zeigte keine Regung – es war kein richtiges Gesicht, sondern eine Maske der Gleichgültigkeit. Er nahm den Rucksack ab, holte nur das Brot raus, gab jedem von uns ein kleines Stück; wir verschlangen es sofort und schauten ihn schweigend an, baten still um mehr. Der Mann ohne Regung erklärte, dass man nicht viel bekommen dürfe. Dann ging er los, ohne ein Wort zu verlieren, und wir trotteten ihm hinterher. Nach einer Weile kamen wir auf eine gerodete Fläche – hier war wohl einmal Holz geschlagen worden –, und dann auf eine alte Straße, auf der schon lange niemand mehr gefahren war.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
https://pixabay.com/illustrations/winter-snow-nature-landscape-moon-9929460/