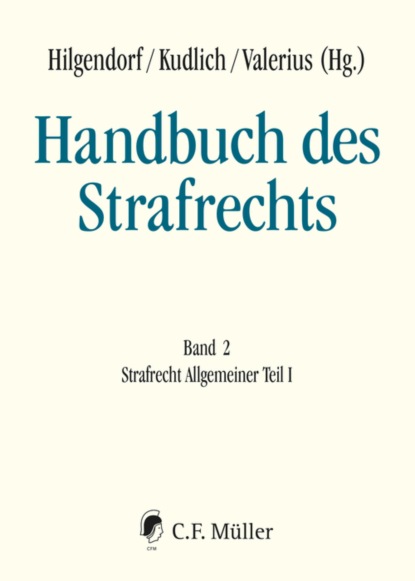- -
- 100%
- +
II. Unrechtskompensierende Elemente
17
Dem Erfolgs- und Handlungsunrecht wird ebenso schematisch das aus Erlaubnissätzen ableitbare „Erfolgs-Recht“ bzw. „Handlungs-Recht“ gegenübergestellt.[64] Seien sowohl die objektiven wie auch die subjektiven Voraussetzungen eines Erlaubnissatzes erfüllt, führe dies zu einer Kompensation der Unrechtselemente, mithin zu einem Ausschluss des Unrechts, während das Fehlen einzelner Komponenten – je nachdem – zu einer Versuchs- oder Fahrlässigkeitsstrafbarkeit führe. Ein solches Vorgehen liegt nahe und führt auch zu vermittelbaren Ergebnissen, wenn etwa behauptet wird, dass dort, wo subjektiv „nichts Schlimmes intendiert“ sei, aber objektiv „Schlimmes“ passiere (so etwa bei der Putativnotwehr, vgl. sogleich 1.), allenfalls eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit in Betracht zu ziehen sei, während ein Täter, der „etwas Böses wolle, aber objektiv im Recht handele“ (so im umgekehrten Fall des Fehlens eines Notwehr- oder Nothilfewillens, vgl. im Anschluss 2.), die Tat allenfalls versucht haben könne. Mit Blick darauf, dass selbst objektive Merkmale von Rechtfertigungstatbeständen zumindest nach verbreiteter Auffassung „subjektiv ermittelt“ werden müssen (etwa die Gegenwärtigkeit eines Angriffs i.S.d. § 32 StGB oder der Gefahr i.S.d. § 34 StGB), mag man auf den ersten Blick zweifeln, ob Erlaubnissätze derart unterteilt werden könnten.[65] Tatsächlich dürfte aber jedem Erlaubnissatz zumindest ein „harter, objektiver Kern“ zu entnehmen sein, der die Duldungspflicht des durch den Erlaubnissatz Beeinträchtigten legitimiert, und zumindest regelmäßig werden dem objektiv gerechtfertigten Täter auch die Umstände bewusst sein, die diesen objektiven Kern begründen. Insoweit ist dann nur noch zu überlegen, wie die Fälle zu behandeln sind, in denen objektives und subjektives Rechtfertigungselement doch auseinanderfallen. Das Wechselspiel zwischen Erfolgs- bzw. Handlungsunrecht und dessen kompensierenden Pendants steht somit in einem größeren Zusammenhang, der über seine (isoliert betrachtet wohlbekannten) Fallgruppen hinausweist.
1. Erlaubnistatbestandsirrtum (Wegfall des Handlungs- bzw. Intentionsunrechts?)
18
Eine ausführliche Abhandlung des Meinungsstreits über den Erlaubnistatbestandsirrtum würde hier zwar ihren Platz finden, soweit man ihn auch als Streit über das Unrechtskonzept versteht – sie erfolgt aber traditionellen Gliederungskonzepten folgend an anderer Stelle in diesem Werk.[66] Hier daher nur so viel: Unabhängig davon, ob man einen Verteidigungswillen (im Sinne eines umgekehrten Intentionsunrechts) bei Erlaubnissätzen zwingend verlangt, liegt die Annahme nahe, dass sich jedenfalls sein positives Vorliegen unmittelbar auf das Intentionsunrecht in Gestalt seiner Aufhebung bzw. Kompensation auswirkt.
2. Umgekehrter Erlaubnistatbestandsirrtum (Wegfall des Erfolgsunrechts?)
19
Was das Fehlen des subjektiven Rechtfertigungselements angeht, hat sich in jüngerer Zeit Gropp gegen die doch seit Längerem vorherrschende sog. „Versuchslösung“ ausgesprochen,[67] welche das Erfolgsunrecht als kompensiert betrachtet und an das Handlungsunrecht im Übrigen knüpfend (nur) zur Versuchsstrafbarkeit gelangt.[68] Diese vermittelnd anmutende Lösung lehnt Gropp ab, da ein Täter, der objektiv im Recht handle, begriffslogisch nicht mit Handlungsunrecht agiere, sodass auch der Anknüpfungspunkt für den Versuch wegfalle. Auch wenn Gropp vorsichtig formuliert, dass diese Einordnung „keine Abschaffung des subjektiven Rechtfertigungselements als Bestandteil der personalen Unrechtslehre“[69] bedeuten soll, so läuft diese Lösung letztlich zumindest im Rahmen des § 32 StGB auf einen vollständigen Verzicht des Notwehr- bzw. Nothilfewillens hinaus.
20
Innerhalb der Unrechtslehre kann man die Streitfrage in das Zusammenspiel von objektivem Handlungsunrecht und Intentionsunwert integrieren und daran ausmachen, ob der Intentionsunwert letztlich den Handlungsvollzug – ähnlich wie beim untauglichen Versuch – „einfärbt“.[70] Die Argumentation, wonach eine unterschiedliche Behandlung zwischen diesen beiden Fällen dadurch legitimiert sei, dass der Täter beim untauglichen Versuch schon nach außen hin nicht „rechtskonform“ agiere (während beim umgekehrten Erlaubnistatbestandsirrtum das Verhalten des Täters dem Recht entspreche),[71] vermengt untauglichen und fehlgeschlagenen Versuch: Denn davon abgesehen, dass sich der untaugliche Versuch ohnehin nur schwierig in das geltende Unrechtskonzept integrieren lässt (und daher als Vergleichsmaßstab vielleicht nur bedingt geeignet ist), kann gerade auch dieser sich in objektiv sozialadäquaten Handlungen manifestieren (Überlassung von Nusskuchen an einen nur vermeintlichen Nussallergiker; Beischlaf mit einem nur vermeintlich erst 14-jährigen, tatsächlich aber schon 17-jährigen jungen Mädchen). Hingegen läuft die rigorose Ansicht der frühen Rechtsprechung,[72] die in diesen Fällen den Täter wegen Vollendung bestrafen will, auf eine umgekehrt monistisch-subjektive Lehre hinaus, die sowohl das kompensierte Erfolgs- als auch das objektive Handlungsunrecht nicht berücksichtigt. Zuzugeben ist den Kritikern der Versuchslösung, dass das zugrunde gelegte Schema von unrechtsbegründenden- und unrechtskompensierenden Elementen nicht kaschieren kann, dass die Notwendigkeit eines Verteidigungswillens keine Selbstverständlichkeit ist, mag auch der Wortlaut des § 32 StGB („um“) Gegenteiliges vermuten lassen.[73] Dies wird umso deutlicher, als bei der Fahrlässigkeitsstrafbarkeit ein Intentionsunrecht fehlt und somit kein Bezugspunkt existiert, der durch einen subjektives „Intentionsrecht“ kompensiert werden müsste.[74]
1. Inhalt
21
Ein Erfolgsunrecht ist – nach hier vertretener Auffassung – in erster Linie bei Verletzungen oder konkreten Gefährdungen des Handlungsobjekts gegeben, indem der Achtungsanspruch des rechtlich schützenswerten Interesses realen Ausdruck findet,[75] mithin bei schädlichen Folgen für mögliche Gegenstände subjektiver Rechte.[76] Hierzu zählen etwa die Tötung, die Gesundheitsschädigung, die Zerstörung bzw. Beschädigung von Sachen, deren Wegnahme oder Unterdrückung oder der Eintritt eines Vermögensnachteils. Auch bei einer „Beinahe-Verletzung“ bzw. Schädigung als manifestierter bzw. spürbarer Beeinträchtigung des Achtungsanspruchs lässt sich ein Erfolgsunrecht bejahen. Das Erfolgsunrecht kann auch verschiedene „Stufen“ durchlaufen, und ggf. kann ein zusammengesetztes Delikt zwei auseinandergehende Erfolgsunrechtskomponenten aufweisen (so etwa bei der an § 306 StGB knüpfenden Brandstiftung mit Todesfolge nach § 306c StGB[77]). Die Anknüpfung an reale Lebenssachverhalte macht insofern auch eine Quantifizierung des Unrechtsurteils möglich, was v.a. bei der Strafzumessung (vgl. Rn. 45 ff.) eine Rolle spielt (Art und Ausmaß der Verletzungen, Höhe des Schadens etc.). Wie bereits dargelegt, kann man – ohne erhebliche Auswirkungen – auch schlichten Tätigkeitsdelikten bzw. abstrakten Gefährdungsdelikten (die ggf. auch durch Außenwelterfolge begrenzt werden) einen Erfolgsunrechtsbestandteil zuschreiben, doch macht dies nur Sinn, wenn und soweit dieser bzw. die erfolgreiche Vornahme einer schlichten Tätigkeit eine unterschiedliche Behandlung zum objektiven Handlungsunrecht (in Form der objektiven Manifestation des Intentionsunwerts) rechtfertigt.
2. Erfolgsunrecht und Verbrechenslehre
22
Es wird sich v.a. im Rahmen des objektiven Handlungsunrechts noch zeigen, dass viele „außertatbestandliche“ Fragen bzw. Ausprägungen der modernen Zurechnungslehre mit der Unrechtslehre eng zusammenhängen. Beim Erfolgsunrecht tritt dies v.a. zum Vorschein, wenn ein Verletzungserfolg eintritt, aber nicht als das Werk des Täters angesehen werden kann, weil er auf einem atypischen Kausalverlauf beruht. Auch entfällt das Erfolgsunrecht, wenn die Verletzung nicht vom Täter ausgeht, mithin nicht in dessen Verantwortungsbereich liegt. Angesprochen ist damit nicht nur die Straflosigkeit der Beteiligung an einem Suizid,[78] sondern auch die Lehre von der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung (wobei es in diesen Fällen bereits am Handlungsunrecht fehlen kann[79]). Der terminologischen Abgrenzung zwischen rechtfertigender Einwilligung und einverständlicher Fremdgefährdung, die nach dem Handlungsvollzug und dem Grad der in Kauf genommenen Rechtsgutsbeeinträchtigung vorzunehmen ist, kommt hier keine Indizwirkung dergestalt zu, als nur in letzteren Fällen (erst) das Erfolgsunrecht entfiele.
23
Was die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Straftat angeht, so wurde bereits angedeutet, dass das Erfolgsunrecht etwa bei den „klassischen Fahrlässigkeitsdelikten“ der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung (§§ 222, 229 StGB) zumindest mitkonstitutiv wirkt, während bei schlichten Tätigkeitsdelikten, deren fahrlässige Begehung pönalisiert wird (z.B. § 316 Abs. 2 StGB), darauf verzichtet wird. Was den Versuch angeht, so muss man davon ausgehen, dass im derzeitigen Konzept eines „gemischt subjektiv-objektiven“-Ansatzes, bei dem es für die Versuchsstrafbarkeit nicht auf die tatsächliche auch nur Gefährdung eines Rechtsguts ankommt, das Erfolgsunrecht nicht konstitutiv sein kann (vgl bereits Rn. 23).[80] Denn die unrechtsbegründende Manifestation des Tatentschlusses stellt das objektive Handlungsunrecht dar,[81] welches nicht durch ein Erfolgsunrecht in Form der „Erschütterung der Rechtsgemeinschaft“ ergänzt wird.[82]
IV. Handlungsunrecht
24
Das Handlungsunrecht setzt sich, wie bereits angedeutet, grundsätzlich aus tatbezogenen und täterbezogenen (personalen) Elementen zusammen.[83] Der Gegenstand und das Beziehungsverhältnis dieser beiden Teilelemente zueinander gibt v.a. den Maßstab für die Reichweite der Vorsatz- und Fahrlässigkeitshaftung vor. Dabei stellt sich insb. die umstrittene Frage, inwiefern auf dieser Ebene wiederum beide Elemente kumulativ vorliegen müssen oder auch ein isoliertes Handlungsunrecht in Form des Intentionsunrechts genügen kann.
1. Vorsatz als Intentionsunrecht
25
Als Kern des Handlungsunrechts beim Vorsatzdelikt bezeichnet die neuere Lehre den Vorsatz.[84] Dabei erscheint es im Ergebnis überzeugend, den Vorsatz auch als unrechtskonstituierend zu betrachten:[85] Zum einen wird ein Geschehen durch die unterschiedliche subjektive Einstellung des Täters wohl schon bei intuitivem Zugriff qualitativ abweichend geprägt; zum anderen besteht auch strafrechtstheoretisch eine Beziehung zwischen Rechtswidrigkeit und Willen des Täters:[86] Strafnormen sind – jedenfalls nach moderneren präventiven Strafzweckkonzeptionen – darauf ausgerichtet, den Willen des Täters in Richtung auf die Nichtverletzung von Rechtsgütern zu prägen. Wo dies nicht gelingt und eine Willensbetätigung stattfindet, die sich bewusst gegen diese Rechtsnormen entscheidet, muss das Rechtswidrigkeitsurteil als Bewertung des Geschehens auch die innere Tatseite erfassen.[87] Fehlt es am Vorsatz, kann der Handlungsunwert durch ein „Sorgfaltsmangelunrecht“[88] begründet werden, das ebenso wie das Intentionsunrecht in einem („Pflichtwidrigkeits“-)Zusammenhang zu dem, im Tatbestand beschriebenen Anforderungen an das täterschaftliche Verhalten liegenden, Erfolgsunrecht steht.[89]
2. Objektives Handlungsunrecht
26
In beiden Fällen wird aber das Handlungsunrecht aber auch durch objektive Bestandteile geprägt bzw. sogar erst begründet. Dies sind zunächst und leicht einsehbar – soweit im Tatbestand enthalten – besondere Verhaltensformen, sei es bei den schlichten Tätigkeitsdelikten, sei es in Gestalt von besonderen Verhaltensmodalitäten zur Herbeiführung des Erfolges (vgl. bereits Rn. 3).[90] Darüber hinaus gibt es aber offenbar noch Merkmale, die auch bei reinen, nicht i.e.S. verhaltensgeprägten Erfolgsdelikten neben die verursachende Handlung und den Vorsatz treten müssen. Dies zeigt die Vielzahl von Fällen, in denen es zum Erfolg kommt und auch der Vorsatz in Form von „Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung“ bejaht werden könnte, gleichwohl aber nach verbreiteter Ansicht kein tatbestandsmäßiges Verhalten angenommen wird. Rudolphi hebt in diesem Zusammenhang drei Aspekte hervor, die das objektive Handlungsunrecht begründeten: die Schutzbedürftigkeit des Opfers, die Pflichtenbindung des Täters und die Gefährlichkeit des Handelns des Angriffs für das Rechtsgut.[91] Dies abstrahiert er dann, indem er diese Handlungsfelder abgeleitet von konkretisierten Erfolgsdelikten auf allgemeine Erfolgsdelikte überträgt. Da bei diesen das Handlungsunrecht nicht konkretisiert scheint, verlangt er ein sozialschädliches Verhalten bzw. hebt umgekehrt hervor, dass ein Handlungsunrecht jedenfalls dann verneint werden müsse, wenn die Erfolgsherbeiführung auf ein sozialadäquates Verhalten zurückzuführen sei.[92] In Systematik und Terminologie der h.L. handelt es sich dabei vor allem Fälle, in denen die sog. objektive Zurechnung zu verneinen sein soll.[93]
a) Konkretisierung des objektiven Handlungsunrechts über die Dogmatik der objektiven Zurechnung
27
Das terminologische Abstellen auf „objektive Zurechnung“ darf dabei für unsere Frage nach der Konturierung des Handlungsunrechts nicht etwa zu der Annahme verleiten, es handle sich in Wahrheit gar nicht um ein Problem des Handlungs-, sondern um eines des Erfolgsunrechts, da die „Zurechnung des Erfolges“ in Frage stehe. Insbesondere Frisch hat mit großer Klarheit und systembildender Kraft dargelegt,[94] dass wohl sogar in der größeren Zahl der Fallgruppen, die üblicherweise unter dem Stichwort der „objektiven Zurechnung“ diskutiert werden, gar nicht die Erfolgszurechnung i.e.S. (d.h. der Zusammenhang zwischen einem deliktischen Verhalten und dem Erfolgseintritt) betroffen ist, sondern dass die Lösung derartiger Fälle an sich bereits an einer präzisen „Lehre vom tatbestandsmäßigen Verhalten“ ansetzen muss.[95]
28
Das verdeutlicht ohne detaillierten Rekurs auf einzelne Fallgruppen und Beispiele[96] auch schon die bekannte „allgemeinen Grundformel“ zur objektiven Zurechnung, wonach ein Erfolg dann zurechenbar sein soll, wenn eine missbilligte Gefahr geschaffen worden ist und sich diese Gefahr im Erfolgseintritt realisiert (sowie der Erfolgseintritt auch in den Schutzzweck der verletzten Verhaltensnorm fällt):[97] Denn ob die Handlung eine Gefahr (die von dem Erfolg, in dem sich die Gefahr erst verwirklichen muss, zu unterscheiden ist) schafft oder erhöht und insbesondere ob diese Gefahrschaffung eine unerlaubte ist, hängt noch nicht mit dem Erfolg(sunrecht) und seiner Zurechnung i.e.S. zusammen, sondern betrifft noch die Frage nach einer Qualifizierung des Verhaltens als tatbestandsmäßiges und damit den Unwertgehalt der Handlung.[98] Das wird vielleicht sogar noch deutlicher, wenn man mit Schünemann für die Prüfung der objektiven Zurechnung danach fragt, ob die Einhaltung der tatbestandlichen Verhaltensnorm ex ante und ex post betrachtet zur Schadensverhütung sinnvoll gewesen wäre.[99] Denn die (insbesondere ex-ante‑) Eignung zur Schadensverhütung ist allein eine Eigenschaft des Verhaltens und damit der – im Falle der Nichteinhaltung – tatbestandsmäßigen (oder eben nicht tatbestandsmäßigen) Handlung, nicht des deliktischen Erfolges. Entscheidend zur Bestimmung des Handlungsunrechts ist dabei die Frage, ob der Täter ein pflichtwidriges Risiko für das geschützte Rechtsgut geschaffen hat.
b) Kritik
29
Gegen die Figur der „objektiven Zurechnung“ sowie die damit zusammenhängende Betonung der Pflichtwidrigkeit und somit für eine stärkere Betonung des subjektiven Tatbestandes sprechen sich auch bis in die Gegenwart verschiedene Kritiker aus.[100] Die dabei insbesondere von Kindhäuser ebenso detailliert wie scharfsinnig geübte Kritik muss hier aus Gründen des Umfangs auf zwei zentrale Aspekte reduziert werden, die einer Stellungnahme bedürfen, wenn man die Berechtigung dieser Figur im Folgenden zugrunde legen will:
30
Zum einen sieht Kindhäuser – explizit auch mit Auswirkung für die Bestimmung des Handlungsunrechts – für das Vorsatzdelikt „kein(en) Raum mehr (…), soll nicht auf Tatbestandsebene die Zurechnung kraft Täterwissen in einem überflüssigen Doppelschritt vollzogen werden.“[101] Eine der subjektiven Zurechnung vorgeschaltete „Zurechnung zur Handlungsfähigkeit eines fiktiven Normadressaten“ sei dysfunktional, da entweder beide „Filter“ identische Wirkung auf unterschiedlichen Prüfungsstufen hätten oder aber sogar der „frühere Filter“ etwas „stoppt (…), was den späteren Filter passieren darf und soll“.[102]
31
Daran ist ohne Zweifel richtig, dass die Trennung zwischen objektiver Zurechnung und der Berücksichtigung subjektiver Elemente nicht so klar und scharf vollzogen werden kann, wie es die Terminologie vielleicht glauben macht. Dies wird etwa bei der Berücksichtigung von Sonderkenntnissen des Täters deutlich, die haftungsbegründend wirken können, wenn ein ganz unwahrscheinlicher „objektiv nicht bezweckbarer“ Geschehensablauf vorliegt, den der Täter individuell aber vorhersehen kann.[103] Allerdings sind zum einen nicht alle Fallgruppen der objektiven Zurechnung so „gestrickt“; vielmehr sind etwa im Rahmen des erlaubten Risikos[104] bzw. durch entsprechende Sondernormen auch explizite „Verletzungserlaubnisse“ vorstellbar.[105] Zum anderen bietet es eine zwar gewiss nicht unverzichtbare,[106] aber dennoch wertungsmäßig interessante Feststellung, ob die fehlende Zurechnung auf individuellen Defekten des Täters oder bereits auf dem objektiven Fehlen einer unerlaubten Gefahrschaffung beruht. Die (weniger schlimme Alternative der) Dysfunktionalität dahingehend, dass „zwei Filter“ mit gleicher Wirkung auf verschiedenen Stufen angebracht werden, wird dadurch wettgemacht, dass der Filter nicht nur (im Prüfungsschema und damit in der Begriffsbildung) früher, sondern auch dort angebracht wird, wo er inhaltlich hingehört.
32
Zum anderen sei die Vorsatzhaftung auch unabhängig von der Feststellung von Sorgfaltswidrigkeiten, was Kindhäuser mit einem Beispiel zu verdeutlichen sucht: Analysiere man das „Verbot der Brandstiftung durch unsorgfältigen Umgang mit Streichhölzern“, sei offensichtlich die Eigenschaft „‚unsorgfältig‘ nicht verbotskonstitutiv, wenn man das merkwürdige Ergebnis vermeiden will, daß Brandstiftung durch sorgfältigen Umgang mit Streichhölzern erlaubt sei“.[107] Freilich wird dieses Ergebnis weniger „merkwürdig“, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es hier letztlich um einen (bewusst oder unbewusst) abweichenden Begriff der „Sorgfaltswidrigkeit“ geht. Während Kindhäuser in seinem Beispiel die sorgfältige (und damit nicht sorgfaltswidrige) i.S.d. genau überlegten Benutzung der Streichhölzer in den Mittelpunkt rückt (die beim Anzünden eines Hauses in gleicher Weise vorliegen kann wie beim Anzünden der Kerze an einem Adventskranz), wäre nach tradiertem Verständnis die (Sorgfalts‑)Pflichtverletzung bei der vorsätzlichen Brandstiftung in der Verwendung der Streichhölzer im konkreten sozialen Kontext zu sehen. Das vorsätzliche Entzünden eines fremden Hauses kann daher ohne weiteres „sorgfältig“ vorgenommen werden, ohne dass das Verhalten deswegen pflichtgemäß wäre.
3. Konstitutive Handlungsunrechtselemente beim Vorsatzdelikt – zum Wechselspiel von Intentionsunrecht und objektiven Handlungsunrechtselementen
33
Sollen nun die objektiven Handlungsunrechtskomponenten beim Vorsatzdelikt näher umschrieben werden, so scheint sich bereits mit der Benennung einer „pflichtwidrigen Risikoschaffung“ als Voraussetzung eines auch „objektiven“ Handlungsunrechts, aber auch auf Grund der vorangegangenen Ausführungen schon terminologisch die Frage aufzudrängen, ob hier nicht letztlich aus der Fahrlässigkeitsstrafbarkeit bekannte Elemente auch zur Konturierung der Vorsatzstrafbarkeit herangezogen werden können bzw. sogar müssen oder aber ob die Anforderungen an die objektive Pflichtwidrigkeit des Verhaltens – da beim Vorsatzdelikt eben nur einen Teil des Handlungsunrechts ausmachend – niedriger anzusetzen sind:
a) „Fahrlässigkeit“ als Voraussetzung jedes Vorsatzdelikts?
34
Die extremste und voraussetzungsvollste Position ließe sich damit beschreiben, dass auch beim Vorsatzdelikt das Handlungsunrecht in identischer Weise begründet werden muss wie beim Fahrlässigkeitsdelikt, bei dem nach seit langem einhelliger Auffassung die Pflichtwidrigkeit auch als objektives Verhaltensmoment erforderlich ist,[108] um den Unrechtstatbestand zu begründen. Eine Gleichschaltung des Handlungsunrechts bei Fahrlässigkeits- und Vorsatzdelikt würde nun dadurch erreicht, dass – wie insbesondere von Herzberg immer wieder pointiert gefordert wird – „Fahrlässigkeit (sc. zur) Voraussetzung jeder Vorsatzhaftung“ gemacht würde, d.h. dass keine Strafbarkeit wegen eines Vorsatzdeliktes bejaht werden könnte, wenn der Täter durch das gleiche Verhalten – den Vorsatz hinweggedacht – nicht auch ein Fahrlässigkeitsdelikt begangen hätte.[109] Ganz ähnlich klingt das etwa[110] auch bei Jakobs, wenn er feststellt, dass „eine (. . .) sorgfaltsgemäße Vorsatztat (. . .) eine contradictio in adiecto“ wäre,[111] und schon 35 Jahre früher bei Krauß, der meint, dass „niemand wegen einer vorsätzlichen Tat bestraft werden kann, der nicht auch ohne Vorsatz bei entsprechender Strafdrohung wegen fahrlässiger Begehung bestraft würde.“[112]
b) Kritik
35
Obgleich die Übertragung von in der Fahrlässigkeitsdogmatik schon länger bekannten Elementen auf das Vorsatzdelikt für das Verständnis einzelner Fallgruppen der objektiven Zurechnung hilfreich ist, erscheint eine völlige Gleichsetzung nicht überzeugend. Dass nicht in jedem Fall, in dem eine Vorsatzstrafbarkeit zu bejahen ist, ohne Vorsatz zugleich auch eine Fahrlässigkeit bejaht werden kann, lässt sich zunächst an einem Beispiel verdeutlichen:[113] Auf einer ordnungsgemäß abgesperrten und gesicherten Abrissbaustelle schaufelt Bauarbeiter B in einem oberen Stockwerk Bauschutt in eine große, extra für diese Zwecke angebrachte Röhre, in welcher der Schutt nach unten fällt.
– Variante a: Ohne dass B dies merken kann, hat Passant P die Absperrung überwunden und geht am Abrisshaus entlang, um einige Meter Weg zu sparen. Gerade, als er unten am Ende der Röhre vorbeikommt, kommt eine Ladung Schutt unten an; ein Ziegelstein trifft P und verletzt ihn. – Variante b: B ärgert sich, dass immer wieder Passanten den Weg abkürzen; als er P unten am Haus vorbeilaufen sieht, passt er ihn genau ab, wirft eine Schaufel Schutt in die Röhre und tritt – wie erhofft und berechnet – den unten vorbeilaufenden P.36
Während man in Variante a kaum überzeugend eine Fahrlässigkeit (§ 229 StGB) des B annehmen kann, erschiene es in Variante b ebenso befremdlich, den Tatbestand des § 223 StGB zu verneinen, und zumindest äußerst gekünstelt, diese erst mittels Hilfskonstruktionen wie der actio illicita in causa, einer mittelbaren Täterschaft o.ä. zu begründen. Zwar mag man auf den ersten Blick gegen dieses Beispiel einwenden, dass B, der ursprünglich die Kenntnisse aus Variante b hatte (d.h. den P gesehen hatte), aber konkret nicht mehr an die Gefährlichkeit dachte oder auf einen guten Ausgang vertraute (und z.B. P nur erschrecken wollte), natürlich doch wieder fahrlässig handeln würde. Bei dieser Blickweise, welche die (sonst fehlenden) Voraussetzungen des Vorsatzdelikts in das Fahrlässigkeitsdelikt implementiert, würde aber nicht nur die Aussage, dass in jedem Vorsatz- zugleich ein Fahrlässigkeitsdelikt steckt, ihre informative Substanz weitgehend verlieren. Vielmehr würde dann auch eine Voraussetzung des subjektiven Tatbestandes benötigt, um (über den Hebel der dann bejahbaren Fahrlässigkeit) über die objektive Tatbestandsmäßigkeit zu entscheiden.