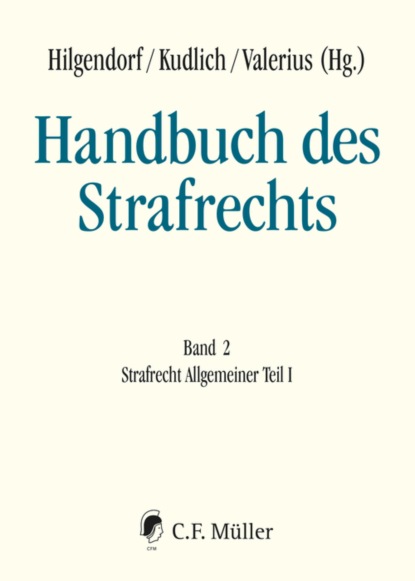- -
- 100%
- +
75
Diese sehr nahe an den einzelnen Tatbestandsmerkmalen orientierte Auslegung erscheint im Hinblick auf den Schutzzweck abstrakter Gefährdungsdelikte überdenkenswert. Schließlich wäre es jedenfalls kurios, dass die Entscheidung des Gesetzgebers für ein abstraktes Gefährdungsdelikt unter Verzicht auf eine konkrete Gefahr oder eine Verletzung des geschützten Rechtsguts als tatbestandlichen Erfolg bei Handlungen im Inland zu einer Ausweitung des Strafrechts führen würde, bei Handlungen im Ausland hingegen zu einer Einschränkung mangels Anwendbarkeit des nationalen Strafrechts wegen eines generell abzulehnenden Erfolgsorts führte.[176] Auch bei § 13 Abs. 1 StGB wird die mit § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB vergleichbare Formulierung „einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört“, nicht derart interpretiert, dass ein unechtes Unterlassen bei Tätigkeitsdelikten von vornherein ausgeschlossen ist.[177] Einiges spricht daher dafür, bei Tätigkeitsdelikten einen Erfolgsort nicht kategorisch abzulehnen. Als „Erfolg“ im Sinne des § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB ließe sich grundsätzlich diejenige (abstrakte) Gefahr begreifen, vor deren Realisierung der jeweilige Straftatbestand gerade schützen wollte. Ein Erfolgsort könnte demzufolge überall dort erwogen werden, wo sich diese Gefahr realisieren könnte[178] bzw. tatsächlich realisiert hat.[179] Allerdings bleibt zu berücksichtigen, dass ein Staat selbst nach dem Auswirkungsgrundsatz (Rn. 18) seine Strafgewalt nicht schon bei lediglich denkbaren Folgen beanspruchen kann. Notwendig sind vielmehr tatsächliche Beeinträchtigungen oder zumindest konkrete Gefährdungen des geschützten Rechtsguts. Daher bietet es sich an, für die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts bei abstrakten Gefährdungsdelikten ebenso eine (Verletzung oder zumindest) konkrete Gefährdung des jeweiligen Schutzguts zu fordern.[180] Abstrakten Gefährdungsdelikten einen Erfolgsort zuzugestehen, bedeutet somit nicht, für eine uferlose Anwendbarkeit des nationalen Strafrechts einzutreten.
76
Hoheitliche Strafgewalt kann sowohl für die Unterbindung bestimmter Verhaltensweisen (Tätigkeitsprinzip) als auch für die Vermeidung unerwünschter Auswirkungen (Erfolgsprinzip) beansprucht werden. Daher können sog. Distanzdelikte, bei denen der Erfolg in einem anderen Staat eintritt als an demjenigen Ort, an dem die erfolgsursächliche Tätigkeit vorgenommen wird, die Anwendbarkeit des Strafrechts sämtlicher beteiligten Staaten begründen. Zur Illustration mag ein einfaches Beispiel dienen, in dem ein Täter im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich von Deutschland aus einen tödlichen Schuss auf einen Spaziergänger in Österreich abgibt, der dort auf der Stelle verstirbt. In Fällen wie diesen kann sowohl der „Tätigkeitsstaat“, auf dessen Territorium das betreffende Verhalten stattfindet, als auch der „Erfolgsstaat“, auf dessen Gebiet die kausal herbeigeführte Gefahr oder Schädigung zu bemerken bleibt, seine Strafgewalt beanspruchen.[181]
77
Eine der wachsenden Globalität sowie nicht zuletzt der zunehmend fortschreitenden Informations- und Kommunikationstechnologie geschuldete Entwicklung lässt zudem sog. multiterritoriale Delikte als Unterform der Distanzdelikte zum Alltag werden. Zu denken ist etwa an Medienerzeugnisse, die in mehreren Staaten zugleich publiziert werden (z.B. internationale Übertragungen von Sportwettbewerben und sonstigen kulturellen Ereignissen in Rundfunk und Fernsehen), bis hin zu sämtlichen frei zugänglichen Inhalten im Internet, die grundsätzlich weltweit abgerufen werden können. In solchen Konstellationen kann der Täter mit einer einzigen Handlung, etwa einer einzigen Äußerung von seinem Heimatstaat aus, einen Erfolgseintritt in einer Vielzahl fremder Staaten herbeiführen und dadurch entsprechend viele nationale Strafrechtsordnungen zugleich berühren.[182] Insbesondere bei Veröffentlichungen im Internet droht daher eine Mehrfachzuständigkeit zahlreicher Staaten und die Gefahr mehrfacher Strafverfolgung des Täters, die es nicht zuletzt im Hinblick auf eine ggf. unterschiedliche strafrechtliche Beurteilung des jeweiligen Verhaltens in den betroffenen Staaten kritisch zu hinterfragen gilt (Rn. 86 ff.).[183]
78
Der durch ein bestimmtes Verhalten ausgelöste Kausalverlauf als solcher bildet keinen Anknüpfungspunkt für die nationale Staatsgewalt. Deshalb bieten sog. Transitdelikte, bei denen Tatobjekt oder Tatmittel auf ihrem Weg vom ausländischen Handlungs- zum ausländischen Erfolgsort das Inland durchqueren (z.B. bei einem in Österreich aufgegebenen, über Deutschland an den niederländischen Empfänger übermittelten Brief beleidigenden Inhalts), dem sog. Durchgangsstaat keinen Anknüpfungspunkt für seine hoheitliche Strafgewalt.[184] Etwas anderes gilt nur, wenn der Transport durch das Inland selbst eine Tathandlung nach deutschem Recht darstellt (wie z.B. bei der nach § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 i.V.m. § 11 Abs. 1 S. 2 BtMG strafbaren Durchfuhr von Betäubungsmitteln).[185]
2. Täter und Teilnehmer im Strafanwendungsrecht
79
„Tat“ im Sinne der §§ 3 ff. StGB erfasst nach herrschender Meinung sowohl die Beteiligung als Täter als auch als Teilnehmer.[186] Schließlich sind die gängigen Kriterien für die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme für die maßgeblichen Anknüpfungspunkte von Territorialitätsprinzip, Personalitätsprinzipien, Real- und Weltrechtsprinzip nicht von Bedeutung.[187] Dass in § 9 StGB zwischen dem Ort der „Tat“ im Sinne der Täterschaft (Abs. 1) und dem Ort der Teilnahme (Abs. 2) unterschieden wird, steht dem nicht entgegen. Hiermit wird nur der Begehungsort der Teilnahme geregelt, nicht aber die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts bestimmt, die allein § 3 StGB normiert.[188] Ebenso wenig schließt Art. 103 Abs. 2 GG die vorstehende Deutung aus.[189]
80
Dass bei der Auslegung der §§ 3 ff. StGB jedenfalls nicht uneingeschränkt an die deutsche Beteiligungsdogmatik angeknüpft werden darf, zeigt sich auch in mehreren Nummern des § 5 StGB sowie in § 7 Abs. 2 StGB, in denen das Gesetz jeweils vom „Täter“ spricht. Würde dieser Begriff naheliegend im Sinne des § 25 StGB verstanden werden und Teilnehmer im Sinne der §§ 26, 27 StGB ausschließen, zöge dies nicht verständliche Folgen nach sich. Exemplarisch lässt sich dies an der Vorschrift des § 5 Nr. 9 lit. b StGB aufzeigen, nach der auf einen im Ausland durchgeführten Schwangerschaftsabbruch § 218 StGB anwendbar ist, „wenn der Täter zur Zeit der Tat Deutscher ist und seine Lebensgrundlage im Inland hat“. Sollte ein deutscher Arzt mit Lebensmittelpunkt in Aachen in den Niederlanden eine Abtreibung vornehmen, könnte er demzufolge in Deutschland nach § 218 StGB verurteilt werden.[190] Gleiches müsste aber für den niederländischen Arzthelfer gelten, der ihm bei dem Eingriff assistiert und in seiner Person nicht die besonderen Voraussetzungen des § 5 Nr. 9 lit. b StGB erfüllt, wenn „Täter“ im Sinne dieser Norm tatsächlich als „Täter“ im Sinne der Beteiligungslehre verstanden würde. Diese Abhängigkeit der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf den Teilnehmer von der Staatsangehörigkeit und/oder dem Lebensmittelpunkt des Täters erscheint jedoch nicht nachvollziehbar, da sich die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf den Täter gerade auf das aktive Personalitätsprinzip zu stützen vermag.[191] Ohnehin bleibt zu bedenken, dass die Unterscheidung der (deutschen) Beteiligungslehre zwischen Täter und Teilnehmer für den Inlandsbezug nicht relevant ist, den § 5 StGB mit seiner Anknüpfung an verschiedene völkerrechtliche Prinzipien voraussetzt.[192] Daher wird hier zu Recht ein eigener strafanwendungsrechtlicher Täterbegriff vertreten, der sowohl Täter als auch Teilnehmer im Sinne der Beteiligungslehre erfasst.[193] Bei § 5 Nr. 9 lit. b StGB muss daher nicht nur der Täter, sondern auch der Teilnehmer Deutscher sein und seine Lebensgrundlage im Inland haben.[194]
81
Fraglich erscheint angesichts dieser von der Beteiligungslehre unabhängigen Überlegungen ebenso die von der herrschenden Meinung befürwortete Zurechnung von Begehungsorten bei Mittätern und mittelbaren Tätern. Demnach sollen Mittätern ebenso sämtliche Begehungsorte untereinander gemäß § 25 Abs. 2 StGB zugerechnet werden[195] wie mittelbaren Tätern gemäß § 25 Abs. 1 Var. 2 StGB die Begehungsorte ihres menschlichen Werkzeugs.[196] Hierfür scheint bei Mittätern etwa der Grundsatz der wechselseitigen Zurechnung zu sprechen. Denn wenn sich Mittäter untereinander die Tatbeiträge ihrer Komplizen zurechnen lassen müssen, könne schließlich nichts anderes für ihre Begehungsorte gelten.[197] Nach der Rechtsprechung soll sogar an dem Ort, an dem ein Mittäter Vorbereitungshandlungen erbringt, auf deren Vornahme sich sein Tatbeitrag beschränkt, ein Handlungsort für sämtliche Mittäter begründet werden.[198]
82
Allerdings bleibt hierbei außer Betracht, dass die Zurechnung von Tatbestandsmerkmalen gerade bei arbeitsteiligem Verhalten dem Umstand geschuldet ist, ansonsten keinem der Mittäter die vollständige Verwirklichung des jeweiligen Straftatbestandes vorwerfen zu können. Dagegen weist die Tat eines Mittäters auch ohne Zurechnung der Begehungsorte eines anderen Mittäters bereits einen eigenen Erfolgsort sowie – jedenfalls bei Beteiligung im Ausführungsstadium der Tat – einen eigenen Tätigkeitsort auf. Einer Zurechnung bedarf es demzufolge nicht, um Anknüpfungspunkte für die Anwendbarkeit der nationalen Strafrechtsordnungen zu begründen.[199] Ebenso wenig erscheint es bei dem mittelbaren Täter notwendig, ihm den Begehungsort des Vordermannes zuzurechnen. Schließlich weist der mittelbare Täter bereits einen eigenen Tätigkeitsort an dem Ort seiner erfolgsursächlichen Einwirkung auf den Tatmittler auf.[200] Nach anderer Auffassung wird daher der Begehungsort eines Mittäters ebenso wenig den anderen Mittätern zugerechnet[201] wie der Begehungsort eines Tatmittlers dem mittelbaren Täter.[202]
83
Problematisch erscheint gleichfalls die in § 9 Abs. 2 S. 1 StGB angeordnete Zurechnung von Begehungsorten des Täters gegenüber dem Teilnehmer. Nach § 9 Abs. 2 S. 1 Var. 1 StGB ist die Teilnahme unter anderem „an dem Ort begangen, an dem die Tat begangen ist“. Über diese Regelung werden dem Teilnehmer sämtliche Begehungsorte sämtlicher (insbesondere Mit-)Täter als eigene zugerechnet. Dies führt – was unter anderem bei grenzüberschreitenden (ethisch wie) rechtlich umstrittenen Forschungsprojekten Strafbarkeitsrisiken hervorruft (Rn. 93 ff.) – zu einer nicht unbedenklichen Vervielfältigung von Teilnahmeorten.[203] Dass diese gesetzliche Regelung nicht zu überzeugen vermag, verdeutlicht ein Vergleich mit der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts bei der Einheitstäterschaft im Fahrlässigkeitsbereich. Sollte im Grenzgebiet zwischen Deutschland und der Schweiz ein Täter von Deutschland aus vorsätzlich einen Grenzbeamten in der Schweiz mit einer Waffe verletzen, die ihm in Kenntnis des Tatplans in Österreich ausgeliehen wurde, würde sowohl auf Täter (§ 9 Abs. 1 Var. 1 StGB) als auch auf Teilnehmer (§ 9 Abs. 2 Var. 1 StGB) das deutsche Strafrecht anwendbar sein. Fehlt hingegen sowohl Täter als auch Teilnehmer der Vorsatz im Hinblick auf eine Verletzung des Grenzbeamten, weil sie ihn durch den Schuss etwa nur erschrecken, nicht aber etwa treffen wollen, wäre zwar für den Schützen gemäß § 9 Abs. 1 Var. 1 StGB nach wie vor deutsches Strafrecht anwendbar. Für die fahrlässige Körperverletzung durch denjenigen, der dem Schützen die Waffe in Kenntnis des nicht ungefährlichen Tatplans verleiht, könnte hingegen für den Tätigkeitsort wegen seiner täterschaftlichen Haftung im Fahrlässigkeitsbereich nur auf dessen eigenen sorgfaltspflichtwidrigen Beitrag abgestellt werden, der indessen in Österreich erbracht wurde. Ob dieses unterschiedliche Ergebnis nur mit dem lediglich fahrlässigen statt vorsätzlichen Verhalten begründet werden kann, dürfte zu bezweifeln sein. Es spricht daher viel dafür, generell bei Tätern und Teilnehmern nur auf den eigenen Tätigkeitsort (sowie den in der Regel gemeinsamen Erfolgsort) abzustellen und von einer Zurechnung der Tätigkeitsorte abzusehen.
3. Irrtümer über das Strafanwendungsrecht
84
Welche Rechtsfolgen Fehlvorstellungen über den räumlichen Geltungsbereich nach sich ziehen, hängt maßgeblich von der Natur der Regelungen der §§ 3 bis 7, 9 StGB ab. Die herrschende Meinung ordnet die strafanwendungsrechtlichen Voraussetzungen als objektive Bedingungen der Strafbarkeit ein.[204] Schließlich sei es eine völkerrechtliche Frage, wie weit die nationale Strafgewalt reicht. Die Antwort hierauf könne nicht in das Belieben eines Einzelnen gestellt werden oder von dessen Vorstellungen abhängen, sondern sei nach objektiven Kriterien zu bestimmen.[205] Fehlvorstellungen über die Voraussetzungen der §§ 3 bis 7, 9 StGB, z.B. über den Begehungsort der Tat (§ 9 Abs. 1 oder Abs. 2 StGB) oder über die Staatsangehörigkeit des Opfers (§ 7 Abs. 1 StGB), sollen demnach zumindest keinen Tatumstandsirrtum begründen.[206]
85
Selbst auf dem Boden der herrschenden Ansicht bleiben Irrtümer über den räumlichen Geltungsbereich indessen nicht stets völlig unbeachtlich. Denn die Einordnung der Voraussetzungen des Strafanwendungsrechts als objektive Bedingungen der Strafbarkeit bedeutet nicht, dass ihnen kein Unrechtsgehalt zuteilwird.[207] Vielmehr bleibt zu berücksichtigen, dass sich die Beurteilung eines Verhaltens als Unrecht erst auf der Grundlage einer spezifischen Rechtsordnung ergibt. Auch die konkrete verletzte Rechtsordnung stellt somit einen eigenen Bezugspunkt für einen Irrtum dar.[208] In eine ähnliche Richtung argumentiert der BGH, wonach – aufgezeigt an dem Schutz der inländischen Strafrechtspflege durch den Tatbestand der Strafvereitelung gemäß § 258 StGB – einem Verbotsirrtum unterliege, wer die vom verwirklichten Straftatbestand umfasste spezifische Rechtsgutsverletzung nicht als Unrecht erkenne.[209] Fehlvorstellungen über die Anwendbarkeit einer Strafrechtsordnung können demzufolge einen Verbotsirrtum nach sich ziehen.[210]
1. Reichweite des nationalen Strafrechts im Internet
86
Ein ungeklärtes Problem bildet nach wie vor die Anwendbarkeit des nationalen Strafrechts auf Straftaten im Internet. Für Straftaten, die mittels des Internets begangen werden, d.h. Rechner und Computernetzwerke als Tatmittel einsetzen, sind zunächst die allgemeinen Grundsätze heranzuziehen. Der Tätigkeitsort gemäß § 9 Abs. 1 Var. 1 StGB liegt demzufolge am Ort der auf die Tatbestandsverwirklichung gerichteten Handlung (Rn. 71), d.h. dort, wo der Täter an seinem netzwerkfähigen Gerät sitzt und Befehle etc. über das Internet sendet. Der Erfolgsort im Sinne des § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB bleibt dort zu verorten, wo die von der jeweiligen Strafvorschrift erfassten Auswirkungen eintreten (Rn. 72), häufig somit an dem Ort, an dem sich der Zielrechner befindet, der im Rahmen der Tat angesprochen wird. Wer sich also beispielsweise von Kanada aus unbefugten Zugriff auf einen Zielrechner in Portugal verschafft, begeht eine entsprechende Straftat sowohl in Kanada als auch in Portugal. Wer von den Niederlanden aus Lebenserhaltungssysteme in einem Krankenhaus in Japan manipuliert und dadurch den Tod eines Patienten hervorruft, begeht die Tat sowohl in den Niederlanden als auch in Japan. Es versteht sich von selbst, dass die zur Illustration genannten Staaten beliebig gewählt und ohne Verlust einer inhaltlichen Aussage auch durch allgemeine Platzhalter A, B, C etc. ersetzt werden können.
87
Denkbar erscheint, ebenso das Strafrecht derjenigen Staaten anzuwenden, über deren Territorium die via Internet verbreiteten Befehle, Daten etc. befördert werden. Einer solchen Lösung steht aber bereits das praktische Element entgegen, dass der Nachweis des konkreten Datenweges mit enormen Schwierigkeiten verbunden wäre, vor allem die dezentrale Struktur des Internets mit seinen Routern zur Folge hat, dass selbst Teile ein und derselben transferierten Datei über verschiedene Wege vom Ausgangs- zum Zielrechner gesendet werden können. Insbesondere lassen sich hier jedoch die Überlegungen zum Transitdelikt übertragen, wonach allein die Beförderung von Tatobjekten oder Tatmitteln grundsätzlich noch nicht die Ausübung der nationalen Strafgewalt legitimiert (Rn. 78). Demzufolge begründet allein die Versendung von Daten über das Territorium eines Staates noch nicht die Anwendbarkeit dessen Strafrechtsordnung.
88
Während somit auf Straftaten mittels des Internets die allgemeinen Grundsätze zum Strafanwendungsrecht ohne weiteres übertragen werden können, bereiten Straftaten im Internet, d.h. rechtswidrige Veröffentlichungen in dessen mannigfaltigen Kommunikationsdiensten, nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Aufgrund der dezentralen Struktur und zugleich fehlenden Abhängigkeit des Internets von staatlichen Grenzen können Inhalte, die jemand von seinem Rechner in einem bestimmten Staat aus im Internet (z.B. auf Webseiten, in Meinungsforen oder auf Plattformen sog. sozialer Netzwerke) ohne Zugangsbeschränkung veröffentlicht, grundsätzlich weltweit abgerufen werden. Äußerungen im Internet ist folglich gemein, die Hoheitsgewalt und das Territorium zahlreicher, in der Regel sogar sämtlicher Staaten der Welt zu betreffen; insoweit kann von einem sog. multiterritorialen Delikt (Rn. 77) gesprochen werden. Bereits den Abruf oder sogar die bloße Abrufbarkeit solcher Daten in einem Staat ausreichen zu lassen, damit dessen Strafrecht Anwendung findet, führte jedoch dazu, dass sich jegliche frei im Internet veröffentlichte Äußerung an den Strafrechtsordnungen sämtlicher Staaten der Welt messen lassen müsste. Es würden letztlich somit die jeweils restriktivsten nationalen Strafgesetze über die Strafbarkeit von Inhalten im Internet entscheiden.[211]
89
Es gibt verschiedene Ansätze, mit den geschilderten Besonderheiten des Internets zu verfahren.[212] So wurden insbesondere in den Anfängen der Diskussion Vorschläge unterbreitet, die an die technischen Eigenschaften des Internets anknüpfen wollten, um die Reichweite der nationalen Strafgewalt bei Äußerungen im Internet zu bestimmen. Beispielsweise plädierte Sieber für die Anerkennung eines sog. Tathandlungserfolgs als Erfolg im Sinne des § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB.[213] Darunter sei „jede vom Täter verursachte, ihm zurechenbare und im einschlägigen Tatbestand genannte Folge seiner Handlung“ zu verstehen.[214] Bei der Tathandlung des Zugänglichmachens, die viele Äußerungsdelikte enthalten, würde daher an jedem Ort ein Erfolgsort begründet werden, an dem der Täter die Möglichkeit zur Kenntnisnahme eröffne. Dies setze bei der Verbreitung von Inhalten im Internet voraus, dass der Täter Daten aktiv (mittels sog. Push-Technologie) auf einen Rechner weiterleite, während bei Veranlassung eines Datentransfers durch einen Dritten (mittels sog. Pull-Technologie) ein Tathandlungserfolg abzulehnen bleibe.[215] Im Ergebnis zumindest ähnlich, wenngleich bei § 9 Abs. 1 Var. 1 StGB verortet, schlug vornehmlich Cornils vor, bei Äußerungsdelikten im Internet einen Handlungsort nicht nur am Aufenthaltsort des Täters, sondern auch an dem Standort desjenigen Rechners anzunehmen, auf welchem der Täter gezielt und kontrolliert eine Datei speichert.[216] Diese differenzierten Vorschläge vermögen indes nicht zu überzeugen, weil sie zu sehr an die technischen Besonderheiten des Internets und somit zu sehr an den Zufall (z.B. der Belegenheit des vom Täter adressierten Servers) anknüpfen.[217] Sofern eine Ausweitung des Handlungsortes erwogen wird,[218] bleibt außerdem einzuwenden, dass die geschilderten Ansätze den Handlungsbegriff zu überspannen drohen und vor allem nicht mehr hinreichend zwischen der Handlung und ihren Folgen differenzieren.[219] Demzufolge befindet sich der Handlungsort (auch und gerade bei Straftaten im Internet) allein an dem Ort der körperlichen Präsenz des Täters.[220]
90
Mittlerweile wird erfreulicherweise wieder versucht, bei allen tatsächlichen Besonderheiten des Internets eine Lösung aus den rechtlichen Grundsätzen des Strafanwendungsrechts zu erarbeiten. Hierbei bleibt vorab zu bemerken, dass die meisten Äußerungsdelikte wie z.B. die Verbreitung pornographischer Schriften gemäß §§ 184 ff. StGB oder die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86a StGB abstrakte Gefährdungsdelikte darstellen, eine Verletzung oder auch nur konkrete Gefährdung des jeweils geschützten Rechtsguts als tatbestandlichen Erfolg deshalb gerade nicht voraussetzen. Die Diskussion konzentriert sich demzufolge darauf, ob abstrakte Gefährdungsdelikte einen „zum Tatbestand gehörende(n) Erfolg“ im Sinne des § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB aufweisen. Die herrschende Meinung verneint dies aus den geschilderten Gründen (Rn. 74), so dass bei abstrakten Gefährdungsdelikten in der Regel nur an den Handlungsort im Sinne des § 9 Abs. 1 Var. 1 StGB angeknüpft werden kann. Sämtliche Inhalte, die vom Ausland aus über das Internet verbreitet werden, unterfielen demzufolge nicht dem deutschen Strafrecht.[221] Konsequenterweise hat der Dritte Strafsenat des BGH einen Angeklagten vom Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86a StGB freigesprochen, der von Tschechien aus Bilddateien mit Hakenkreuzen auf ein Internet-Videoportal geladen hat.[222]
91
Nach der vorzugswürdigen Gegenansicht (Rn. 75) wäre eine Anwendung des § 86a StGB in dem vorstehenden Fall nicht schon deswegen kategorisch ausgeschlossen, weil es sich bei der Vorschrift um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt. Vielmehr käme jedenfalls dann die Anwendbarkeit des nationalen Strafrechts in Betracht, wenn das geschützte Rechtsgut tatsächlich beeinträchtigt bzw. zumindest konkret gefährdet wird und daher der betroffene Staat auch die Ausübung seiner Strafgewalt beanspruchen darf. Gleiches gilt für abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte wie die Volksverhetzung gemäß § 130 StGB, die eine als gefährlich eingestufte Tätigkeit unter der zusätzlichen Voraussetzung unter Strafe stellen, dass sie geeignet ist, das geschützte Rechtsgut zu verletzen. Insoweit hob der Erste Strafsenat des BGH in seiner Toeben-Entscheidung zunächst zu Recht hervor, dass sich die Auslegung des „zum Tatbestand gehörenden Erfolgs“ im Sinne des § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB nicht an den Kategorien der allgemeinen Tatbestandslehre und deren Differenzierung zwischen Erfolgs- und Tätigkeitsdelikten orientiere. Maßgeblich sei vielmehr der Gesetzeszweck des § 9 StGB, der Beeinträchtigungen und Gefährdungen von Rechtsgütern unterbinden wolle, welche der jeweilige Straftatbestand gerade schütze.[223] Der Erste Strafsenat verstand diesen nicht unzutreffenden Ausgangspunkt sodann aber allzu weit und schien letzten Endes allein infolge der freien Abrufbarkeit einer englischsprachigen Holocaustleugnung, die ein australischer Staatsbürger auf einer auf einem australischen Server gespeicherten Webseite äußerte, im Inland eine konkrete Eignung der Äußerung zur Friedensstörung hierzulande und somit auch die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts zu bejahen.[224] Auch der notwendige völkerrechtlich legitimierende Anknüpfungspunkt ergebe sich aus dem Gewicht des im konkreten Fall von § 130 StGB geschützten inländischen Rechtsguts und dessen objektivem besonderen Bezug zum inländischen Staatsgebiet.[225] Dies bedeutete aber letztlich, allein aus dem Schutzgut eines nationalen Straftatbestandes und dem ihm von dem nationalen Gesetzgeber verliehenen Gewicht den notwendigen völkerrechtlich legitimierenden Anknüpfungspunkt ableiten zu können, so dass dieser Voraussetzung nahezu jede eingrenzende Funktion gegenüber der nationalen Strafgewalt genommen würde.[226] Wie sich die (eine eher extensive nationale Strafgewalt befürwortende) Toeben-Entscheidung des Ersten Strafsenats und die jüngere (eher restriktive) Entscheidung des Dritten Strafsenats zur Verbreitung von Hakenkreuzen von Tschechien aus miteinander vereinbaren lassen sollen, ist nicht ersichtlich. In einer weiteren Entscheidung (zu einer Holocaust-Leugnung während einer Versammlung in der Schweiz vor unter anderem deutschen Zuhörern) hat sich hingegen der Dritte Strafsenat von der Toeben-Entscheidung deutlich distanziert und verneint, dass das Merkmal der Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens zum Tatbestand des § 130 Abs. 3 StGB gehöre.[227]