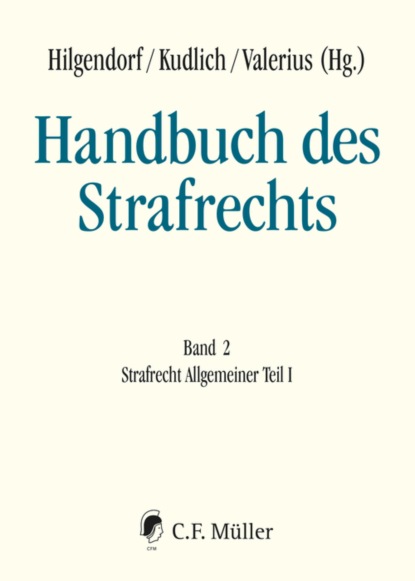- -
- 100%
- +
[288]
WK-Salimi, § 67 Rn. 38.
[289]
OGH JBl 1988, 659, 660; WK-Salimi, § 67 Rn. 39.
[290]
Donatsch/Donatsch, StGB, Art. 3 Rn. 7; Killias/Markwalder/Kuhn/Dongois, AT, Kap. 16 Rn. 1602.
[291]
Donatsch/Donatsch, StGB, Art. 3 Rn. 10; Killias/Markwalder/Kuhn/Dongois, AT, Kap. 16 Rn. 1602.
[292]
Das Weltrechtsprinzip wird darüber hinaus in einzelnen Bestimmungen des Besonderen Teils des StGB, z.B. bei der Geiselnahme (Art. 185 Z. 5 schwStGB) und der Geld- bzw. Wertzeichenfälschung (Art. 240 Abs. 3 bzw. Art. 245 Z. 1 Abs. 4 schwStGB), sowie im Nebenstrafrecht aufgegriffen; Donatsch/Donatsch, StGB, Art. 6 Rn. 1.
[293]
Donatsch/Donatsch, StGB, Art. 7 Rn. 1. Ein darüber hinaus gehender Rückgriff auf das passive Personalitätsprinzip in Art. 5 schwStGB a.F. wurde 2002 aufgegeben; Killias/Markwalder/Kuhn/Dongois, AT, Kap. 16 Rn. 1609.
[294]
Donatsch/Donatsch, StGB, Art. 7 Rn. 3.
[295]
Donatsch/Donatsch, StGB, Art. 8 Rn. 1; Killias/Markwalder/Kuhn/Dongois, AT, Kap. 16 Rn. 1604.
[296]
Donatsch/Donatsch, StGB, Art. 8 Rn. 1.
[297]
Donatsch/Donatsch, StGB, Art. 3 Rn. 11, Art. 8 Rn. 6.
[298]
BGE 85 IV 203, 203; Donatsch/Donatsch, StGB, Art. 8 Rn. 6.
[299]
BGE 104 IV 77, 86; Donatsch/Donatsch, StGB, Art. 3 Rn. 11, Art. 8 Rn. 5.
[300]
Zur Auslegung der öffentlichen Interessen im Sinne des § 153c Abs. 3 StPO Bock, GA 2010, 589, 591 ff.
[301]
LR-Beulke, § 153c Rn. 8; KK-StPO-Diemer, § 153c Rn. 1; MK-StPO-Peters, § 153c Rn. 30.
[302]
Ambos, Internationales Strafrecht, § 3 Rn. 100; LK-Werle/Jeßberger, Vor § 3 Rn. 357.
[303]
Siehe hierzu Ambos, Internationales Strafrecht, § 3 Rn. 100 ff.
[304]
Siehe auch BGH BeckRS 2015, 09405 Rn. 14 f., in NStZ 2015, 568 nicht abgedruckt.
8. Abschnitt: Unrechtsbegründung: Tatbestand
Inhaltsverzeichnis
§ 32 Geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale
§ 33 Kausalität und objektive Zurechnung
§ 34 Der subjektive Tatbestand
§ 35 Vorsatz
§ 36 Fahrlässigkeit
8. Abschnitt: Unrechtsbegründung: Tatbestand › § 32 Geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale
Rudolf Rengier
§ 32 Geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale
A.Einführung und Thematik1 – 4
B.Funktionen des objektiven Tatbestandes5, 6
C.Standorte der geschriebenen objektiven Tatbestandsmerkmale7 – 13
I.Straf- und Bußgeldtatbestände des Kern- und Nebenstrafrechts7 – 9
II.Allgemeiner Teil des Strafgesetzbuchs10 – 13
D.Inhalt des objektiven Tatbestandes14 – 22
E.Arten der Tatbestandsmerkmale23 – 48
I.Deskriptive und normative Tatbestandsmerkmale23 – 26
II.Zivilrechtsakzessorische Tatbestandsmerkmale27 – 32
III.Verwaltungsakzessorische Tatbestandsmerkmale33 – 41
1.Begriffliche Verwaltungsaktsakzessorietät33
2.Verwaltungsaktsakzessorietät34 – 41
IV.Normative Tatbestandsmerkmale und objektive Tatbestandsmerkmale in Blanketttatbeständen42 – 48
1.Straftatbestände42 – 46
2.Ordnungswidrigkeitenrecht47, 48
Ausgewählte Literatur
8. Abschnitt: Unrechtsbegründung: Tatbestand › § 32 Geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale › A. Einführung und Thematik
A. Einführung und Thematik
1
Dem Begriff des Tatbestandes kann man verschiedene Bedeutungen zuschreiben. Wie freilich die Gliederung dieses Bandes und die Überschrift erkennen lassen, ist hier mit dem „Tatbestand“ im Sinne des dreistufigen Verbrechensaufbaus die erste Stufe der Tatbestandsmäßigkeit mit dem objektiven und subjektiven Tatbestand gemeint. Der Tatbestandsstufe fällt die Funktion zu, die unrechtsbegründenden Merkmale zu beschreiben, die den typischen Unrechtsgehalt der Tat verkörpern. Dabei steht der objektive Tatbestand mit seinen in der Regel geschriebenen objektiven Tatbestandsmerkmalen, die das Thema des folgenden Beitrags bilden, im Verbrechensaufbau an der ersten Stelle.
2
Im Strafgesetzbuch wird der Begriff des Tatbestandes in den §§ 9 Abs. 1, 11 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, 13 Abs. 1, 16 Abs. 1 S. 1, 22, 78a S. 2 StGB im Sinne des objektiven Tatbestandes gebraucht. Entsprechendes gilt für die §§ 1 Abs. 1, Abs. 2, 7 Abs. 1, 8, 11 Abs. 1 S. 1, 13 Abs. 1, 14 Abs. 2, 31 Abs. 3 S. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.
3
Außerhalb des Themas liegen die ungeschriebenen objektiven Tatbestandsmerkmale, namentlich die Kausalität und objektive Zurechnung.[1] Fragen der Rechtswidrigkeit werden nur berührt, soweit zu diskutieren ist, ob bestimmte in einer Straf- oder Bußgeldvorschrift enthaltene Merkmale Tatbestands- oder Rechtfertigungscharakter haben. Ausgeklammert bleiben aber schwerpunktmäßig zur Rechtswidrigkeit gehörende Grundsatzfragen; gemeint sind etwa die Lehre von den Rechtfertigungsgründen als negativen Tatbestandsmerkmalen und die Diskussion, ob und inwieweit einzelne typischerweise als Rechtfertigungsgründe eingestufte Erlaubnissätze wie vor allem die Einwilligung bereits das tatbestandliche Unrecht ausschließen.[2]
4
Nach h.M. nicht zum objektiven Tatbestand gehören die selten gewordenen objektiven Bedingungen der Strafbarkeit, die man noch vor allem in den §§ 186, 231, 323a, 283 Abs. 6 StGB findet. Vom Eintritt solcher Bedingungen hängt zwar die Strafbarkeit ab, doch brauchen sich weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit auf sie zu erstrecken. Sieht man das im Lichte des Schuldprinzips anders, wertet man die objektiven Bedingungen zu objektiven Tatbestandsmerkmalen auf. Die damit zusammenhängenden Fragen werden hier indes nicht thematisiert.[3]
8. Abschnitt: Unrechtsbegründung: Tatbestand › § 32 Geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale › B. Funktionen des objektiven Tatbestandes
B. Funktionen des objektiven Tatbestandes
5
Die geschriebenen objektiven Tatbestandsmerkmale sind Bestandteile des objektiven Tatbestandes, der wiederum essentieller Teil des Unrechtstatbestandes, d.h. der Stufe der Tatbestandsmäßigkeit ist, die bei Vorsatzdelikten den Vorsatz als subjektives Tatbestandsmerkmal einschließt. Dem Unrechtstatbestand fällt die Aufgabe zu, alle Merkmale aufzunehmen, die den typischen Unrechtsgehalt der Straftat begründen.[4] Also ist jedes „Merkmal, das den Unrechtsgehalt der betreffenden Deliktart mitbestimmt, … Tatbestandsmerkmal, gleichgültig, wie weit dabei der Gesetzgeber den Verbotsgehalt gegenständlich näher umschrieben hat.“[5] Alle Merkmale, die nicht mehr die betreffende Deliktsart oder das typische Unrecht kennzeichnen, sind keine Tatbestandsmerkmale.[6]
6
Der Unrechtstatbestand wird auch als Systemtatbestand charakterisiert, weil er mit der Stufe der Tatbestandsmäßigkeit den objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmalen einen klaren systematischen Standort zuweist.[7] Soweit man die weitere Funktion des Unrechts- oder Systemtatbestandes als Garantietatbestand betont, wird im Lichte des Bestimmtheitsgrundsatzes (Art. 103 Abs. 2 GG) die herausragende Bedeutung des Unrechtstatbestandes hervorgehoben, der in besonderer Weise garantieren soll, dass der Gesetzgeber den Strafbarkeitsbereich möglichst exakt beschreibt, der Bürger vor unbestimmten Strafgesetzten geschützt wird und Strafbarkeitslücken nicht durch Analogien zu Lasten des Täters geschlossen werden.[8] Eine dritte Funktion speziell der objektiven Tatbestandsmerkmale des objektiven Unrechtstatbestandes liegt bei Vorsatzdelikten darin, die Umstände bzw. Merkmale zu umschreiben, deren Nichtkenntnis zu einem gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 StGB vorsatzausschließenden Tatbestandsirrtum führt; insoweit spricht man vom Irrtumstatbestand.[9]
8. Abschnitt: Unrechtsbegründung: Tatbestand › § 32 Geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale › C. Standorte der geschriebenen objektiven Tatbestandsmerkmale
I. Straf- und Bußgeldtatbestände des Kern- und Nebenstrafrechts
7
Bezogen auf das Kernstrafrecht sind die Straftatbestände im Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs der klassische Standort für die objektiven Tatbestandsmerkmale. Diese sind in der Regel leicht zu erkennen und typischerweise in den die Strafbarkeitsvoraussetzungen regelnden Konditionalsätzen enthalten, die nach dem Muster „Wer sich so oder so verhält“ in einem Halbsatz den objektiven Tatbestand mit seinen objektiven Tatbestandsmerkmalen umschreiben, bevor im nächsten Halbsatz die Rechtsfolge „wird … bestraft“ ausgesprochen wird.
8
Soweit der Gesetzgeber in umgekehrter Reihenfolge den Halbsatz mit der Rechtsfolge an den Anfang stellt (z.B. §§ 250, 261 Abs. 2, 263 Abs. 5, 264 Abs. 1, 266a Abs. 2 StGB), ändert sich an dem Inhalt der mit „wer …“ beginnenden Beschreibung des tatbestandsmäßigen Verhaltens nichts.
9
Diese Muster wiederholen sich in den Straf- und Bußgeldtatbeständen des Nebenstrafrechts.
II. Allgemeiner Teil des Strafgesetzbuchs
10
Weniger im Bewusstsein verankert ist, dass auch im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale verortet sind. Dies betrifft
– die rechtliche Einstandspflicht beim unechten Unterlassungsdelikt, die sog. Garantenstellung (§ 13 Abs. 1 StGB); – die Begehung durch einen anderen, d.h. die mittelbare Täterschaft (§ 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB); – die in § 25 Abs. 2 StGB geregelte gemeinschaftliche Begehung als Mittäter; – die Anstiftung und Beihilfe (§§ 26, 27 StGB); – die Erweiterung des Täterkreises bei Sonderdelikten durch § 14 StGB bzw. § 9 OWiG.11
Innerhalb der Beteiligungsnormen lässt die Regelung der §§ 26, 27 StGB den Unrechtstatbestand besonders deutlich hervortreten: Der objektive Tatbestand mit den objektiven Tatbestandsmerkmalen setzt sich aus der vorsätzlichen rechtswidrigen (Haupt-)Tat und der Teilnahmehandlung zusammen. Auf diesen (zugleich) Irrtumstatbestand muss sich der Vorsatz erstrecken. Bei der mittelbaren Täterschaft ist die Tatbestandsverwirklichung durch tatbeherrschende Steuerung des Tatnächsten (Begehung „durch einen anderen“) objektives Tatbestandsmerkmal, auf das sich auch der Vorsatz zu beziehen hat. Bei der Mittäterschaft liegt das zentrale objektive Tatbestandselement der gemeinschaftlichen Begehung in der – vom Vorsatz umfassten – gemeinsamen Tatausführung, die ihrerseits auf einem gemeinsamen Tatentschluss fußt.[10]
12
§ 14 hat die Funktion, bei Sonderdelikten mit die Strafbarkeit begründenden persönlichen Statusmerkmalen die Eigenschaft des Normadressaten auf bestimmte unmittelbar handelnde Vertreter überzuwälzen, die selbst das besondere persönliche Merkmal nicht aufweisen und daher nicht zum Kreis der tauglichen Täter gehören. Im Zusammenspiel mit dem einschlägigen Straftatbestand ersetzt § 14 StGB den Arbeitgeber, Betriebsinhaber usw. als tauglichen Täter durch einen Vertreter, der diese Täterqualität gerade nicht aufweist, und schafft auf diese Weise eine neue Verhaltensnorm mit einem neuen objektiven Tatbestandsmerkmal und neuen objektiven Tatbestand.
13
Hält man sich noch einmal vor Augen, dass die erwähnten §§ 13 Abs. 1, 14, 25 Abs. 1 Alt. 2, 25 Abs. 2, 26, 27 StGB objektive Tatbestandsmerkmale enthalten, so sollte es keine Zweifel geben, dass die Vorschriften auch zum Garantietatbestand[11] gehören. Von daher werden diejenigen Stimmen bestätigt, die von einer Geltung des Art. 103 Abs. 2 GG auch im Allgemeinen Teil ausgehen. Auf einem anderen Blatt steht und nicht zu diskutieren ist, ob die zum Teil knappen Vorschriften wegen ihrer Kürze oder aus anderen Gründen den Anforderungen des Art. 103 Abs. 2 GG genügen.[12]
8. Abschnitt: Unrechtsbegründung: Tatbestand › § 32 Geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale › D. Inhalt des objektiven Tatbestandes
D. Inhalt des objektiven Tatbestandes
14
Zum zwingenden Gerüst eines jeden objektiven Tatbestandes gehören als objektive Tatbestandsmerkmale das Tatsubjekt und die Tathandlung.
15
Die Beschreibung des Tatsubjekts legt fest, wer tauglicher Täter sein kann. Bei Delikten, die jedermann begehen kann und Allgemeindelikte heißen, kennzeichnet das Gesetz den Täterkreis in der Regel mit dem unbestimmten „Wer …“. Bei Sonderdelikten kommen als taugliche Täter nur Personen mit einer bestimmten Subjektsqualität in Betracht. Diese Delikte sind leicht zu erkennen, wenn das Gesetz das Tatsubjekt durch individualisierende Berufs- und statusbezogene Bezeichnungen charakterisiert, etwa als Zeuge oder Sachverständiger (§ 153 StGB), Arzt, Zahnarzt usw. (§ 203 Abs. 1 StGB), Angestellter oder Beauftragter eines geschäftlichen Betriebes (§ 299 Abs. 1 StGB), Amtsträger (§§ 331 f., 339 ff. StGB), Arbeitgeber (§ 266a Abs. 1 StGB), Anwalt oder Rechtsbeistand (§ 356 StGB), Vorgesetzter (§ 357 StGB), Gesellschafter und Geschäftsführer (§ 82 GmbHG), Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens (§ 130 Abs. 1 OWiG).
16
Schwieriger als Sonderdelikte zu klassifizieren sind Tatbestände, bei denen das allgemeine „Wer …“ nicht durch ein berufs- oder statusbezogenes Substantiv ersetzt wird, sondern sich die Einschränkung des Täterkreises erst aus anderen Tatbestandsmerkmalen ergibt. So ist der Täterkreis bei § 266 Abs. 1 auf Personen begrenzt, denen die untreuespezifische Vermögensbetreuungspflicht obliegt, bei § 283 StGB auf den Schuldner,[13] bei § 315c Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2a bis f StGB auf den Fahrzeugführer[14] und bei den „Betreiberdelikten“ des Umweltstrafrechts (§§ 325 Abs. 1, Abs. 2, 325a, 327 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, 328 Abs. 3 Nr. 1 StGB) unter Umständen auf den Anlagenbetreiber[15].
17
Sonderdelikte stellen auch die unechten Unterlassungsdelikte dar; hier ergibt sich die Täterbegrenzung aus § 13 StGB.[16] Bei von § 14 StGB erfassten Sonderdelikten ist weiter auf die Erweiterung des Täterkreises durch § 14 StGB zu achten.[17]
18
Die Tathandlung als objektives Tatbestandsmerkmal umschreibt das Verhalten, das die Verwirklichung eines objektiven Tatbestandes notwendigerweise voraussetzt. Dieses Verhalten kann in einer Tätigkeit oder Untätigkeit liegen. Im Regelfall besteht es in einem aktiven Tun und wird dementsprechend auch in den Straftatbeständen in der Form von Begehungsdelikten formuliert. Das umschriebene tatbestandsmäßige Verhalten kann aber auch in einem Unterlassen liegen. Verhältnismäßig selten wird ein derartiges Unterlassen ausdrücklich in den Tatbeständen geregelt. Soweit dies der Fall ist, spricht man von echten Unterlassungsdelikten, die im Kernstrafrecht selten (§§ 123 Abs. 1 Alt. 2, 138, 283 Abs. 1 Nr. 5, 7b, 323c I StGB), im Ordnungswidrigkeitenrecht dagegen erheblich häufiger vorkommen.[18]
19
§ 13 StGB wandelt die als Begehungsdelikte formulierten Straftatbestände „Wer … tötet, körperlich misshandelt, wegnimmt, beschädigt, in Brand setzt usw.“ in (unechte) Unterlassungsdelikte um und sanktioniert die Passivität von Garanten, die trotz Handlungsmöglichkeit den Eintritt des Erfolges der Tathandlung (Tod, körperliche Misshandlung usw.) nicht verhindern.
20
Vor dem Hintergrund der Garantiefunktion und befürchteter Strafbarkeitslücken stößt man teilweise auf – meist jüngere – Straftatbestände, die eine Fülle von, sich teilweise überschneidender Tathandlungen aufzählen. Beispielhaft seien § 303a Abs. 1 StGB mit den Tathandlungen „löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert“ sowie § 326 Abs. 1 genannt, der mit „sammelt, befördert, behandelt, verwertet, lagert, ablagert, ablässt, beseitigt, handelt, makelt oder sonst bewirtschaftet“ besonders viele Verhaltensweisen auflistet.
21
Aus Tatsubjekt und Tathandlung allein lässt sich aber kein ausreichender Unrechtstatbestand bilden. Der objektive Tatbestand bedarf daher weiterer Tatbestandsmerkmale. Insoweit typisch ist die Ergänzung um ein Tatobjekt. Das Tatobjekt kann beispielsweise allgemein ein Mensch, aber auch eine detaillierter beschriebene Person sein (Kind, eigenes Kind, Schutzbefohlener, Altersangabe, Angehöriger, nahe stehende Person, Verbraucher, Gefangener, Opfer). Als Tatobjekt kommt ferner allgemein eine Sache oder ein bestimmter körperlicher Gegenstand in Betracht (Urkunde, Gebäude, Kraftfahrzeug, Handelsbücher). Attribute etwa zu den Eigentumsverhältnissen, zum Wert, zur Herkunft oder zu Eigenschaften können hinzutreten. Gesamtheiten wie das Vermögen können ebenfalls Tatgegenstand sein. Im Computerzeitalter gehören selbstverständlich auch Daten, die Datenverarbeitung, Datenverarbeitungsanlagen und Computerprogramme zu den erfassten Tatobjekten (vgl. §§ 202a ff., 263a, 303a, 303b StGB).
22
Das aus Tatsubjekt, Tatobjekt und Tathandlung bestehende typische Gerüst oder auch nur die Elemente Tatsubjekt und Tathandlung werden durch eine bunte Vielfalt weiterer Tatbestandsmerkmale ergänzt, um den Unrechtstypus zu beschreiben. Oft werden besondere Begehungsweisen hervorgehoben wie die Anwendung von Gewalt oder Drohung, die Ausnutzung bestimmter Zwangslagen oder Schwächesituationen sowie heimtückisches, grausames oder hinterlistiges Agieren. Eine erhebliche Rolle spielt auch die Verwendung bestimmter gegenständlicher Tatmittel (Gift, gesundheitsschädliche Stoffe, Waffe, gefährliche Werkzeuge). Den Höhepunkt an Vielgestaltigkeit findet man in scheinbar knappen Tatbeständen wie § 106 UrhG, die mehr oder weniger das gesamte außerstrafrechtliche Rechtsgebiet, im Falle des § 106 UrhG das Urheberrecht, aufnehmen.
8. Abschnitt: Unrechtsbegründung: Tatbestand › § 32 Geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale › E. Arten der Tatbestandsmerkmale
I. Deskriptive und normative Tatbestandsmerkmale
23
Üblicherweise unterscheidet man zwischen deskriptiven und normativen objektiven Tatbestandsmerkmalen. Die Differenzierung ist für die Einstufung als objektives Tatbestandsmerkmal ohne Bedeutung, trägt aber zumindest dazu bei, die Reichweite von vorsatzausschließenden Irrtümern und damit des Irrtumstatbestandes besser zu erfassen.[19]
24
Deskriptive Tatbestandsmerkmale sind dem Grundgedanken nach solche, die als Phänomen des realen Seins einer Tatsachenfeststellung zugänglich sind und sich insoweit durch Beschreibung und ohne Wertung erfassen lassen. Beispielhaft können das Alter einer Person sowie die Merkmale „Mensch“, „Kraftfahrzeug“, „Sache“, „Töten“ und „Wegnehmen“ genannt werden.
25
Normative Tatbestandsmerkmale bedürfen demgegenüber stets einer ergänzenden juristischen Wertung. Sie sind „wertausfüllungsbedürftig“ und nicht oder nur eingeschränkt real erfassbar. Typische Beispiele stellen die Merkmale „Beleidigung“, „fremd“, „Urkunde“ und „bedeutender Wert“ dar.[20]
26
Die Grenzen zwischen deskriptiven und normativen Merkmalen sind teilweise fließend. Auch bei deskriptiven Merkmalen kann sich außerhalb ihres mehr oder weniger eindeutigen Kerns die Notwendigkeit einer ergänzenden wertenden Betrachtung ergeben. Man denke etwa an den Beginn des Menschseins[21] oder die Frage, ob Tiere zu den Sachen gehören.[22] Vor diesem Hintergrund gibt es auch Stimmen, welche die Differenzierung ablehnen.[23]
II. Zivilrechtsakzessorische Tatbestandsmerkmale
27
Ein klassisches, streng am Zivilrecht orientiertes objektives Tatbestandsmerkmal stellt das Merkmal „fremd“ dar (z.B. in §§ 242, 246, 249, 303 StGB). Ebenfalls stark vom Zivilrecht geprägt ist die Auslegung des Begriffs der Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung (§§ 242, 249 StGB). Es handelt sich keineswegs um ein allgemeines Verbrechensmerkmal,[24] vielmehr um ein objektives Tatbestandsmerkmal. Die Rechtswidrigkeit der beabsichtigen Zueignung entfällt, wenn der Täter zivilrechtlich einen fälligen und einredefreien Anspruch auf Übereignung der weggenommenen Sache hat; daran ändert die Anwendung von selbst schwerer Gewalt oder von Drohungen mit Lebensgefahr nichts.[25] Über diese Interpretation lässt sich durchaus diskutieren. Sie ist aber schlüssig, wenn man sich den Gedanken vom objektiven Tatbestand als Unrechtstypus in Erinnerung ruft:[26] Wer als Eigentümer zur Übereignung an den Täter verpflichtet ist, hat nur eine rein formale Rechtsposition inne, bezüglich der kein Anlass besteht, sie durch das Eigentumsdelikt zu schützen.[27]
28
Noch deutlicher werden diese Zusammenhänge mit Blick auf die §§ 263, 253 StGB, bei denen die Absicht, sich „rechtswidrig“ bzw. „zu Unrecht“ zu bereichern, ebenfalls als objektives Tatbestandsmerkmal eingeordnet wird und entfällt, wenn der Täter einen fälligen und einredefreien Anspruch mittels Täuschung bzw. (qualifizierten) Nötigungsmitteln durchsetzt.[28] Denn auf der Basis des juristisch-ökonomischen Vermögensbegriffs muss man in solchen Konstellationen konsequenter Weise bereits den Vermögensschaden verneinen.[29] Diese Verknüpfung mit dem Merkmal des Vermögensschadens veranschaulicht zumindest die Zugehörigkeit des Rechtswidrigkeitselements der erstrebten Bereicherung zum objektiven Deliktstatbestand.
29
Besondere Fragen der Zivilrechtsakzessorietät wirft der Untreuetatbestand auf (§ 266 StGB). Das für die Täterqualität wie für die Tathandlung „zentrale Merkmal der Verletzung einer Pflicht zur Wahrnehmung und Betreuung fremder Vermögensinteressen bzw. des Missbrauchs rechtlicher Befugnisse ist nicht nur für sich genommen weit, sondern knüpft zusätzlich an außerstrafrechtliche Normkomplexe und Wertungen an, die das Verhältnis zwischen dem Vermögensinhaber und dem Vermögensverwalter im Einzelnen gestalten und so erst den Inhalt der – strafbewehrten – Pflicht und die Maßstäbe für deren Verletzung festlegen“.[30] Die Reichweite des Tatbestandes ist damit „in hohem Maße akzessorisch zu außerstrafrechtlichen Normen“.[31] Für sich betrachtet ist dies nichts Ungewöhnliches. Probleme mit dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG ergeben sich aber, wenn die Akzessorietät auf Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe verweist, die das gebotene Verhalten von treuepflichtigem Führungspersonal in einer sehr auslegungsbedürftigen Weise umschreiben. Paradebeispiele stellen die gesellschaftsrechtlichen Normen zum einen des § 87 Abs. 1 S. 1 AktG (der die Bezüge der Vorstandsmitglieder an die „Angemessenheit“ der Vergütung bindet) sowie zum anderen der §§ 93 Abs. 1 S. 1 AktG, 43 Abs. 1 GmbHG dar, die den „ordentlichen und gewissenhaften“ Geschäftsleiter als Maßstabsfigur hervorheben. So gewinnt auch das BVerfG die Erkenntnis, dass es sich bei dem Pflichtwidrigkeitsmerkmal um ein „komplexes normatives Tatbestandsmerkmal“ handelt, bei dem sich dem Normanwender zunächst die Frage stellt, „welche außerstrafrechtlichen Bestimmungen zur Beurteilung der Pflichtwidrigkeit heranzuziehen sind. Sodann stellt sich die Frage nach der Auslegung der relevanten Normen, unter denen sich Vorschriften von erheblicher Unbestimmtheit oder generalklauselartigen Charakters befinden können, da sich dem Normtext des § 266 Abs. 1 StGB Anforderungen an die Bestimmtheit der in Bezug genommenen Normen nicht entnehmen lassen“.[32] Das Unbestimmtheitspotential vergrößert sich durch eine sich an § 263 StGB anlehnende Interpretation des objektiven Tatbestandsmerkmals (Vermögens-)Nachteil, eine Interpretation, die konkrete Vermögensgefährdungen einbezieht, die neuerdings präziser als Gefährdungsschäden bezeichnet werden.[33]