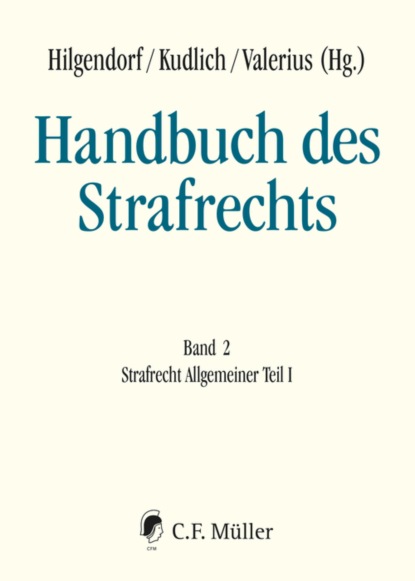- -
- 100%
- +
30
Eine übliche Reaktion auf Bestimmtheitsprobleme mit vom Gesetzgeber gewählten objektiven Tatbestandsmerkmalen ist die Forderung nach restriktiver Auslegung, die auch das BVerfG anmahnt.[34] Im angesprochenen Bereich der Untreue geht es insoweit insbesondere um zwei Kriterien: Erstens wird bei zivilrechtsakzessorischen Pflichtverletzungen das Erfordernis einer „gravierenden“ oder „evidenten“ Pflichtverletzung diskutiert.[35] Zweitens leitet der BGH aus dem Schutzzweck des § 266 StGB ab, dass nur solche (auch strafbewehrte) Verstöße gegen die Rechtsordnung untreuerelevant sind, die zumindest mittelbar auch das zu betreuende Vermögen schützen.[36]
31
Weiter hat Saliger auf ein Strukturproblem der Untreue aufmerksam gemacht, das vor allem mit dem herausragenden Stellenwert und dem Verständnis der Tatbestandsmerkmale Tathandlung (Pflichtverletzung) und Taterfolg (Vermögensnachteil) zusammenhängt. Es ist die Gefahr der Verschleifung bzw. Verschmelzung von Tathandlung und Taterfolg. Diese Verschleifung tritt auf als Rückschluss vom Taterfolg auf die Tathandlung und umgekehrt als Schluss von der Tathandlung auf den Taterfolg.[37] Diesen Gedanken hat auch das BVerfG aufgegriffen und das Verschleifungsverbot dem Schutzbereich des Art. 103 Abs. 2 GG mit der Begründung unterstellt, beim Nachteilsmerkmal müsse „die Auslegung den gesetzgeberischen Willen beachten, dieses Merkmal als selbstständiges neben dem der Pflichtverletzung zu statuieren; sie darf daher dieses Tatbestandsmerkmal nicht mit dem Pflichtwidrigkeitsmerkmal verschleifen, d.h., es in diesem Merkmal aufgehen lassen“.[38]
32
Bedeutung wie Trag- und Reichweite des Verschleifungsverbotes sind freilich ungeklärt und umstritten. Dies verdeutlicht der Telekom-Fall BGH NJW 2013, 401: Nachdem Geschäftsgeheimnisse der T-AG in der Presse erschienen sind, beauftragt der für die Konzernsicherheit zuständige leitende Angestellte K die N-GmbH mit im Lichte des § 206 Abs. 1 StGB strafbaren Ermittlungstätigkeiten. Nach der Durchführung des Auftrags veranlasst K die Bezahlung auch dieser von der N-GmbH in Rechnung gestellten Tätigkeiten. Der BGH begründet den Schaden damit, dass der Vertrag nichtig ist (§ 134 BGB) und die rechtsgrundlos geleistete Zahlung nicht durch das Erlöschen einer wirksamen Forderung kompensiert wird.[39] Was die Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht betrifft, knüpft der BGH nicht an die Norm des § 206 StGB an, weil diese keinen vermögensschützenden Charakter hat. Damit muss eine Strafbarkeit wegen Untreue aber nicht ausscheiden, wenn sich die Verletzung von anderen Pflichten feststellen lässt, die das Vermögen des Treugebers schützen sollen. Eine solche Pflichtverletzung sieht der BGH in der Begleichung einer nichtigen Forderung.[40] Insoweit wird angeknüpft an Pflichten, die sich unmittelbar aus dem Treueverhältnis ergeben.[41] Saliger widerspricht dem vehement und sieht ein „grandioses Missverständnis“.[42] Demgegenüber wird eingewandt, wenn man die Pflichtverletzung in der Anweisung der Zahlung ohne Rechtspflicht und den Vermögensnachteil in der kompensationslosen Minderung des Kontostandes sehe, würden beide Merkmale eigenständig begründet.[43]
1. Begriffliche Verwaltungsaktsakzessorietät
33
Von begrifflicher Verwaltungsakzessorietät spricht man, wenn Straftatbestände – vergleichbar mit den streng am Zivilrecht orientierten objektiven Tatbestandsmerkmalen[44] – Begriffe des Verwaltungsrechts übernehmen. Die charakteristischen Beispiele finden sich im Umweltstrafrecht. So sind die in § 330d Abs. 1 Nr. 1 bis 3 enthaltenen Legaldefinitionen des „Gewässers“, der „kerntechnischen Anlage“ und des „gefährlichen Gutes“ zumindest eng an die verwaltungsrechtlichen Regelwerke angelehnt.[45] Entsprechendes gilt für den Abfallbegriff des § 326 StGB, dessen Verständnis von § 3 KrWG geprägt wird. Abweichungen können sich aus den unterschiedlichen Schutzrichtungen von Straf- und Verwaltungsrecht ergeben. So gelten die Anwendungsbeschränkungen des § 2 Abs. 2 KrWG, die hauptsächlich vor dem Hintergrund öffentlichrechtlicher Spezialgesetze zu sehen sind, für § 326 StGB grundsätzlich nicht.[46]
2. Verwaltungsaktsakzessorietät
34
Bei der Verwaltungsaktsakzessorietät ist die Reichweite des Straftatbestandes von Einzelfallentscheidungen der Verwaltungsbehörden abhängig. Diese Akzessorietätsform ist im Gesetzeswortlaut besonders leicht zu erkennen, wenn die Strafbarkeit – wie mehrfach innerhalb des § 327 StGB – an ein Handeln „ohne Genehmigung“ oder „entgegen einer vollziehbaren Untersagung“ anknüpft (vgl. weiter etwa §§ 326 Abs. 1 Nr. 2, 328 Abs. 1, 329 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, Abs. 3 StGB). Entsprechendes gilt für die zahlreichen Umweltstraftatbestände, die das objektive Tatbestandsmerkmal „unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten“ enthalten (§§ 324a, 325, 325a, 326 Abs. 3, 328 Abs. 3, 329 Abs. 4 StGB), weil über dieses Merkmal ausweislich der Legaldefinition Rechtsvorschriften, die Genehmigungsvorbehalte aufstellen, sowie vollziehbare Verwaltungsakte und vollziehbare Auflagen einbezogen sind (§ 330d Abs. 1 Nr. 4a, c, d StGB).
35
Außerhalb des Umweltstrafrechts findet man im Strafgesetzbuch kaum weitere Beispiele für verwaltungsaktsakzessorische Straftatbestände. Anders sieht dies im Nebenstrafrecht aus; beispielhaft seien die folgenden Strafvorschriften genannt: §§ 17 Abs. 1, 18 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 AWG; §§ 54 Abs. 1 Nr. 2, 54a Abs. 3 KWG; § 58 Abs. 1 Nr. 17, 18 LFGB; § 52 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2-4 WaffG. Desgleichen findet man im Ordnungswidrigkeitenrecht viele verwaltungsaktsakzessorische Bußgeldtatbestände. Erwähnt seien nur § 81 Abs. 2 Nr. 2 GWB, § 61 Abs. 1 Nr. 1, 4 PBefG sowie die Verkehrszeichen.[47]
36
Die Abhängigkeit strafrechtlicher Sanktionen von Verwaltungsakten wirft Grundsatzfragen auf, die hier nicht näher zu diskutieren sind, aber immerhin angesprochen werden sollen. So stellt sich die Frage, ob in solchen Fällen gerade der Gesetzgeber die Strafbarkeit im Sinne des Art. 103 Abs. 2 GG in ausreichender Weise bestimmt. Im Ergebnis akzeptiert man weitgehend diese Gesetzgebungstechnik, soweit der Gesetzgeber die Voraussetzungen für den Erlass von konkretisierenden Verwaltungsakten durch ein förmliches Gesetz hinreichend bestimmt geregelt hat.[48] Bedenken knüpfen vor allem an etwaige verwaltungsrechtlich eingeräumte Ermessens- und Beurteilungsspielräume und unterschiedliche Entscheidungspraktiken der jeweils vor Ort zuständigen Umweltverwaltungsbehörden an.[49]
37
Zum Teil umstritten ist, inwieweit auch Verstöße gegen fehlerhafte belastende Verwaltungsakte zu sanktionieren sind. Nach h.M. können auch Verstöße gegen sofort vollziehbare Verwaltungsakte (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO) unabhängig von der materiellen Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts und dem späteren Ausgang ergriffener Rechtsbehelfe bestraft werden.[50] Diese Ansicht verdient keine Zustimmung, weil sie auf eine Ahndung von bloßem Verwaltungsungehorsam hinausläuft.[51] Die Ansicht der h.M. widerspricht auch gewissen Tendenzen in der Rechtsprechung des BVerfG.[52]
38
Ferner stellt sich noch die Frage, inwieweit die erwähnten Einzelfallentscheidungen ausschließlich objektive Tatbestandsmerkmale darstellen oder auch Rechtfertigungsmerkmale sein können. Ausgangspunkt ist die Funktion des objektiven Tatbestandes als Unrechtstatbestand, alle Merkmale aufzunehmen, die den typischen Unrechtsgehalt der Straftat begründen.[53] Was das Merkmal „unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten“ betrifft, so wird es einvernehmlich, dem Willen des Gesetzgebers entsprechend, als objektives Tatbestandsmerkmal eingeordnet.[54] Dem ist nicht zu widersprechen. Immerhin sollte man sich die damit verbundenen Aussagen verdeutlichen. Mit Blick auf die drei Umweltmedien Wasser, Boden und Luft fällt ja auf, dass der Gesetzgeber Boden und Luft nicht in gleicher Weise wie Gewässer schützt, etwa in der Art: „Wer unbefugt ein Gewässer, den Boden oder die Luft verunreinigt, wird … bestraft.“ Vielmehr zeigen die zahlreichen, auch durch das Merkmal „unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten“ bedingten, Einschränkungen in den Tatbeständen der §§ 324a, 325 StGB, dass der Gesetzgeber das tatbestandsmäßige Unrecht der Boden- und Luftverunreinigung nicht schon allein in der Verunreinigung sieht, sondern weitere Unrechtsmerkmale für erforderlich erachtet. Diese Linie entspricht der historischen Tradition, wonach der Gewässerschutz eher absoluten Charakter hat, während Boden und Luft eher als frei verfügbar gelten. Indes hat sich unser Wissen über die ökologischen Funktionen von Boden und Luft, vom Gesetzgeber nicht unbemerkt, geändert. Ob und wann die Zeit für eine parallele Ausgestaltung der Tatbestände der Gewässer-, Boden- und Luftverunreinigung kommt, ist ungewiss.
39
Soweit die Sanktionierung abhängig ist von erlassenen Verwaltungsakten (vollziehbare Auflagen, vollziehbare Untersagungen), versteht es sich von selbst, dass der Unrechtstypus durch den Verstoß gegen die behördliche Anordnung geprägt wird.[55]
40
Schwierigkeiten bereitet die Abgrenzung zwischen Tatbestands- und Rechtfertigungselementen bei dem Merkmal „ohne Genehmigung“ bzw. „ohne Erlaubnis“: Es stellt sich die Frage, ob und wann es sich um ein negatives Tatbestandsmerkmal oder einen (fehlenden) Rechtfertigungsgrund handelt. Die gleiche Frage stellt sich bei Tatbeständen wie den §§ 324, 326 StGB, die ein „unbefugtes“ Handeln voraussetzen, das im Falle einer behördlichen Genehmigung/Erlaubnis ausgeschlossen ist. Diesbezüglich setzt sich zunehmend auch in der Rechtsprechung die Ansicht durch, die auf den Sinn und Zweck des Genehmigungsvorbehalts abstellt und daran anknüpft, ob es sich um ein präventives oder ein repressives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt handelt. Die Erlaubnis ist Tatbestandsmerkmal, wenn das Verhalten von der allgemeinen Handlungsfreiheit – da sozialadäquat, wertneutral oder nicht unerwünscht – an sich gedeckt wird und die Erlaubnis nur den Zweck hat, eine Kontrolle über potentielle Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu ermöglichen (präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt). In diesen Fällen bezieht der Tatbestand seinen Unwertgehalt zumindest auch aus dem Handeln ohne Genehmigung. Demgegenüber stellt die behördliche Erlaubnis einen Rechtfertigungsgrund dar, wenn der Tatbestand unabhängig vom Genehmigungsmerkmal einen ausreichenden Unrechtssachverhalt umschreibt, im Einzelfall aber das Verbot aufgrund einer Interessenabwägung aufgehoben werden kann (repressives Verbot mit Befreiungsvorbehalt).[56] Danach hat die Genehmigung in den §§ 324, 326 StGB rechtfertigenden Charakter, während sie in § 327 StGB und in den Umweltstraftatbeständen mit dem Merkmal der Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten den Tatbestand ausschließt. Die Genehmigungsvorbehalte bei Bankgeschäften (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 KWG),[57] im Bereich der Personenbeförderung (§ 61 Abs. 1 Nr. 1 PBefG) und grundsätzlich auch im Außenwirtschaftsrecht[58] haben Tatbestandscharakter. Soweit allerdings im Außenwirtschaftsrecht Verbote mit wirtschaftlichem Sanktionscharakter bestehen, haben Genehmigungsvorbehalte (§§ 17 Abs. 1, 18 Abs. 1 Nr. 2 AWG) rechtfertigende Wirkung.[59] Zumindest teilweise in Grenzbereiche gelangt man bei den Erlaubnisvorbehalten des Waffengesetzes (§ 52 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2-4 WaffG).[60]
41
Bei dem in zahlreichen gesetzlichen Straftatbeständen enthaltenen und schon angesprochenen Merkmal „unbefugt“ kann es sich wie in den §§ 324 Abs. 1, 326 Abs. 1 StGB um ein allgemeines Rechtswidrigkeitsmerkmal handeln. Das Merkmal kann aber auch ein objektives Tatbestandsmerkmal sein, wenn der Tatbestand ohne dieses Merkmal kein ausreichendes Unrecht verkörpert. Dies hängt von der Auslegung des jeweiligen Straftatbestandes ab. Als Tatbestandsmerkmal wird das „unbefugt“ in § 263a Abs. 1 3. und 4. Var. sowie in § 303 Abs. 2 StGB angesehen.[61]
1. Straftatbestände
42
Die Überschrift führt zu Abgrenzungsfragen zwischen normativen Tatbestandsmerkmalen und Verbots- bzw. Blankettmerkmalen und zu der Diskussion, inwieweit bei Blanketttatbeständen auch der Verweis auf die Ausfüllungsnorm und damit die Existenz des Verbots bzw. Gebots zu den objektiven Tatbestandsmerkmalen zählen. Die Auseinandersetzung ist deshalb so intensiv, weil sie mit Irrtumsfragen und der Abgrenzung zwischen Tatbestands- und Verbotsirrtum verknüpft ist. Irrtumsprobleme sind in diesem Abschnitt nicht zu erörtern, aber es ist nicht zu übersehen, dass die vorrangige Frage nach dem Tatbestandscharakter Einfluss auf die Irrtumsdiskussion hat. Allerdings wird auch diese Aussage in Frage gestellt. So ordnet Cornelius in seiner Schrift zur verweisungsbedingten Akzessorietät bei Straftatbeständen die Verweisungsmerkmale als Tatbestandsmerkmale ein, lässt aber offen, ob dies auch für den Irrtumsbereich Gültigkeit hat.[62]
43
Als klassische normative Tatbestandsmerkmale gelten die Merkmale „fremd“ und „rechtswidrig“ der §§ 242, 246, 249 StGB, Tatbestandsmerkmale, die durch die Zivilrechtsordnung „ausgefüllt“ werden. Von daher läge es durchaus nahe, auch bei weiteren Strafvorschriften, die auf Zuwiderhandlungen gegen andere Gesetze verweisen, von einem normativen Tatbestandsmerkmal auszugehen.[63] Wenden wir uns unter diesem Blickwinkel der Auslegung einer konkreten Vorschrift zu und greifen § 283 Abs. 1 Nr. 7b StGB (übereinstimmend § 283b Abs. 1 Nr. 3b StGB) auf. Nach einer ersten Ansicht spricht für die Einstufung der Elemente „entgegen dem Handelsrecht“ und „in der vorgeschriebenen Zeit“ als Tatbestandsmerkmale schon die Aufnahme in den gesetzlichen Straftatbestand, auch wenn die Merkmale durch die handelsrechtlichen Normen noch weiter ausgefüllt werden müssen.[64] Demgegenüber „eliminiert“[65] die oft noch als h.M. bezeichnete Ansicht diese Elemente, indem sie in ihnen Blankettmerkmale sieht, die im Wege des so genannten „Zusammenlesens“ durch die Normen des Handelsrechts ausgefüllt – genauer: ersetzt – werden, so dass sich etwa folgender Straftatbestand ergibt (vgl. § 264 HGB): „Wer … es unterlässt, die Bilanz seines Vermögens … innerhalb der ersten sechs Monate des (folgenden) Geschäftsjahres aufzustellen.“[66] In der Literatur ist inzwischen eine dritte Ansicht sehr verbreitet, die aus der Irrtumsperspektive die Abgrenzung zwischen Blankett- und normativen Tatbestandsmerkmalen für zweitrangig hält, sondern für entscheidend erachtet, was den Unrechtstyp und den sozialen Bedeutungsgehalt des Tatbestandes ausmacht, und darin den maßgeblichen Bezugspunkt für den Vorsatz sieht. Im Lichte dieser Lehrmeinung wird sich oft zeigen, dass bloßes Tatsachenwissen nicht ausreicht, um vorsätzliches Handeln bejahen zu können, hierfür vielmehr auch das Wissen um das Verbot bzw. Gebot erforderlich ist.[67] Namentlich Tiedemann[68] und Roxin[69] sehen insoweit in der Existenz der ausfüllenden Norm ein normatives Tatbestandsmerkmal, eine Auffassung, die nach der Einschätzung von Roxin[70] „in neueren Arbeiten immer mehr Anhänger gefunden (hat) und … sich wahrscheinlich allgemein durchsetzen“ wird. Im Ganzen zeigt sich, dass die dritte Ansicht zumindest sehr nahe bei der ersten Ansicht liegt. Gleichermaßen nahe liegt es dann doch, den Gesetzgeber beim Wort zu nehmen und jedenfalls und auch dann, wenn er in den Verweisungstatbestand das Ver- oder Gebot ansprechende Merkmale wie „entgegen“ oder „zuwiderhandelt“ aufnimmt, darin konsequent normative Tatbestandsmerkmale zu sehen, die das Ver- bzw. Gebot zu einem Tatbestandsmerkmal machen.
44
Daran anknüpfend wird man weiter sagen können, dass immer dann, wenn der Straftatbestand auf rechtliche Verhältnisse Bezug nimmt, das Rechtsverhältnis und insoweit der Rechtsverstoß normative Tatbestandsmerkmale sind.[71] Daher dürfen in § 292 Abs. 1 Nr. 2 StGB die Merkmale „unter Verletzung fremden Jagdrechts“ und „Sache, die dem Jagdrecht unterliegt“ nicht im Sinne des Zusammenlesens zu einem Straftatbestand der Art: „Wer auf einem fremden Grundstück eine Abwurfstange findet und sich zueignet, wird … bestraft“ (vgl. § 1 Abs. 1, 5; § 3 Abs. 1 BJagdG) umgeformt werden. Entsprechendes gilt für die in § 289 StGB aufgeführten Rechte. In diesem Zusammenhang ferner bemerkenswert ist § 3a Abs. 4 S. 2 Nr. 1 UStG, der als steuerrechtlich und daher auch steuerstrafrechtlich (§ 370 Abs. 1 AO) relevante „sonstige Leistungen“ die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von „Patenten, Urheberrechten, Markenrechten und ähnlichen Rechten“ einstuft. Der BGH spricht insoweit von normativen Tatbestandsmerkmalen.[72] Von diesem Blickwinkel aus lässt sich § 106 UrhG wie folgt lesen: „Wer das Urheberrecht eines anderen verletzt, wird … bestraft“.[73] § 143a Abs. 1 MarkenG knüpft ausdrücklich („Wer die Rechte des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke … verletzt“) an den Rechtsverstoß an und in § 144 Abs. 1 MarkenG geschieht dies mit dem Wort „entgegen“. In § 142 PatG wird auf das Erfordernis der Patentverletzung durch Bezugnahme auf die Tathandlungen des § 9 PatG Bezug genommen.[74]
45
In dem umweltstrafrechtlichen Merkmal „unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten (§§ 324a Abs. 1, 325 Abs. 1, 2, 3, 328 Abs. 3 StGB) wird allgemein ein objektives Tatbestandsmerkmal gesehen, mit der zutreffenden Folge, dass sich der Vorsatz auch auf die Verwaltungswidrigkeit beziehen muss.[75] An dieser Rechtslage würde sich nichts ändern, wenn der Gesetzgeber das Merkmal der Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten durch die Variante des § 330d Abs. 1 Nr. 4a StGB, also durch die Merkmale „entgegen einer Rechtsvorschrift, die dem Schutz … dient“, ersetzte.
46
Die Meinungsverschiedenheiten spiegelt anschaulich eine Entscheidung des BGH zu § 34 Abs. 4 Nr. 2 AWG a.F. = § 18 Abs. 1 Nr. 1a AWG n.F. wider.[76] In dem Fall hatte der Angeklagte entgegen der zum Tatzeitpunkt geltenden Iran-Embargo-VO Nr. 423/2007 (EG) an eine im Anhang IV der VO aufgelistete Organisation A., insoweit Art. 7 Abs. 3 der VO verletzend, „wirtschaftliche Ressourcen“ in der Form von Tritium geliefert. Da nicht festgestellt war, dass X von der Listung der Organisation A. wusste, bemerkte der BGH, „dass die (mögliche) Unkenntnis von der Listung den Vorsatz des Angeklagten unberührt lässt, weil der Irrtum über den Inhalt und oder die Reichweite einer Ausfüllungsnorm, auf die ein Blankettstraftatbestand wie § 34 Abs. 4 AWG ausdrücklich verweist, sich als Verbots-, nicht aber als Tatbestandsirrtum darstellt“. Der BGH beanstandete lediglich, dass das Landgericht sich nicht mit der Milderung gemäß § 17 S. 2 StGB auseinandergesetzt habe. So betrachtet lautet für den BGH der „zusammengelesene“ Straftatbestand offenbar wie folgt: „Wer in den Iran wirtschaftliche Ressourcen (Tritium) an A. liefert, wird … bestraft.“ Ein solcher Tatbestand verkörpert keinen ausreichenden Unrechtstypus.[77] Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1a AWG soll u.a. bestraft werden, „wer einem Ausfuhrverbot eines veröffentlichten unmittelbar geltenden Rechtsaktes der Europäischen Gemeinschaften zuwiderhandelt“. Der einschlägige Rechtsakt lautete (Art. 7 Abs. 3 VO): „Den in den Anhängen IV und V aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen.“ Die Lesart des BGH und des ihm zustimmenden Schrifttums[78] unterschlägt das Ausfuhrverbot, das Zuwiderhandeln und die Konkretisierung des Verbots durch Art. 7 Abs. 3 VO mit der Bezugnahme auf die Listung im Anhang IV.[79] Zustimmung verdient demgegenüber die Bildung eines objektiven Tatbestandes etwa mit dem folgenden Inhalt: „Bestraft wird, wer der Organisation A., die auf der Liste im Anhang IV Iran-Embargo-VO steht, wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung stellt.“[80]
2. Ordnungswidrigkeitenrecht
47
Auch im Ordnungswidrigkeitenrecht finden sich komplizierte zusammengesetzte Tatbestände mit Blankettcharakter, die vergleichbare Interpretationsprobleme aufwerfen. Besondere Aufmerksamkeit verdient insoweit das Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht. Denn hier stößt man teilweise auf eine Irrtumsrechtsprechung, welche die Existenz geschriebener objektiver Tatbestandsmerkmale entweder nicht erkennt oder ignoriert. Beispielhaft verdeutlicht: Nach § 49 Abs. 3 Nr. 5 StVO handelt ordnungswidrig im Sinne des § 24 StVG, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 42 Abs. 2 StVO das z.B. durch das Richtzeichen 325.1 der Anlage 3 Spalte 3 angeordnete Ge- oder Verbot nicht befolgt. Dieses Richtzeichen in der Form eines blauen Verkehrsschildes steht für den Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs. Spalte 3 erläutert den Inhalt, am wichtigsten: „1. Wer ein Fahrzeug führt, muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren.“ Rechtsprechung und Teile der Literatur nehmen insoweit einen Verbotsirrtum an, wenn das Verkehrszeichen oder die Verkehrslage optisch richtig wahrgenommen, aber falsch gedeutet wird.[81] Offenbar soll sich aus der bloßen Wahrnehmung des Verkehrszeichens gleichsam automatisch die Kenntnis von dessen Inhalt ergeben bzw. sich die geschriebenen objektiven Tatbestandsmerkmale auf die Wahrnehmung des Verkehrszeichens (verkehrsberuhigter Bereich) und das Fahren mit höherer Geschwindigkeit als Schrittgeschwindigkeit beschränken. Indes ist bei Verkehrszeichen nicht der Verstoß gegen das Zeichen als solches, sondern gegen die in Form der Allgemeinverfügung ergangene Anordnung bußgeldbewehrt.[82] Anordnung und Inhalt ergeben zusammen den Tatbestand der Allgemeinverfügung. Das Verkehrszeichen fasst diesen Tatbestand lediglich bildhaft zusammen; umschrieben wird er in der StVO. Im Lichte der verfehlten Rechtsprechung müsste man auch z.B. einem Ausländer, der das Schild sieht und mit 15 km/h durch den verkehrsberuhigten Bereich fährt, einen vorsätzlichen Verstoß anlasten, selbst wenn er vom Inhalt des Verkehrszeichens überhaupt keine Ahnung hat. Solche Interpretationen nehmen dem Bußgeldtatbestand den sinnvollen Inhalt, laufen auf Fiktionen hinaus und setzen sich über § 49 Abs. 3 Nr. 5 StVO hinweg, der ausdrücklich das Nichtbefolgen eines durch Richtzeichen angeordneten Ge- oder Verbots ahnden will.[83]
48
Das OLG Bamberg[84] hat in jüngerer Zeit die Rechtsprechung bestätigt, dass die optische Wahrnehmung der Beschilderung als solche genüge, um einen vorsatzausschließenden Tatbestandsirrtum abzulehnen. In dem Fall ging es um eine Trägertafel mit mehreren Zeichen (oben Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h, darunter das Überholverbotszeichen, unten das Zusatzzeichen „nur für Lkw, Busse …“) und einen Pkw-Fahrer, der wegen des Zusatzzeichens das Geschwindigkeitslimit – entgegen § 39 Abs. 3 S. 3 StVO – nicht auf sich bezog. Der Betroffene habe sich, so das OLG Bamberg, nicht über die tatsächlichen Umstände des Verbots geirrt, sondern sei lediglich einem Wertungsirrtum, also einem Verbotsirrtum, hinsichtlich der Bedeutung der angebrachten Zusatzschilder unterlegen. Immerhin werden die Gegenstimmen[85] erwähnt, doch wird nicht die Gelegenheit genutzt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Übersehen wird u.a., dass man in dem Verbot, nicht schneller als 60 km/h fahren zu dürfen, auch einen Tatumstand sehen kann, den der Betroffene auf sich beziehen muss. Meint er, wegen des Zusatzzeichens gelte das Geschwindigkeitsverbot für ihn nicht, erfasst er diesen Tatumstand nicht.[86]
8. Abschnitt: Unrechtsbegründung: Tatbestand › § 32 Geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale › Ausgewählte Literatur
Ausgewählte Literatur
Bülte, Jens Der Irrtum über das Verbot im Wirtschaftsstrafrecht, NStZ 2013, 65 ff. Bülte, Jens Emissionszertifikate als ähnliche Rechte auch im Steuerstrafrecht – Kein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG, NZWiSt 2017, 161 ff. Cornelius, Kai Verweisungsbedingte Akzessorietät bei Straftatbeständen, 2016. Dannecker, Gerhard Nullum crimen, nulla poena sine lege und seine Geltung im Allgemeinen Teil des Strafrechts, FS Otto, S. 25 ff. Eisele, Jörg Die Regelbeispielsmethode im Strafrecht, 2004. Gallas, Wilhelm Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen, ZStW 67 (1955), 1 ff. Kemme, Matthias Das Tatbestandsmerkmal der Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten in den Umweltstraftatbeständen des StGB, 2007. Kraatz, Erik Der Untreuetatbestand ist verfassungsgemäß – gerade noch!, JR 2011, 434. Krell, Paul Zur Bedeutung der „Drittnormen“ für die Untreue, NStZ 2014, 62 ff. Krell, Paul Das Verbot der Verschleifung strafrechtlicher Tatbestandsmerkmale, ZStW 126 (2014), 902 ff. Krüger, Matthias Neues aus Karlsruhe zu Artikel 103 II GG und § 266 StGB, NStZ 2011, 369 ff. Mitsch, Wolfgang Recht der Ordnungswidrigkeiten, 2. Aufl. 2005. Perron, Walter Hat die deutsche Straftatsystematik eine europäische Zukunft?, FS Lenckner, S. 227 ff. Puppe, Ingeborg Tatirrtum, Rechtsirrtum, Subsumtionsirrtum, GA 1990, 145 ff. Rengier, Rudolf Die öffentlich-rechtliche Genehmigung im Strafrecht, ZStW 101 (1989), 874 ff. Rengier, Rudolf Zum Täterkreis und zum Sonder- und Allgemeindeliktscharakter der „Betreiberdelikte“ im Umweltstrafrecht, FS Kohlmann, S. 225 ff. Rönnau, Thomas Untreue als Wirtschaftsdelikt, ZStW 119 (2007), 887 ff. Rönnau, Thomas/Becker, Christian Von der Überholspur in den Totalschaden: die untreuestrafrechtliche Aufarbeitung der causa „Nürburgring“, JR 2017, 204 ff. Roxin, Claus Über Tatbestands- und Verbotsirrtum, FS Tiedemann, S. 375 ff. Saliger, Frank Gibt es eine Untreuemode? Die neuere Untreuedebatte und Möglichkeiten einer restriktiven Auslegung, HRRS 2006, 10 ff. Saliger, Frank Wider die Ausweitung des Untreuetatbestandes, ZStW 112 (2000), 563 ff. Saliger, Frank Auswirkungen des Untreue-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 23.6.2010 auf die Schadensdogmatik, ZIS 2011, 902 ff. Saliger, Frank Umweltstrafrecht, 2012. Schuster, Frank P. Das Verhältnis von Strafnormen und Bezugsnormen aus anderen Rechtsgebieten, 2012. Tiedemann, Klaus Zum Stand der Irrtumslehre, insbesondere im Wirtschafts- und Nebenstrafrecht, Geerds-FS, S. 95 ff. Tiedemann, Klaus Wirtschaftsstrafrecht, 5. Aufl. 2017. Walter, Tonio Der Kern des Strafrechts, 2006. Wissmann, Philipp Der Irrtum im Urheberstrafrecht, 2017.