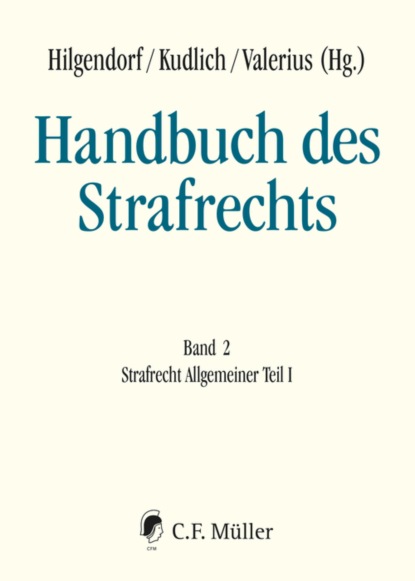- -
- 100%
- +
93
Diese Vorstellung ist allerdings irreführend. Zwar trifft zu, dass die Entscheidung für eine bestimmte Fassung der Lehre von der objektiven Zurechnung, ja schon die Entscheidung, die als zu weit empfundene csqn- Formel überhaupt einschränken zu wollen, Entscheidungen impliziert, und in diesem Sinne „normativ“ ist. Aber auch die Festlegung auf die Verwendung der csqn-Formel als Definition oder Kriterium von Kausalität beruht auf einer Entscheidung und ist insofern normativ.[174] Begriffliche Festlegungen (Definitionen) sind stets normativ.[175] Die Tatsache, dass eine bestimmte (fachjuristische) Begrifflichkeit meist bereits in der Alltagssprache oder in einer bestimmten Fachsprache verwendet wurde, bevor sie in den juristischen Sprachgebrauch übernommen wird, ändert daran nichts.
94
Denkbar ist es aber auch, „normativ“ im Sinne von „durch Normen“ oder „unter Verwendung von Normen“ zu gebrauchen. So ließe sich etwa sagen, dass ein Interessenkonflikt normativ (also etwa durch Gesetz oder Richterspruch) geregelt werden solle, und nicht durch Gewalt oder Machtausübung. Diese siebte Verwendungsweise des Ausdrucks „normativ“ ist mit der sechsten Verwendungsform eng verwandt; nicht selten wird es sich dabei sogar um eine Spezialform handeln.
95
In einer achten Verwendungsweise meint „normativ“, dass zum Verständnis oder zur Verwendung des in Frage stehenden sprachlichen Ausdrucks eine Wertung, insbesondere eine Eigenwertung, erforderlich ist. Verwendet man das Konzept in dieser Weise, so bezieht es sich vor allem auf Begriffe. Ein Hauptanwendungsfall im Recht sind die „wertausfüllungsbedürftigen Merkmale.“[176] So ist etwa der Begriff „rücksichtslos“ in § 315c Abs. 1 Nr. 2 StGB ein normativer Begriff, da seine Verwendung eine Eigenwertung des Rechtsanwenders voraussetzt. Die Dogmatik kennt ferner „gesamttatbewertende Merkmale“ wie die Verwerflichkeit bei § 240 Abs. 2 StGB.[177] Derartige Eigenwertungen stehen in einem Spannungsverhältnis zur Objektivität und Transparenz der Rechtsanwendung; sie sind jedoch, wie die moderne Methodenlehre gezeigt hat, unvermeidbar (→ AT Bd. 1: Hans Kudlich, Die Auslegung von Strafgesetzen, § 3).
96
Damit verwandt ist die Unterscheidung von deskriptiven und normativen Tatbestandsmerkmalen. Deskriptive Tatbestandsmerkmale sind Merkmale, die „sich auf natürliche Eigenschaften von Personen und Objekten [beziehen], deren Vorhandensein empirisch oder durch Berechnung festgestellt werden kann“, während normative Tatbestandsmerkmale sich dadurch auszeichnen, dass sie sich „auf Eigenschaften [beziehen], die auf einer sozialen bzw. rechtlichen Regel beruhen“.[178] Ein Beispiel für ein normatives Tatbestandsmerkmal in diesem Sinne ist etwa die Verletzung „fremden Jagdrechts“ (§ 292 StGB).
97
Die skizzierten Verwendungsweisen des Ausdrucks „normativ“ erfassen das Begriffsfeld nicht erschöpfend. Es ist also keineswegs auszuschließen, dass das Konzept noch in weiteren, hier nicht behandelten Formen gebraucht wird. Aus all dem wird deutlich, wie wichtig es ist, im Zusammenhang mit Forderungen nach mehr „Normativität“ methodologisch diszipliniert vorzugehen und genau anzugeben, was man meint, wenn man das Zauberwort „normativ“ verwendet.
II. Normativismus
98
Im Zusammenhang mit der Rechtswissenschaft und ihrer Methodologie findet sich nicht selten auch der Ausdruck „Normativismus“. Dieses Konzept wird jedoch ebenfalls in unterschiedlicher Weise verwendet. Böckenförde hat „Normativismus“ wie folgt umschrieben: „Bezeichnung einer Richtung des Rechtsdenkens und der Rechtswissenschaft, die das Recht allein als einen gegenüber dem Tatsächlichen abgeschlossenen Komplex geltender Rechtsnormen (im Sinn erlassener Gesetzesregeln) begreift und die Aufgabe der Rechtswissenschaft nur darin sieht, diesen Normenkomplex unter Anwendung der Mittel der Logik zu analysieren, in seinem Aussagegehalt festzustellen und durch Rückführung auf allgemeinere rechtslogische Begriffe und Denkfiguren zu systematisieren“.[179]
99
Einem so verstandenen „Normativismus“ entgegengesetzt ist vor allem das „konkrete Ordnungsdenken“ wie es z.Z. des Nationalsozialismus etwa von Carl Schmitt und Karl Larenz vertreten wurde. Dahinter steht die Vorstellung, was als „Recht“ zu gelten habe, ließe sich lebensweltlichen Traditionen und Einrichtungen, etwa der „Familie“, entnehmen. Damit wird der Unterschied zwischen sozialer Normierung und Recht eingeebnet und das Recht von der Interpretation der „konkreten Ordnung“ abhängig gemacht.[180]
100
In der heutigen Strafrechtswissenschaft wird der Begriff „Normativismus“ meist in einem anderen Sinne[181] verwendet. Er soll ausdrücken, dass die Begriffsbildung der Strafrechtsdogmatik nicht an irgendwelche Vorgegebenheiten, etwa „sachlogische Strukturen“ (vgl. oben Rn. 56) gebunden sei, sondern im Einklang mit der modernen Definitionslehre grundsätzlich[182] frei gestaltet werden könne.[183] Der Gegenbegriff zum „Normativismus“ in diesem Sinne ist ein „ontologisches Strafrechtsverständnis“, oft einfach als „Ontologismus“ bezeichnet, wonach dem Strafrecht bestimmte Inhalte oder Strukturen zwingend vorgegeben sind. Diese Auffassung besitzt heute kaum noch Anhänger;[184] Straftatsystem und strafrechtliche Begriffe werden teleologisch bestimmt.
101
Mit der Entscheidung für eine teleologische, also zweck- oder zielorientierte Perspektive ist die Frage nach den zugrunde zu legenden Zwecken und Zielen des Strafrechts freilich noch nicht beantwortet. Insofern hängen Verbrechensbegriff und Straftheorie in der Tat zusammen.[185] Die Straftheorie ihrerseits verweist auf Rechtstheorie und Rechtsphilosophie. Schon wegen dieser Grundlagenorientierung spricht wenig dafür, dass die Auseinandersetzungen um das Straftatsystem und die juristische Begriffsbildung bald zu einem Ende kommen könnten.
6. Abschnitt: Die Straftat › § 27 System- und Begriffsbildung im Strafrecht › Ausgewählte Literatur
Ausgewählte Literatur
v. Beling, Ernst Ludwig Die Lehre vom Verbrechen, 1906. v. Beling, Ernst Ludwig Grenzlinien zwischen Recht und Unrecht in der Ausübung der Strafrechtspflege, 1913. Binding, Karl Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 1, 1872. Busch, Richard Moderne Wandlungen der Verbrechenslehre, 1949. Coing, Helmut Zur Geschichte des Privatrechtssystems, 1962. Frisch, Wolfgang Erfolgsgeschichte und Kritik der objektiven Zurechnungslehre – zugleich ein Beitrag zur Revisionsbedürftigkeit des Straftatsystems, GA 2018, 553 ff. Frisch, Wolfgang Straftheorie, Verbrechensbegriff und Straftatsystem im Umbruch, GA 2019, 185 ff. Gallas, Wilhelm Zur gegenwärtigen Lage der Lehre vom Verbrechen, in: ders., Beiträge zum Verbrechen, 1968, S. 17 ff. Greco, Luis Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie. Ein Beitrag zur gegenwärtigen strafrechtlichen Grundlagendiskussion, 2009. Greco, Luis Wider die jüngere Relativierung von Unrecht und Schuld, GA 2009, 636 ff. Hilgendorf, Eric Naturalismus und (Straf-)Recht: ein Beitrag zum Thema „Recht und Wissenschaft“, in: Jahrbuch für Recht und Ethik, Bd. 1, 2003, S. 83 ff. Hilgendorf, Eric Was heißt „normativ“? Zu einigen Bedeutungsnuancen einer Modevokabel, FS Rottleuthner, 2011, S. 45 ff. Hilgendorf, Eric Systembildung im (Straf-)Recht, in: ders. (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen des chinesischen und deutschen Strafrechts. Beiträge der zweiten Tagung des Chinesisch-Deutschen Strafrechtslehrerverbands in Peking vom 3. bis 4. September 2013, 2015, S. 37 ff. Ida, Makato Die heutige japanische Diskussion über das Straftatsystem. Eine kritische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der deutschen Strafrechtswissenschaft, 1991. Jansen, Nils Die Struktur des Haftungsrechts. Geschichte, Theorie und Dogmatik außervertraglicher Ansprüche auf Schadensersatz, 2003. Jhering, Rudolf von Das Schuldmoment im Römischen Privatrecht. Eine Festschrift, 1867. Kindhäuser, Urs Zur Logik des Verbrechensaufbaus, in: Koch (Hrsg.) Herausforderungen an das Recht. Alte Antworten auf neue Fragen? Rostocker Antrittsvorlesungen 1993 – 1997, 1997, S. 77 ff. Koch, Arnd/Löhnig, Martin (Hrsg.) Die Schule Franz von Liszts. Spezialpräventive Kriminalpolitik und die Entstehung des modernen Strafrechts, 2016. Lampe, Ernst-Joachim Das personale Unrecht, 1967. Mezger, Edmund Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik, 1950. Naucke, Wolfgang Wissenschaftliches Strafrechtssystem und positives Strafrecht, GA 1998, 263 ff. Oehler, Dietrich Wurzel, Wandel und Wert der strafrechtlichen Legalordnung, 1950. Pawlik, Michael „Der wichtigste dogmatische Fortschritt der letzten Menschenalter“? Anmerkungen zur Unterscheidung zwischen Unrecht und Schuld im Strafrecht, in: FS Harro Otto, 2007, S. 133 ff. Plate, Hartwig Ernst Beling als Strafrechtsdogmatiker. Seine Lehren zur Begriffs- und Systembildung, Schriften zum Strafrecht, Bd. 6, 1966. Puppe, Ingeborg Der Aufbau des Verbrechens, FS Harro Otto, 2007, S. 389 ff. Radbruch, Gustav Zur Systematik der Verbrechenslehre, in: ders., Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem. Zugleich ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Systematik, hrsg. von Art. Kaufmann, 1967, Anhang S. 151 ff. Rostalski, Frauke Der Tatbegriff im Strafrecht. Entwurf eines für das gesamte Strafrechtssystem einheitlichen normativ-funktionalen Begriffs der Tat, 2019. Roxin, Claus Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 1970, 2., um ein Nachwort erweiterte Auflage 1973. Schroeder, Friedrich-Christian Die Entwicklung der Gliederung der Straftat in Deutschland, in: ders., Beiträge zur Gesetzgebungslehre und zur Strafrechtsdogmatik. Hrsg. von Andreas Hoyer, 2001, S. 106 ff. Schünemann, Bernd (Hrsg.) Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, 1984. Spendel, Günter Der Begriff des Unrechts im Verbrechenssystem, in: FS Weber, 2004, S. 3 ff. Stübinger, Stephan Von der alten Imputations-Lehre zum klassischen Verbrechensbegriff – Ein Beitrag zur Geschichte des strafrechtlichen Zurechnungsbegriffs, in: Rechtswissenschaft 2011, S. 154 ff. Welzel, Hans Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, 1975. Würtenberger, Thomas Die geistige Situation der deutschen Strafrechtswissenschaft, 1957, 2. Aufl. 1959. Zabel, Benno Die Ordnung des Strafrechts. Zum Funktionswandel von Normen, Zurechnung, und Verfahren, 2017.
Anmerkungen
[1]
Schünemann, Einführung in das strafrechtliche Systemdenken, in: ders. (Hrsg.), Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, S. 1.
[2]
Man sollte nicht vergessen, dass auch die Österreichische und Schweizer Strafrechtswissenschaft wesentliche Beiträge zur deutschsprachigen Strafrechtswissenschaft und insbesondere auch der Straftatlehre geleistet hat, vgl. etwa Moos, Der Verbrechensbegriff in Österreich im 18. und 19. Jahrhundert, 1968; ders., JR 1977, S. 34 ff.; Germann, Der Verbrechensbegriff nach schweizerischem Strafgesetzbuch, 1943.
[3]
Hilgendorf, Systembildung im (Straf-)Recht, in: ders. (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen des chinesischen und deutschen Strafrechts, 2015, S. 37, 44. Einige Passagen dieses Textes wurden in die vorliegende Darstellung übernommen.
[4]
Zu den Vorteilen eines „systematischen“ Vorgehens Hilgendorf, ebenda, S. 37, 48 ff., wo eine Ordnungsfunktion, eine Integrationsfunktion, eine wissenschaftskonstitutive Funktion, eine heuristische Funktion, eine didaktische Funktion, eine rechtsanwendungsleitende Funktion, eine rechtsstaatliche Transparenzfunktion, eine Kritikfunktion und eine wertexpressive Funktion unterschieden werden.
[5]
Roxin, AT, Bd. 1, § 7 Rn. 5 ff.; siehe auch unten Rn. 7.
[6]
Zur Lehre vom Rechtsgut als heute vorherrschender Methode zur materiellen Bestimmung des Verbrechens und des Unrechts → AT Bd. 1: Eric Hilgendorf, Strafrechtspolitik und Rechtsgutslehre, § 17 Rn. 21 ff., 69 ff.
[7]
Zum Konzept der „Explikation“ T. Pawlowski, Begriffsbildung und Definition, 1980, S. 157 ff.
[8]
Oehler, Wurzel, Wandel und Wert der strafrechtlichen Legalordnung, S. 1.
[9]
Von Weber hebt für die europäischen Strafrechtsordnungen den Einfluss des Dekalogs hervor, v. Weber, Sauer-FS, S. 44 ff.
[10]
Grundlegend Mezger, AT, 1931, S. 88 ff.
[11]
Vgl. nur Kühl, AT, § 1 Rn. 4 ff. m.w.N.
[12]
Frisch, GA 2019, 185, 191; ähnlich schon Jakobs, AT, 1983, 1/2 und 9; ders., Staatliche Strafe. Bedeutung und Zweck, 2004, S. 24 ff.; Köhler, Der Begriff der Strafe, 1986, S. 69 ff.; Lesch, Der Verbrechensbegriff. Grundlinien einer funktionalen Revision, 1999, S. 210 ff.; Pawlik, Das Unrecht des Bürgers. Grundlinien der allgemeinen Verbrechenslehre, 2012, S. 55 f., 76 ff.; Rostalski, Der Tatbegriff im Strafrecht, 2019, S. 20 ff.
[13]
Frisch, GA 2019, 185, 191.
[14]
Eine interessante Kritik der Lehre vom Normgeltungsschaden aus eben dieser radikal-subjektiven Perspektive hat Sancinetti formuliert, Subjektive Unrechtsbegründung und Rücktritt vom Versuch, 1995, S. 19 ff.
[15]
Ähnlich → AT Bd. 1: Hörnle, § 12 Rn. 34.
[16]
Lucke, Art. „Norm und Sanktion“, in: Endruweit u.a. (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie, 3. Aufl. 2014, S. 338 ff. m.w.N.; s. auch → AT Bd. 1: Hilgendorf, § 1 Rn. 5 ff.
[17]
So bemerkenswerterweise auch Frisch, GA 2019, 185, 195, vgl. auch Zazyck, GA 2014, 73, 83 ff.
[18]
Wolter/Freund, Straftat, Strafzumessung und Strafprozeß im gesamten Strafrechtssystem: Straftatbegriff – Straftatzurechnung – Strafrechtszweck – Strafausschluss – Strafverzicht – Strafklageverzicht, 1996, mit zustimmender Besprechung von Naucke, GA 1998, 263 ff.; aus jüngerer Zeit Rostalski, Der Tatbegriff im Strafrecht, 2019, S. 13 und passim.
[19]
Naucke, GA 1998, 263 verweist in diesem Zusammenhang auf Feuerbachs Lehrbuch des peinlichen Rechts (1801), in dem er Ansätze eines „gesamten Strafrechtssystems“ verwirklicht sieht.
[20]
Umfassend → AT Bd. 1: Stefanie Schmahl, Verfassungsrechtliche Vorgaben für das Strafrecht, § 2.
[21]
Ein Musterbeispiel für die (aus deutscher Sicht) hochgradig unsystematische Behandlung der „defenses“ (und auch anderer Elemente der Straftat) im US-Amerikanischen Strafrecht bildet Loewy, Criminal Law, 3. Aufl. 2000, Kap. 6, 10, 11. Immerhin wird die Unterscheidung von Rechtswidrigkeit und Schuld durch die Kapitelgliederung angedeutet. In der jüngeren angelsächsischen Literatur mehren sich die Stimmen, die eine Trennung von Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründen nach deutschem Muster anstreben, so etwa Dubber, Criminal Law: Model Penal Code, 2002; vgl. auch Robinson, in: Heller/Dubber (Hrsg.), The Handbook of Comparative Criminal Law, 2011, S. 581 ff., wo fünf verschiedene Arten von „defenses“ unterschieden werden, darunter auch (als getrennte Kategorien) „justifications“ and „excuses“. S. ferner Gardner, Offenses and Defenses. Selected Essays in the Philosophy of Criminal Law, 2007.
[22]
Robinson/Cahill, Criminal Law, 2. Aufl. 2011, S. 114 ff.; vgl. auch ebenda, S. 32 ff. zur „conceptual structure“ des US-Strafrechts.
[23]
Zu möglichen rechtskulturellen Hintergründen Großfeld, Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung, 1984, S. 122 f.
[24]
Lyon, Der Verbrechensbegriff in der Strafrechtswissenschaft der DDR, 1960, S. 10 ff. (zur Entwicklung des materiellen Verbrechensbegriffs in der UdSSR), S. 87 ff. (zum vierstufigen Aufbau).
[25]
Maklezow, in: ders. u.a. (Hrsg.), Das Recht Sowjetrusslands, 1925, S. 272 f. spricht vom Erfordernis einer „bedeutenden Gefahr für die Gesellschaft“. Eine solche Klausel ist fast nach Belieben interpretierbar. Vgl. auch § 1 Abs. 1 des StGB der DDR vom 12.1.1968: „Straftaten sind schuldhaft begangene gesellschaftswidrige oder gesellschaftsgefährliche Handlungen (Tun oder Unterlassen), die nach dem Gesetz als Vergehen oder Verbrechen strafrechtliche Verantwortlichkeit begründen.“ Näher zum Strafrecht der DDR → AT Bd. 1: Moritz Vormbaum, Das Strafrecht der Deutschen Demokratischen Republik, § 10, sowie F.-C. Schroeder, Das Strafrecht des realen Sozialismus. Eine Einführung am Beispiel der DDR, 1983.
[26]
Che, Wandel der strafrechtlichen Haftungslehre in China. Eine Untersuchung aus historischer Perspektive, in: Hilgendorf (Hrsg.), Das Schuldprinzip im deutsch-chinesischen Vergleich, 2019, S. 3 ff.; Liang, Der Aufbau der chinesischen Verbrechenslehre, in: Hilgendorf (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen des chinesischen und deutschen Strafrechts, 2015, S. 3 ff.; Wang/Li, Rogall-FS, S. 281, 288 ff.
[27]
Ida, Die heutige japanische Diskussion über das Straftatsystem, S. 61 ff. und passim.
[28]
Zu skeptisch in Bezug auf die Zukunftsaussichten der deutschen (und heute eben auch internationalen) Straftatlehre deshalb Perron, Lenckner-FS, S. 227 ff.
[29]
Der Vergleich mit dem Baumeister findet sich bei Zimmerl, Aufbau des Strafrechtssystems, 1930, S. 2.
[30]
Puppe, Otto-FS, S. 389, 401.
[31]
Kritisch dazu Kindhäuser, Zur Logik des Verbrechensaufbaus, in: H. Koch (Hrsg.), Herausforderungen an das Recht: Alte Antworten auf neue Fragen, S. 77 ff.
[32]
Siehe aber Wank, Die juristische Begriffsbildung, 1985.
[33]
Zur Bedeutung von Begriffen in Hegels „Dialektik“ Fulda, Hegels Dialektik als Begriffsbewegung und Darstellungsweise, in: R.-P. Horstmann (Hrsg.), Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, 2. Aufl. 1989, S. 124 ff.; zur Kritik nur Topitsch, Die Sozialphilosophie Hegels als Heilslehre und Herrschaftsideologie, 2. Aufl. 1981, S. 31 ff., 56 ff.
[34]
Ein Beispiel bildet die Debatte um den Personenstatus von Embryonen oder die Diskussion um die „ePerson“, also die Schaffung eines neuen Typs einer juristischen Person für hochkomplexe Computersysteme, wie es das EU-Parlament 2017 für die zivilrechtliche Haftung vorgeschlagen hat, siehe http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_DE.html?redirect. Zum Für und Wider schon Beck, Über Sinn und Unsinn von Statusfragen – zu Vor- und Nachteilen der Einführung einer elektronischen Person, in: Hilgendorf/Beck (Hrsg.), Robotik und Gesetzgebung, 2013, S. 239 ff.
[35]
Zur Definitionslehre T. Pawlowski, Begriffsbildung und Definition, 1980; zusammenfassend Opp, Methodologie der Sozialwissenschaften, 5. Aufl. 2014, S. 17 ff.
[36]
Auch das Straftatsystem hat wichtige praktische Aufgaben, und ist keineswegs ein bloß akademisches Glasperlenspiel. Dazu auch oben Rn. 3 mit Fn. 4.
[37]
Hilgendorf, Paul Johann Anselm von Feuerbach und die Rechtsphilosophie der Aufklärung, in: Koch/Kubiciel/Löhnig/Pawlik (Hrsg.), Feuerbachs Bayerisches Strafgesetzbuch. S. 149, 160 ff.
[38]
Zu Feuerbachs irreführender Einordung als „Kantianer“ auch → AT Bd. 1: Hilgendorf, 1, § 6, Rn. 125 ff.; Kants Systemvorstellungen dürften im Übrigen nicht unerheblich von Christian Wolff beeinflusst worden sein.
[39]
Näher zur Wortgeschichte Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, erarbeitet im Institut für Sprachwissenschaft, Berlin, unter Leitung von W. Pfeifer, 2. Aufl. 1993, S. 1403 f.
[40]
Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786), Vorrede (Akademieausgabe Bd. 4, S. 467).