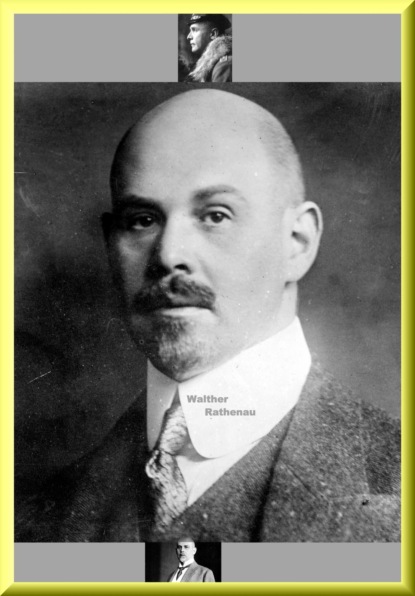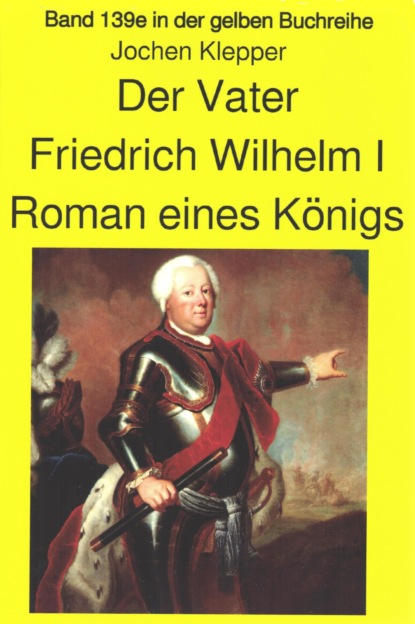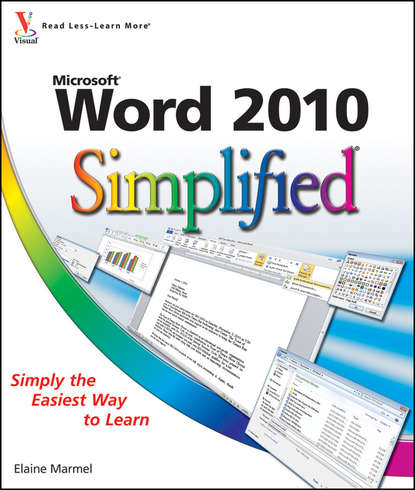Franz Kugler: König Friedrich II von Preußen – Lebensgeschichte des "Alten Fritz"
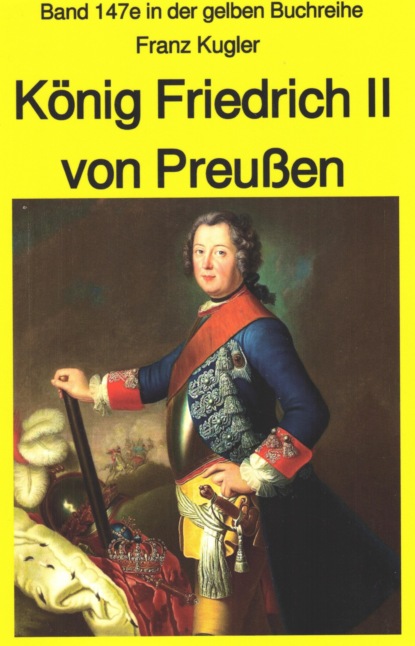
- -
- 100%
- +
Einige Tage darauf erbaten die sämtlichen höheren Offiziere, die in Berlin anwesend waren, unter Anführung des Fürsten von Dessau, die Wiederaufnahme des Kronprinzen in den Militärdienst. Am 30. November erhielt er die Uniform eines Infanterie-Regimentes, zu dessen künftigem Befehlshaber er ernannt wurde. Für den Winter indes musste er die Uniform noch einmal mit seinem bürgerlichen Kleide vertauschen und in den Kreis seiner bisherigen Tätigkeit nach Küstrin zurückkehren. Mit erneutem Eifer und zur stets wachsenden Zufriedenheit des Vaters ging er hier auf die ihm übertragenen Beschäftigungen ein. Die Inspektionsreisen wurden ausgedehnter; vornehmlich waren es jetzt die in jener Gegend vorhandenen Glashütten und deren Betrieb, was ihm Gelegenheit zur Bereicherung seiner Kenntnisse darbot. Er benutzte dies sorgfältig und wusste den Ertrag, den die Glashütten brachten, ungleich vorteilhafter als bisher zu gestalten. Er entwarf auch einen Plan, wie diese Verbesserungen in der Verwaltung der Glashütten auf den sämtlichen Domänen des Landes durchzuführen seien, und der König, dem jede Vermehrung des Einkommens sehr genehm war, befahl, dass nach dem Plane des Kronprinzen in allen Provinzen verfahren werden solle. Aber auch jetzt wurden die militärischen Angelegenheiten nicht versäumt; als besondere Gnade bat sich Friedrich vom Könige, das Exerzier-Reglement aus und suchte sich durch eifriges Studium desselben auch für den kriegerischen Dienst geschickt zu machen. Nachdem ein Fieber, welches ihn gegen das Ende des Januar 1732 befiel, dem Könige noch besondere Gelegenheit gegeben hatte, durch sorgfältige Anordnungen für die Gesundheit des Sohnes seine zurückgekehrte väterliche Liebe zu bezeugen, wurde dieser endlich im Februar nach Berlin zurückgerufen, zum Obersten und Befehlshaber des von der Goltzischen Regimentes ernannt, und ihm die Stadt Ruppin zu seinem Standquartiere angewiesen. Als Friedrich in Küstrin von dem Präsidenten von Münchow Abschied nahm und dieser ihn bei der letzten vertraulichen Unterredung fragte, was wohl dereinst, nach seiner Thronbesteigung, diejenigen von ihm zu erwarten haben würden, die sich in der Zeit des Zwiespaltes mit dem Könige feindselig gegen ihn benommen hatten, erwiderte er: „Ich werde feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln!“
* * *
Neuntes Kapitel – Die Vermählung
Neuntes Kapitel – Die Vermählung
Der Friede zwischen dem Könige und seinem Sohne war nunmehr geschlossen. Aber ebenso wie der Kronprinz war auch der Vater bemüht, die Gelegenheiten zu neuem Bruche zu vermeiden. Und weil er wohl erkannt hatte, dass die Natur dem Charakter seines Sohnes eine andere Richtung als dem seinigen gegeben hatte und dass es unmöglich sein würde, ihn ganz zu seinem Ebenbilde umzugestalten, so hielt er fortan eine Trennung des gewöhnlichen Aufenthaltes, wie solche schon im verflossenen Jahre so vorteilhaft gewirkt hatte, für notwendig. Dies war der Grund, weshalb dem Kronprinzen das neun Meilen entfernte Ruppin zum künftigen Wohnorte angewiesen war. Hier musste ihm natürlich eine größere Freiheit in seinem Tun und Treiben gestattet sein, vorausgesetzt, dass er im Übrigen die Anordnung seines Vaters, namentlich seine Ausbildung für den Soldatendienst, die ihm jetzt als wichtigste Pflicht oblag, befolgte. Diese weise Maßregel bewährte sich in solchem Maß, dass von jetzt an das Vertrauen zwischen Sohn und Vater nur im Zunehmen begriffen blieb, und dass augenblickliche Missverhältnisse, die allerdings bei so verschiedenen Charakteren und bei der feststehenden Geistesrichtung des Königs nicht ganz ausbleiben konnten, doch ohne weitere Folgen vorübergingen. Zunächst hatte freilich der Sohn, um seine vollkommene Unterwerfung unter den Willen des Vaters zu bezeugen, noch einen sehr schmerzlichen Kampf zu bestehen. Um einen der wichtigsten Anlässe zu weiterer Misshelligkeit zu beseitigen, dachte der Vater sehr ernstlich auf die Verheiratung des Kronprinzen. Schon während sich der Letztere in Küstrin aufhielt, waren die ersten Einleitungen dazu getroffen. Die österreichische Partei, die den König noch immer ausschließlich beherrschte und die mit aller Macht den noch immer nicht ganz besiegten englischen Einflüssen entgegen zu arbeiten suchte, wusste es dahin zu bringen, dass eine Nichte der Kaiserin, Elisabeth Christine, eine Prinzessin von Braunschweig-Bevern, in Vorschlag gebracht wurde. Friedrich Wilhelm ging hierauf umso freudiger ein, als ihm der Vater der Prinzessin persönlich vor vielen Fürsten wert war.

Elisabeth Christine, Prinzessin von Braunschweig-Bevern
Der Kronprinz gab seine Zustimmung, aber mit Verzweiflung im Herzen. Man hatte ihm gesagt, die Prinzessin sei hässlich und sehr beschränkten Geistes; und er, in der ersten Blüte der Jugend, aller Lust des Lebens umso eifriger zugetan, je entschlossener die seltene Gelegenheit erhascht werden musste, sollte sich so früh durch ein Band fesseln lassen, das in zweifacher Beziehung seinen Neigungen widersprach! Er suchte einen anderen Ausweg. Die Prinzessin Katharine von Mecklenburg, Nichte der Kaiserin Anna von Russland und von dieser an Kindesstatt angenommen, schien seinen Wünschen ein ungleich angemessenerer Gegenstand. Als er jedoch hierüber Mitteilungen machte und eine solche Wahl wiederum dem österreichischen Hofe sehr bedenklich erschien, so wurden die Anstrengungen von dieser Seite, rücksichtlich der Prinzessin von Braunschweig, verdoppelt und der Wille des Königs von Preußen unwiderruflich bestimmt.
Schon im März 1732, als der Herzog Franz Stephan von Lothringen, der künftige Schwiegersohn des Kaisers, einen Besuch am Hofe von Berlin abstattete, und zu den ehrenvollen Festlichkeiten, mit denen derselbe empfangen wurde, auch die braunschweigischen Herrschaften eingeladen waren, wurde die Verlobung des Kronprinzen mit der Prinzessin Elisabeth Christine gefeiert. Friedrich fand sich, zu seiner großen Beruhigung, durch die früheren Berichte über seine Braut getäuscht; denn sie war keineswegs hässlich, vielmehr von eigentümlicher Anmut in der äußeren Erscheinung, und die übergroße Schüchternheit ihres Benehmens, die sie als beschränkt erscheinen ließ, hoffte er später zu beseitigen. Doch war er klug genug, sich von dieser Veränderung seiner Gesinnungen nichts merken zu lassen, damit der Vater das Opfer, welches er ihm darbrachte, umso höher anschlagen möge. Österreichischerseits tat man alles, um die Prinzessin, bis zur Vermählung, den Wünschen des Kronprinzen gemäß auszubilden; man sorgte für eine geschickte Hofmeisterin; man bemühte sich später sogar, einen ausgezeichneten Tanzmeister für sie zu werben, da der Kronprinz, der damals mit ebenso großer Leidenschaft wie Anmut tanzte, sich über ihren Tanz missfällig geäußert hatte. Die Heirat war auf das nächste Jahr bestimmt, vom kaiserlichen Hofe suchte man dieselbe nach Möglichkeit zu beschleunigen, damit das bisher Gewonnene nicht wieder verloren gehe, was der damals sehr schwankende Gesundheitszustand des Königs befürchten ließ.
Nach Beendigung der Festlichkeiten kehrte der Kronprinz nach Ruppin zurück. Die Ruhe, welche er hier genoss, tat seinem Geiste innig wohl. Zwar ließ er es sich aufs Eifrigste angelegen sein, das ihm anvertraute Regiment unablässig zu üben, für dessen Wohl und Tüchtigkeit zu sorgen, besonders aber, demselben durch die Anwerbung großer Rekruten in den Augen des Königs ein möglichst stattliches Ansehen zu verschaffen; auch versäumte er nicht die ökonomischen Angelegenheiten, die ihm der König gleichzeitig aufgetragen hatte; doch waren die Mußestunden hier ohne weiteren Zwang der Bildung seines Geistes, der Lektüre und Musik gewidmet. Ernstlicher als in früherer Zeit konnte er jetzt auf eine wissenschaftliche Durchbildung bedacht sein, und die großen Männer und die großen Taten der Vorzeit, traten im Spiegel der Geschichte, zu gleichem Tun begeisternd, vor sein inneres Auge. Nahe bei Ruppin selbst, bei Fehrbellin, war klassischer Boden: Hier hatte vor einem halben Jahrhundert des Kronprinzen Ahnherr, der große Kurfürst, die Scharen der Schweden wie ein Gewittersturm vernichtet und sein Land frei gemacht. Er besuchte die Wahlstatt, sich von allen Einzelheiten des denkwürdigen Vorganges zu unterrichten, wohl ahnend, dass seine eigene Zukunft ein solches Studium notwendig machen werde. Ein alter Bürger von Ruppin, der jener Schlacht in seiner Jugend beigewohnt, war sein Führer. Als man die Besichtigung vollendet hatte, fragte diesen der Prinz heiteren Mutes, ob er ihm nicht die Ursache jenes Krieges sagen könne. Treuherzig erwiderte der Alte, der Kurfürst und der Schwedenkönig hätten in ihrer Jugend zusammen in Utrecht studiert, hätten sich aber so wenig miteinander vertragen können, dass es endlich zu solchem Ausbruche habe kommen müssen. Er wusste nicht, dass ein ähnliches Verhältnis zwischen Friedrichs eigenem Vater und dem Könige von England fast zu gleichen Folgen gefühlt hatte und dass es nicht ohne wesentlichen Einfluss auf das Schicksal des Kronprinzen gewesen war.
Zu gleicher Zeit aber sollte ihm auch die Gegenwart das großartigste Beispiel zur Nacheiferung darbieten, und es musste dasselbe umso tiefer auf sein Gemüt wirken, als es gerade der eigene Vater war, der sich hierdurch den Augen der Welt in hochwürdiger Weise darstellte. Es war das Jahr 1732, in welchem Friedrich Wilhelm den protestantischen Bewohnern von Salzburg, die in der Heimat um ihres Glaubens willen bedrückt und verfolgt wurden, seine königliche Hilfe darbot und ihnen in seinen Staaten eine neue Heimat und eine sichere Freistatt eröffnete. In unzähligen Scharen, mehr als zwanzigtausend, betraten die Auswanderer das gastliche Land, wo ihnen, in den Provinzen Preußen und Litauen, weite, fruchtbare Strecken, die durch Pest entvölkert waren, angewiesen wurden. Viele hatten ihr Hab' und Gut im Stiche lassen müssen; umso eifriger kam man ihnen in allen Orten des preußischen Staates, die sie durchzogen, mit wohltätiger Spende entgegen, indem überall das Beispiel im Kleinen nachgeahmt ward, welches der König im Großen ausübte. Von Friedrichs Gesinnungen zeugen seine Briefe aus jener Zeit. „Mein Herz treibt mich (so schreibt er aus Ruppin an Grumbkow), das traurige Los der Ausgewanderten kennenzulernen. Die Standhaftigkeit, welche diese braven Leute bezeugt, und die Unerschrockenheit, mit welcher sie alle Leiden der Welt ertragen haben, um nur nicht der einzigen Religion zu entsagen, die uns die wahre Lehre unsers Erlösers kennen lehrt, kann man, wie es mir scheint, nicht genug vergelten.

Salzburger kommen nach Preußen
Ich würde mich gern meines Hemdes berauben, um es mit diesen Unglücklichen zuteilen. Ich bitte Sie, verschaffen Sie mir Mittel, um ihnen beizustehen; von ganzem Herzen will ich von dem geringen Vermögen, das ich besitze, alles hergeben, was ich ersparen kann“ usw. „Ich versichere Sie (so fährt er in einem anderen Briefe fort), jemehr ich an die Angelegenheit der Ausgewanderten denke, jemehr zerreißt sie mir das Herz.“ – Wir haben keine Zeugnisse, wie viel der Kronprinz für jene Unglücklichen getan; aber es sind Züge seines Lebens genug, und auch aus jener Zeit, vorhanden, die es erkennen lassen, dass solche Äußerungen gewiss durch Taten begleitet waren.

In der einen, so eben, angeführten Briefstelle bittet Friedrich den General Grumbkow, der sich das Vertrauen des Kronprinzen zu erwerben gewusst, ihm Geldmittel zu verschaffen: er war solcher Unterstützung nur zu sehr bedürftig. Er war vom König immer noch auf eine, im Verhältnis zu seiner Stellung beschränkte Einnahme hingewiesen. Dabei hatte er es, trotz aller Fürsorge des Königs, noch immer nicht lernen können, sich eines sparsamen Haushaltes zu befleißigen; manche bedeutendere Ausgaben wurden ihm teils durch äußere, teils durch innere Notwendigkeit auferlegt, und bald war die Summe seiner Schulden aufs Neue zu einer namhaften Höhe angewachsen. Die großen Rekruten, die einmal zur Ausstaffierung seines Regimentes unumgänglich nötig waren, konnten nur durch die Aufopferung sehr bedeutender Mittel angeworben werden. Seine Schwester, die Gemahlin des Erbprinzen von Bayreuth, befand sich in einer ebenfalls sehr unbehaglichen Lage, indem sie weder in Bayreuth von ihrem Schwiegervater, noch in Berlin von ihrem Vater eine genügende Ausstattung erhalten hatte; seinem alten treuen Lehrer Dühan ging es in seiner Verbannung auch nur kümmerlich; beide liebte er zärtlich, und er betrachtete sich als Schuld der Ungnade, die der König auf sie geworfen hatte. Gern teilte er mit ihnen, was er aufzubringen imstande war. Solche Verhältnisse aber waren dem österreichischen Hofe im allerhöchsten Maße erwünscht; sie gaben Gelegenheit, den Kronprinzen, den ein jeder Tag zum Herrscher machen konnte, auf eine festere Weise als durch die bisherigen Versuche an die Interessen Österreichs zu knüpfen. Man leistete ihm bedeutende Vorschüsse, die bald den Charakter eines förmlichen Jahrgehalts annahmen; man gewährte dasselbe der Prinzessin von Bayreuth, indem man den Einfluss wohl kannte, den gerade sie auf den Kronprinzen ausübte; man verschaffte Dühan eine kleine Stellung in Wolfenbüttel und sicherte auch ihm eine besondere Pension zu. Mit der äußersten Vorsicht wusste man alles dies zu bewerkstelligen, so dass der König davon keine Kunde erhielt. Friedrich war wohl imstande, die Absicht des österreichischen Hofes zu durchschauen; aber er nahm das an, wozu ihn die Notwendigkeit zwang. Wie wenig ehrlich die österreichische Gesinnung bei solcher Teilnahme war, wie wenig sie wahrhaften Dank verdiente, zeigte sich nur zu bald.
Das Haupt-Interesse, durch welches Kaiser Karl VI. in allen seinen politischen Unternehmungen geleitet ward, war jene pragmatische Sanktion, welche das Erbfolgerecht seiner Töchter verbürgen sollte. Die Verbindung mit Preußen war eingeleitet worden, weil Friedrich Wilhelm der Sanktion beizutreten versprochen hatte; mit England hatte man in feindlichem Verhältnisse gestanden, weil man hier Widerspruch fand. Das Verhältnis änderte sich, sowie England, infolge eines neuen Umschwunges in der europäischen Politik, der Sanktion beitrat. Nun suchte man dem englischen Hofe gefällig zu sein, und Preußen sollte das Mittel dazu werden. Der König von England hätte noch immer gern eine seiner Töchter zur künftigen Königin von Preußen gemacht; kaum war der Wunsch ausgesprochen, so kehrte sich auch plötzlich die österreichische Politik in Bezug auf Friedrichs Verheiratung um, und so eifrig man bisher an einer Verbindung mit der Prinzessin von Braunschweig gearbeitet hatte, mit ebenso behänden Intrigen suchte man nun das angefangene Werk zugunsten Englands umzustürzen; dabei ward auch anderweitiger Vorteil nicht vergessen, und die Prinzessin Elisabeth Christine, die Nichte der Kaiserin, sollte nun einem englischen Prinzen zuteilwerden. Man ging sogar in diesem diplomatischen Eifer so weit, dass man noch am Vorabend von Friedrichs Hochzeit dem Könige von Preußen die dringendsten Vorstellungen machen ließ. Diesmal aber scheiterten die Künste der Diplomatie an Friedrich Wilhelms deutscher Ehrlichkeit; man erreichte damit nur, dass ihm die englischen Absichten aufs Neue verdächtig wurden, indem die Anträge aufs Neue zu spät kamen, und dass er auch sehr lebhafte Zweifel an der Aufrichtigkeit Österreichs gegen seine Wünsche zu schöpfen begann. Selbst Friedrich, bezeigte sich den veränderten Anträgen wenig günstig, da auch er der Meinung war, dass die Verbindung seiner geliebten älteren Schwester mit einem englischen Prinzen wesentlich nur durch Englands Schuld sei abgebrochen worden.
So ging denn die Vermählung des Kronprinzen mit der Prinzessin Elisabeth Christine im Juni 1733 vor sich. Der preußische Hof war zu dem Endzwecke nach Salzdahlum gereist, einem Lustschlosse des Herzogs Ludwig Rudolph von Braunschweig-Wolfenbüttel, der als Großvater der Braut die Feierlichkeiten der Hochzeit besorgte. Die Trauung ward am 12. Juni durch den berühmten Theologen Abt Mosheim verrichtet. Das Fest wurde durch die Entwicklung großer Pracht verherrlicht, aber es fehlte dabei der frohe Mut. Die Königin von Preußen war in Verzweiflung, dass nun alle ihre Pläne gescheitert waren; die Braut war ohne Willen den Bestimmungen der Ihrigen gefolgt, aber ihre frühere Schüchternheit wurde nur durch all das äußere Gepränge vermehrt; Friedrich hatte zwar seinen Widerwillen abgelegt, aber er fand es gut, vor den Augen der Welt seine Rolle fortzuspielen; der König schien durch das Benehmen des Sohnes nachdenklich gemacht, während zugleich jene englisch-österreichischen Anträge nur geeignet waren, seine Stimmung zu verderben. Nach einigen Tagen kehrten die sämtlichen Herrschaften, die preußischen und die braunschweigischen, nach Berlin zurück, wo am 27. Juni, nachdem man sich durch militärische Schaustellungen zu vergnügen gesucht, der feierliche Einzug in einer langen Reihe prachtvoller Wagen gehalten wurde. Dann folgten neue Festlichkeiten, die mit der schon früher besprochenen Vermählung der Prinzessin Philippine Charlotte, einer jungem Schwester Friedrichs, mit dem Erbprinzen Karl von Braunschweig beschlossen wurden.
Für Friedrichs Aufenthalt in Berlin war das frühere Gouvernementshaus – das Palais, welches als die Wohnung König Friedrich Wilhelms III. allen Preußen noch in teurem Andenken ist – eingerichtet und erweitert worden. Um ihm auch den Aufenthalt bei seinem Regimente in Ruppin angenehmer zu machen, kaufte der König für ihn das Schloss Rheinsberg, das bei einem Städtchen gleiches Namens, zwei Meilen von Ruppin, in Anmutiger Gegend gelegen ist, als er vernommen hatte, dass er hierdurch einen Lieblingswunsch des Sohnes erfüllen könne.

Für den Umbau und die Einrichtung des Schlosses wurde eine namhafte Summe ausgesetzt.
* * *
Zehntes Kapitel – Der erste Anblick des Krieges
Zehntes Kapitel – Der erste Anblick des Krieges
Friedrich hatte bisher den Militärischen Dienst nur auf dem Exerzierplatze kennen gelernt; jetzt sollte ihm auch die ernste Anwen dung dieses Dienstes im Kriege entgegentreten.
Den Anlass zu einem Kriege, an welchem Preußen teilnahm, gab eine Streitigkeit um den Besitz Polens. König August war am 1. Februar 1733 gestorben. Er hatte, gegen die Verfassung Polens, welche kein Erbgesetz kannte und die königliche Macht durch freie Wahl austeilte, die polnische Krone als ein erbliches Gut für seine Familie zu erwerben gesucht. Zunächst zwar ohne Erfolg; doch trat sein Sohn, August III., der ihm in Sachsen als Kurfürst gefolgt war, als Bewerber um die polnische Krone auf, indem Russland und Österreich seinen Schritten einen energischen Nachdruck gaben.

Ihm entgegen stand Stanislaus Lescinski, der Schwiegervater des Königs von Frankreich, Ludwigs XV., der schon früher einige Jahre hindurch, als August II. der Macht des Schwedenkönigs, Karls XII., hatte weichen müssen, mit dem Glanze der polnischen Krone geschmückt gewesen war; für ihn sprach das Wort seines Schwiegersohnes. Polen selbst war in Parteien zerrissen; einst ein mächtiges Reich, war es jetzt keiner Selbstständigkeit, keiner wahren Freiheit mehr fähig, und schon lange Zeit hatte es nur durch fremde Gewalt gelenkt werden können. August III. siegte durch die kriegerische Macht seiner Verbündeten, während Frankreich es für Stanislaus fast nur bei leeren Versprechungen bewenden ließ. Aber ein sehr willkommener Anlass war es dem französischen Hofe, für die Eingriffe in die sogenannte polnische Wahlfreiheit, für die Beleidigung, die dem Könige, Ludwig XV., in der Person seines Schwiegervaters selbst zugefügt worden, an Österreich den Krieg zu erklären, um abermals, wie es schon seit einem Jahrhundert Frankreichs Sitte war, seine Grenzen auf die Lande des deutschen Reiches hin ausdehnen zu können. Die Kriegserklärung erfolgte im Oktober 1733.
Friedrich Wilhelm hatte sich früher der Verbindung Russlands und Österreichs in Rücksicht auf Polen angeschlossen, wobei ihm vorläufig, neben anderen Vorteilen, abermals jene bergische Erbfolge zugesichert war. Da es aber auch jetzt hierüber zu keiner schließlichen Bestimmung kam, so hatte er sich auch nicht näher in die polnischen Händel gemischt. Als die französische Kriegserklärung erfolgte, verhieß er dem Kaiser die Beihilfe von 40.000 Kriegern, wenn seinen Wünschen nunmehr genügend gewillfahrt würde. Aufs Neue jedoch erhielt er ausweichende Antworten, und so gab er nur, wozu er durch sein älteres Bündnis mit dem Kaiser verpflichtet war, eine Unterstützung von 10.000 Mann, welche im Frühjahre 1734 zu dem kaiserlichen Heere abging. Den Oberbefehl über das Letztere führte der Prinz Eugen von Savoyen, der im kaiserlichen Dienste ergraut und dessen Name durch die Siege, die er in seinen früheren Jahren erfochten hatte, hochberühmt war. Dem Könige von Preußen schien die Gelegenheit günstig, um den Kronprinzen unter so gefeierter Leitung in die ernste Kunst des Krieges einweihen zu lassen, und so folgte dieser als Freiwilliger den preußischen Regimentern. Kurze Zeit nach ihm ging auch der König selbst zum Feldlager ab.
Das französische Heer, das mit schnellen Schritten in Deutschland eingerückt war, belagerte die Reichsfestung Philippsburg am Rhein. Eugens Heer war zum Entsatz der Festung herangezogen; das Hauptlager des Letzteren war zu Wiesenthal, einem Dorfe, das von den französischen Verschanzungen nur auf die Weite eines Kanonenschusses entfernt lag. Hier traf Friedrich am 7. Juli ein. Kaum angekommen, begab er sich sogleich zum Prinzen Eugen, den einundsiebzigjährigen Helden von Angesicht zu sehen, dessen Name noch als der erste Stern des Ruhmes am deutschen Himmel glänzte, sowie er auch heutigen Tages noch in den Liedern des deutschen Volkes lebt. Friedrich bat ihn um die Erlaubnis, „zuzusehen, wie ein Held sich Lorbeeren sammele.“ Eugen wusste auf so feine Schmeichelei Verbindliches zu erwidern; er bedauerte, dass er nicht schon früher das Glück gehabt habe, den Kronprinzen bei sich zu sehen: Dann würde er Gelegenheit gefunden haben, ihm manche Dinge zu zeigen, die für einen Heerführer von Nutzen seien und in ähnlichen Fällen mit Vorteil angewandt werden könnten. „Denn“, setzte er mit dem Blicke des Kenners hinzu, „alles an Ihnen verrät mir, dass Sie sich einst als ein tapferer Feldherr zeigen werden.“
Eugen lud den Prinzen ein, bei ihm zu speisen. Während man an der Tafel saß, ward von den Franzosen heftig geschossen; doch achtete man dessen wenig und das Gespräch ging ungestört seinen heiteren Gang. Friedrich aber freute sich, wenn er eine Gesundheit ausbrachte und seinen Trinkspruch von dem Donner des feindlichen Geschützes begleiten hörte.
Eugen fand an dem jugendlichen Kronprinzen ein lebhaftes Wohlgefallen; sein Geist, sein Scharfsinn, sein männliches Betragen überraschten ihn und zogen ihn an. Zwei Tage nach Friedrichs Ankunft machte er ihm in Gesellschaft des Herzogs von Württemberg einen Gegenbesuch und verweilte geraume Zeit in seinem Zelte. Als beide Gäste sich entfernten, ging Eugen zufällig voran, ihm folgte der Herzog von Württemberg. Friedrich, der den Letzteren schon von früherer Zeit her kannte, umarmte diesen und küsste ihn. Schnell wandte sich Eugen um und fragte: „Wollen denn Ew. Königliche Hoheit meine alten Backen nicht auch küssen?“ Mit herzlicher Freude erfüllte Friedrich die Bitte des Feldherrn.
Prinz Eugen bewies dem Kronprinzen seine Zuneigung auch dadurch, dass er ihm ein Geschenk von vier ausgesuchten, großen und schön gewachsenen Rekruten machte. Zu jedem Kriegsrate ward Friedrich zugezogen. Dieser aber war bemüht, sich solcher Zuneigung durch eifrige Teilnahme an allen kriegerischen Angelegenheiten würdig zu machen. Er teilte die Beschwerden des Feldlagers und unterrichtete sich sorgfältig über die Behandlung der Soldaten im Felde. Täglich beritt er, so lange die Belagerung anhielt, die Linien, und wo nur etwas von Bedeutung vorfiel, fehlte er nie. Von kriegerischer Unerschrockenheit gab er schon jetzt eine seltene Probe. Er war nämlich einst mit ziemlich großem Gefolge ausgeritten, die Linien von Philippsburg zu besichtigen. Als er durch ein sehr lichtes Gehölz zurückkehrte, begleitete ihn das feindliche Geschütz ohne Aufhören, so dass mehrere Bäume zu seinen Seiten zertrümmert wurden; doch behielt sein Pferd den ruhigen Schritt bei, und selbst seine Hand, die den Zügel hielt, verriet nicht die mindeste ungewöhnliche Bewegung. Man bemerkte vielmehr, dass er ruhig in seinem Gespräche mit den Generalen, die neben ihm ritten, fortfuhr, und man bewunderte seine Haltung in einer Gefahr, mit welcher sich vertraut zu machen er bisher noch keine Gelegenheit gehabt hatte.