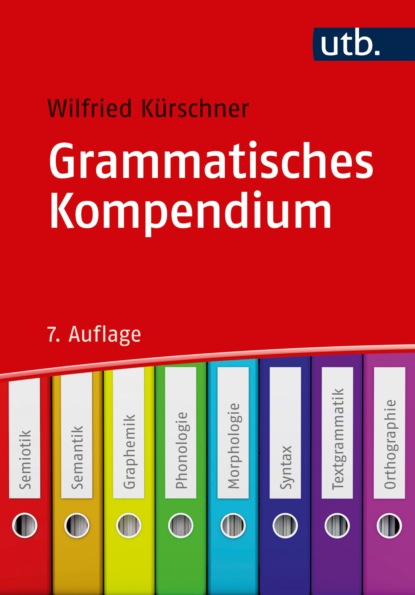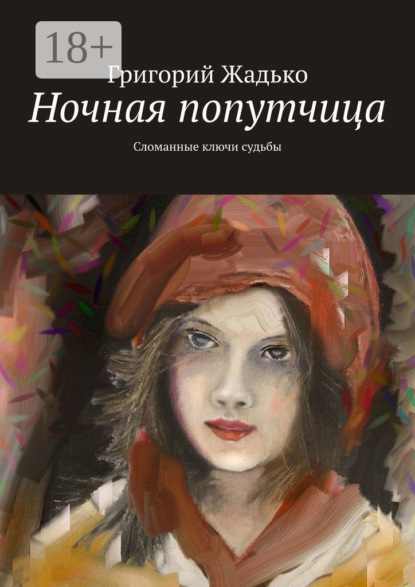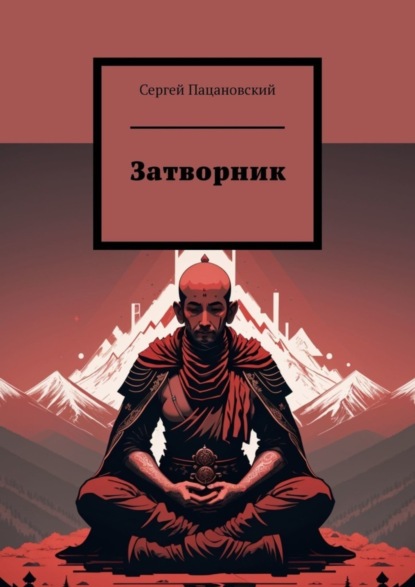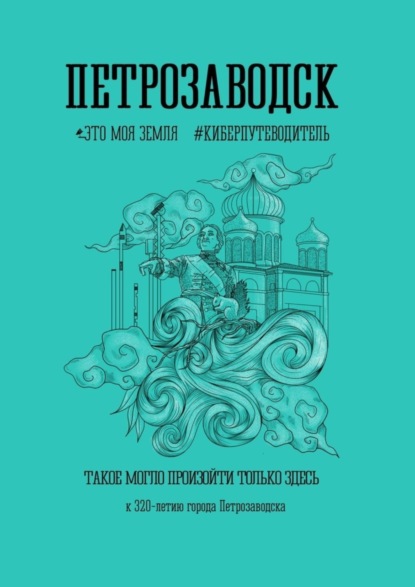- -
- 100%
- +
2.1/7 HomographieHomographie
Beziehung zwischen zwei (oder mehr) homonymen ZeichenZeichen mit orthographischOrthographie gleichen, aber lautlich unterschiedlichen AusdrucksseiteAusdrucksseiten.
Beispiele:
Montage ‘mehrere erste Tage der Woche’ –Montage ‘das Montieren’
Druckerzeugnis ‘gedrucktes Erzeugnis’ –Druckerzeugnis ‘Zeugnis eines Druckers’
umfahren ‘zu Fall bringen’ – umfahren ‘um … herumfahren’

das Homographhomograph/Homograph, des Homographs, die Homographe (Betonung auf -gra(ph)-) – Adjektiv: homographhomograph/Homograph
(Die Zeichen/Wörter) Montage und Montage sind homograph/sind Homographe.
2.2 Zur Beschreibung der InhaltsseiteInhaltsseite
2.2/1 SememSemem
BedeutungBedeutung = InhaltInhalt eines ZeichenZeichens; im Fall von MehrdeutigkeitMehrdeutigkeit = AmbiguitätAmbiguität (▶ Nr. 2.1/2): eine der BedeutungBedeutungen = einer der InhaltInhalte = eine der LesartLesarten = eine der BedeutungsvariantenVarianteBedeutungs-Bedeutungsvariante eines Zeichens.
Beispiel:
Mit der AusdrucksseiteAusdrucksseite Birne sind drei Sememe = Lesarten = Bedeutungsvarianten verbunden: 1. ‘Frucht des Birnbaums’, 2. ‘Leuchtkörper’ , 3. ‘Kopf’ (umgangssprachlich).

2.2/2 Semantisches MerkmalMerkmalsemantischessemantisches Merkmal = SemSem
Kleinstes Bedeutungselement, Baustein eines SememSemems.
Beispiel:
Die BedeutungBedeutungen = InhaltInhalte = SememSememe der ZeichenZeichen Mann, Junge und Ochse haben das semantische Merkmal = das SemSem ‘männlich’ gemeinsam, Mann und Junge außerdem das semantische Merkmal ‘Mensch’. Mann und Junge unterscheiden sich hinsichtlich des Wertes des semantischen Merkmals ‘erwachsen’ voneinander (‘+erwachsen’/[+erwachsen] bzw. ‘−erwachsen’/[−erwachsen], lies: »plus erwachsen« bzw. »minus erwachsen«), von beiden unterscheidet sich das SememSemem von Ochse durch das semantische Merkmal ‘Rind’, das anstelle von ‘Mensch’ vorhanden ist.

2.2/3 DenotationDenotation = denotative BedeutungBedeutungdenotativedenotative Bedeutung
Konstante begriffliche Grundbedeutung eines Zeichens.
2.2/4 KonnotationKonnotation = konnotative BedeutungBedeutungkonnotativekonnotative Bedeutung
Zur denotativen Bedeutungdenotative Bedeutung eines Zeichens hinzutretende semantische MerkmaleMerkmalsemantischessemantisches Merkmal, die die Grundbedeutung begleiten, sie überlagern und ihr Emotionalität, Einschätzung und Bewertung verleihen; BegleitvorstellungBegleitvorstellung.
Beispiele:
sterben (konnotationsfrei) –abkratzen ‘sterben, elend’ – verscheiden ‘sterben, in Würde’
Pferd (konnotationsfrei) – Gaul ‘Pferd, abwertend’
2.2/5 DesignatDesignat
Klasse von außersprachlichen Objekten (Gegenständen, Verhältnissen, Eigenschaften, Sachverhalten), auf die ein ZeichenZeichen oder eine Zeichenverbindung anwendbar ist.
Beispiel:
Die Menge der Steine ist das Designat des Zeichens Stein.

2.2/6 ReferenzReferenz
In der ParoleParole = in der RedeRede (▶ Nr. 1.2/3) vorgenommene sprachliche Bezugnahme auf eine Realität, auf die wahrgenommene oder eine vorgestellte Welt, auf ein außersprachliches Objekt (einen Gegenstand, ein Verhältnis, eine Eigenschaft, einen Sachverhalt).
Beispiel:
Bei der Äußerung eines Satzes wie Der Stein glänzt wird auf einen bestimmten, konkreten Stein Bezug genommen = auf ihn referiert.

Verb: referieren
2.2/7 ReferentReferent = DenotatDenotat
Das außersprachliche Objekt (ein Gegenstand, ein Verhältnis, eine Eigenschaft, ein Sachverhalt), auf das mithilfe sprachlicher Zeichen Bezug genommen wird; das, was ein Zeichen bei seiner Verwendung in der ParoleParole = in der RedeRede (▶ Nr. 1.2/3) bezeichnet.
Beispiel:
Bei der Äußerung eines Satzes wie Der Stein glänzt ist der bestimmte, in der Sprechsituation gemeinte Stein der Referent des Zeichens Stein.

das Denotat, des Denotats, die Denotate (Betonung auf -ta(t)-)
2.3 Beziehungen zwischen Zeicheninhalten
2.3/1 Hyponymhyponym/Hyponym
ZeichenZeichen, das inhaltlich den UnterbegriffUnterbegriff eines anderen bildet. Es steht zum OberbegriffOberbegriff = zum Hyperonymhyperonym/Hyperonym = zum Supernymsupernym/Supernym (▶ Nr. 2.3/2) im Verhältnis der HyponymieHyponymie.
Beispiele:
schreiten – gehen
Rose – Blume
dunkelrot – rot
Zeichen, die gemeinsam Hyponyme eines anderen sind, sind Kohyponymkohyponym/Kohyponyme, z. B.:
Rose, Tulpe, Nelke – Blume
schreiten, trippeln, marschieren – gehen

die Hyponymie, der Hyponymie (Plural ungebräuchlich, Betonung auf -mie)
Adjektiv: hyponym
das Kohyponym, des Kohyponyms, die Kohyponyme
die Kohyponymie, der Kohyponymie (Plural ungebräuchlich)
Adjektiv: kohyponymkohyponym/Kohyponym
Der Inhalt des Zeichens/Das Zeichen) spazieren ist hyponym zu (zum Inhalt des Zeichens/zum Zeichen) gehen. (Das Zeichen) spazieren ist (ein) Hyponym von/zu (dem Zeichen) gehen. (Die Zeichen) spazieren und gehen stehen im Verhältnis der Hyponymie zueinander.
2.3/2 Hyperonymhyperonym/Hyperonym = Supernymsupernym/Supernym
ZeichenZeichen, das inhaltlich den OberbegriffOberbegriff eines anderen bildet. Es steht zum UnterbegriffUnterbegriff = zum Hyponymhyponym/Hyponym (▶ Nr. 2.3/1) im Verhältnis der HyperonymieHyperonymie = der SupernymieSupernymie.
Beispiele:
gehen – schreiten
Blume – Rose
rot – dunkelrot

die Hyperonymie, der Hyperonymie (Plural ungebräuchlich, Betonung auf -mie)
Adjektiv: hyperonym
das Supernym, des Supernyms, die Supernyme (Betonung auf -ny(m)-, Trennung: Su-per-nym)
die Supernymie, der Supernymie (Plural ungebräuchlich, Betonung auf -mie)
Adjektiv: supernym
(Der Inhalt des Zeichens/das Zeichen) gehen ist hyperonym/supernym zu (zum Inhalt des Zeichens/zum Zeichen) spazieren. (Das Zeichen) gehen ist (ein) Hyperonym/Supernym von/zu (dem Zeichen) spazieren. (Die Zeichen) gehen und spazieren stehen im Verhältnis der Hyperonymie/Supernymie zueinander.
2.3/3 Antonymantonym/Antonym
ZeichenZeichen, das inhaltlich den GegenbegriffGegenbegriff eines anderen darstellt. Es steht zum Gegenbegriff im Verhältnis der AntonymieAntonymie.
Hauptfälle:
allgemeiner konträrer GegensatzGegensatzkonträrerkonträrer Gegensatz (‘nicht zugleich A und B’), z. B.:Dreieck – Kreis (‘etwas ist nicht zugleich Dreieck und Kreis’)sitzen – stehengrün – rot
kontradiktorisch-konträrer = komplementärer GegensatzGegensatzkontradiktorisch-konträrerkontradiktorisch-konträrer GegensatzGegensatzkomplementärerkomplementärer Gegensatz (‘nicht zugleich A und B, nicht-A ist B’), z. B.:wahr – falsch (‘etwas ist nicht zugleich wahr und falsch, und was nicht wahr ist, ist falsch’)sinnvoll – sinnlosmännlich – weiblichLeben – Tod
polar-konträrer GegensatzGegensatzpolar-konträrerpolar-konträrer Gegensatz (‘nicht zugleich A und B, A und B als Enden einer Skala’), z. B.:jung – altneu – altdick – dünnwachen – schlafen
KonverseKonversen, z. B.:kaufen – verkaufenborgen – leihengeben – nehmen
Beispiel:
X kauft von Y, Y verkauft an X

die Antonymie, der AntonymieAntonymie (Plural ungebräuchlich, Betonung auf -mie)
Adjektiv: antonym
die Konverse, der Konverse, die KonverseKonversen
(…) jung ist antonym zu (…) alt. (…) alt ist antonym zu (…) jung. (…) jung ist (ein) Antonym zu/von (…) alt. (…) jung und alt sind Antonyme (voneinander) …
2.3/4 WortfeldWortfeld
Menge von inhaltsverwandten Wörtern, die einen bestimmten begrifflichen oder sachlichen Bereich abdecken.
Beispiele:
WortfeldWortfeld ‘Pferd’: Schimmel, Rappe, Fuchs, Falbe, Stute, Hengst, Wallach, Fohlen, Füllen, Pferd usw.
Wortfeld ‘sich fortbewegen’: gehen, laufen, spazieren, stolzieren, kriechen, krabbeln usw.
2.3/5 WortfamilieWortfamilie
Menge von inhaltsverwandten Wörtern mit gleicher oder ähnlicher BasisBasis.
Beispiele:
binden, Band, Binde, Gebinde, Bund, bündeln, bündig, Binder
fangen, Fang, Fänge, Fänger, einfangen – aber nicht auchanfangen, da -fang- in an-fang(-en) bedeutungsmäßig nicht mit dem StammmorphemMorphemStamm-Stammmorphem fang- der Wortfamilie verwandt ist. Verwandtschaft besteht lediglich auf der Ausdrucksseite, auch bei der Formenbildung: fäng-st – anfäng-st, fing – anfing. So auch bei kommen, ankommen, Ankunft, Niederkunft, die eine Wortfamilie bilden, allerdings ohne bekommen, das zwar ebenfalls das Stammelement -komm- aufweist, aber wiederum ohne Bedeutungsverwandtschaft mit dem Stammmorphem komm- der Wortfamilie. – Wörter wie anfang(en), bekommen usw. sind lexikalisierte BildungenBildunglexikalisiertelexikalisierte Bildung, ▶ Nr. 5.5/13.
2.4 BedeutungsübertragungBedeutungsübertragung und BedeutungswandelWandelBedeutungs-Bedeutungswandel
2.4/1 MetapherMetapher
Übertragung eines Zeichens aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen, wobei der Übertragung Ähnlichkeiten der äußeren Gestalt, der Funktion und Verwendung usw. zugrunde liegen, ohne dass ein direkter Vergleich ausgedrückt wird.
Beispiele:
Der Himmel weint.
das Silber seiner Haare
Kopf der Familie
Die metaphorische Übertragung kann sich im Lauf der Sprachgeschichte verfestigen und zu Bedeutungswandel führen. Man spricht dann von lexikalisierter MetapherMetapherlexikalisiertelexikalisierte Metapher. Zum Beispiel bedeutete Kopf ursprünglich ‘gewölbte Schale’ (so noch in Pfeifenkopf); aufgrund der äußeren Ähnlichkeit wurde das Wort auf ‘Haupt’ übertragen. Weitere Beispiele:
begreifen ‘anfassen, abtasten’ >Größerzeichen (lies: »wird zu«) ‘verstehen’
Grund ‘Unterlage’ > ‘Ursache’
hell ‘in Bezug auf Farbton’ > ‘auch in Bezug auf Tonhöhe usw.’

Adjektiv: metaphorisch (Betonung auf -pho-)
2.4/2 MetonymieMetonymie
Übertragung eines Zeichens aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen, wobei die Übertragung auf Dingen und Erscheinungen beruht, die in einem äußeren (ursächlichen, räumlichen, zeitlichen u.ä.) Zusammenhang stehen.
Beispiele:
Schiller lesen (‘Schillers Werke’)
Samt tragen (‘Kleidung aus Samt’)
eine Flasche trinken (‘Flüssigkeitsmenge, die in eine Flasche passt’)
Die metonymische Übertragung kann sich im Lauf der Sprachgeschichte verfestigen und zu Bedeutungswandel führen. Man spricht dann von lexikalisierter MetonymieMetonymielexikalisiertelexikalisierte Metonymie. Zum Beispiel wurde Kragen (mit der Bedeutung ‘Hals’) zur Bezeichnung für das Kleidungsstück, das diesen Körperteil umschließt (die alte Bedeutung ist noch erhalten in Kopf und Kragen [riskieren o.Ä.]).
In diesen Zusammenhang gehört auch die SynekdocheSynekdoche mit ihren Haupttypen Pars pro Toto und Totum pro parte:
eigener Herd ‘eigener Haushalt’,England ‘Großbritannien, Vereinigtes Königreich’ (Pars pro TotoPars pro Toto [ein Teil steht für das Ganze])
Amerika ‘USA’ (Totum pro ParteTotum pro Parte [das Ganze steht für einen Teil])

Adjektiv: metonymisch (Betonung auf -ny-)
die Synekdoche, der Synekdoche (Betonung auf -nek-), die Synekdochen (Betonung auf -do-, Trennung: Sy-nek-do-che oder Syn-ek-do-che)
Adjektiv: synekdochisch (Betonung auf -do-)
das Pars pro Toto, des Pars pro Toto
das Totum pro Parte, des Totum pro Parte
2.4/3 BedeutungserweiterungErweiterungBedeutungs-Bedeutungserweiterung
Ausdehnung des Bedeutungsumfanges eines ZeichenZeichens; GeneralisierungGeneralisierung.
Beispiel:
mhdMittelhochdeutsch. frouwe ‘Dame von Adel’ > nhdNeuhochdeutsch. Frau ‘weibliche Person’ (zu den Abkürzungen und zur hier zugrundegelegten Einteilung der deutschen Sprachgeschichte ▶ Beginn des Abschnitts 4.3)
2.4/4 BedeutungsverengungVerengungBedeutungs-Bedeutungsverengung
Einengung des Bedeutungsumfanges eines ZeichenZeichens; SpezialisierungSpezialisierung.
Beispiele:
ahdAlthochdeutsch./mhdMittelhochdeutsch. varn ‘sich fortbewegen’ > nhdNeuhochdeutsch. fahren ‘sich mithilfe einer antreibenden Kraft fortbewegen’
mhdMittelhochdeutsch. frum ‘tüchtig, nützlich, gottgefällig’ > nhdNeuhochdeutsch. fromm ‘gottgefällig’
2.4/5 BedeutungsverbesserungVerbesserungBedeutungs-Bedeutungsverbesserung
BedeutungswandelBedeutungswandel mit AufwertungAufwertung.
Beispiel:
ahdAlthochdeutsch. marahscalc ‘Pferdeknecht’ > mhdMittelhochdeutsch. marschalc ‘höfischer oder städtischer Beamter mit bestimmten Aufgaben’ > nhdNeuhochdeutsch. Marschall ‘Träger des höchsten Militärranges’
2.4/6 BedeutungsverschlechterungVerschlechterungBedeutungs-Bedeutungsverschlechterung
BedeutungswandelBedeutungswandel mit AbwertungAbwertung.
Beispiele:
mhdMittelhochdeutsch. wîp ‘Frau’ > nhdNeuhochdeutsch. Weib ‘abwertende Bezeichnung für Frau’
mhdMittelhochdeutsch. Knecht ‘Knabe, junger Mann’ > nhdNeuhochdeutsch. Knecht ‘Diener’
2.4/7 BedeutungsverschiebungVerschiebungBedeutungs-Bedeutungsverschiebung
BedeutungswandelBedeutungswandel mit Austausch von Bedeutungen.
Hauptfälle (nach Schweikle 1996, S. 248 f.):
vom Besonderen zum Allgemeinen, z. B.:mhdMittelhochdeutsch. hövesch/hübesch ‘hofgemäß, gebildet, gesittet’ > nhdNeuhochdeutsch. hübsch ‘angenehm, gefällig im Äußeren’
vom Allgemeinen zum Besonderen, z. B.:mhdMittelhochdeutsch. berillus/berille ‘Beryll (Halbedelstein, aus dem Brillen hergestellt wurden)’ > nhdNeuhochdeutsch. Brille
vom Konkreten zum Abstrakten (oft metaphorischeMetapher Verwendung), z. B.:mhdMittelhochdeutsch. sweric/swiric ‘voll Schwären, eitrig’ > nhd. schwierigmhdMittelhochdeutsch. zwec ‘Nagel aus Holz oder Eisen’ , seit dem 15. Jh.: ‘Nagel, an dem eine Zielscheibe aufgehängt ist’ , dann: ‘das Ziel selbst’ > nhd. Zweck
vom Abstrakten zum Konkreten, z. B.:mhdMittelhochdeutsch. sache ‘Rechtsgegenstand’ > nhd. Sache (jeder konkrete Gegenstand)
3 GraphemikGraphemik: Lehre von der SchreibungSchreibung
3.1 ExistenzweiseExistenzweisen der Sprache
3.1/1 Geschriebene SpracheSprachegeschriebenegeschriebene Sprache und gesprochene SpracheSprachegesprochenegesprochene Sprache – GraphieGraphie und PhoniePhonie – GraphemikGraphemik und PhonologiePhonologie:
Sprachen wie das Deutsche werden auf zweierlei Weise verwendet: als geschriebene Sprachegeschriebene Sprache und als gesprochene Sprachegesprochene Sprache (= ExistenzweisenExistenzweise der Sprache). Der Terminus SchreibungSchreibung = GraphieGraphie bezieht sich auf die AusdrucksseiteAusdrucksseite der ZeichenZeichen in geschriebener Sprache, der Terminus LautungLautung = PhoniePhonie auf die AusdrucksseiteAusdrucksseite der ZeichenZeichen in gesprochener Sprache. Mit der Graphie befasst sich die grammatische Teildisziplin GraphemikGraphemik, mit der Phonie die grammatische Teildisziplin PhonologiePhonologie. Normgerechtes Schreiben (RechtschreibungRechtschreibungOrthographie) ist Gegenstand der OrthographieOrthographieRechtschreibung.
Wissenschaftsgeschichtlich gesehen älter als die Graphemik ist die PhonologiePhonologie = LautlehreLautlehre. Beim Einsetzen einer eigenen SchreiblehreSchreiblehreBuchstabe/BuchstabenlehreBuchstabenlehre war der Terminus »GraphologieGraphologie« schon vergeben (‘Lehre von der Deutung der HandschriftHandschrift als Ausdruck des Charakters’). Daher steht für die Lehre von der SchreibungSchreibung = von der GraphieGraphie kein Terminus zur Verfügung, der formal parallel zum Terminus »PhonologiePhonologie« gebaut wäre (der Vorschlag »GrapheologieGrapheologie« hat sich nicht durchgesetzt). Wir verwenden hier »GraphemikGraphemik« als Allgemeinterminus (‘Lehre von der Verschriftung von Sprache und von den Schreibsystemen’). Der Terminus »GraphemikGraphemik« wird darüber hinaus auch spezieller verwendet, und zwar als Bezeichnung für die ‘Lehre von den Graphemen’ (▶ Nr. 3.2/2). Er entspricht dann der »PhonemikPhonemik« (‘Lehre von den Phonemen’, ▶ Nr. 4.1/2; »PhonemikPhonemik« ist Unterbegriff zu »PhonologiePhonologie«). Es lassen sich die in ▶ Tabelle 2 angeführten terminologische Entsprechungen feststellen:
PhoniePhonie GraphieGraphie PhonologiePhonologie Graphemik i. w. S.Graphemik PhonemikPhonemik Graphemik i. e. S.Graphemik PhonetikPhonetik GraphetikGraphetikTabelle 2: Terminologische Entsprechungen »Phonie« – »Graphie«
(Statt »PhonemikPhonemik« ist auch »PhonematikPhonematik« in Gebrauch, statt »GraphemikGraphemik« auch »GraphematikGraphematik«.) Die PhonetikPhonetik beschäftigt sich als naturwissenschaftlich ausgerichtete Disziplin mit der Lautproduktion, mit den akustischen Abläufen und mit der Lautwahrnehmung. Entsprechend behandelt die GraphetikGraphetik Verschriftungssysteme vor allem unter individuellen, sozialen, historischen und typographischen (die Gestalt der Schriftsymbole betreffenden) Aspekten.
Abweichend von der sonst üblichen Reihenfolge wird hier die GraphemikGraphemik vor der PhonologiePhonologie behandelt, und zwar deshalb, weil die Verfahrensweisen und Begriffsbildungen, die auch in der PhonologiePhonologie zum Tragen kommen (und, wissenschaftshistorisch gesehen, in dieser zuerst entwickelt wurden), erfahrungsgemäß im Bereich der GraphieGraphie anschaulicher eingeführt und dargestellt werden können. Die OrthographieOrthographie umfasst mehr als nur die Ebene der Buchstaben und wird daher in einem eigenen Kapitel (▶ Kap. 9) behandelt.
3.2 Zur Beschreibung der GraphieGraphie
Für die Beschäftigung mit der SchreibungSchreibung (des Deutschen und anderer Sprachen, in denen AlphabetschriftSchriftAlphabet-Alphabetschriften verwendet werden) ist der Begriff BuchstabeBuchstabe zentral. »BuchstabeBuchstabe« wird alltagssprachlich allerdings in (mindestens) zweierlei Sinn gebraucht, wie aus den Antworten auf eine Frage wie »Aus wie vielen Buchstaben besteht (die graphische AusdrucksseiteAusdrucksseite des Wortes) besenrein?« deutlich wird. Wenn die Antwort »neun« lautet, werden BuchstabenvorkommenVorkommenBuchstaben-Buchstabenvorkommen (b, e, s, e, n, r, e, i, n) gezählt, wenn sie »sechs« lautet, BuchstabentypTypBuchstaben-Buchstabentypen (b, e, s, n, r, i). BuchstabenvorkommenBuchstabenvorkommen können jeweils unterschiedliche Formen haben, z. B. a, A, a, a, a; b, b, b, b – sie werden dennoch als zum selben BuchstabentypBuchstabentyp gehörig betrachtet, und zwar deshalb, weil sie jeweils denselben WertWert haben: Gleichgültig, ob ab, Ab, ab, ab, ab, ab, ab, ab … geschrieben wird, immer handelt es sich um die graphische Wiedergabe des ZeichenZeichens ab.
Die Unterscheidung zwischen »TypTyp« und »VorkommenVorkommen« wird häufig auch mit den englischen Termini TypeType und TokenToken (sprich: [taíIp], [t«íUk«n]) benannt. Statt BuchstabentypBuchstabentyp ist der Terminus Graphem gebräuchlich, statt BuchstabenvorkommenBuchstabenvorkommen der Terminus Graph: