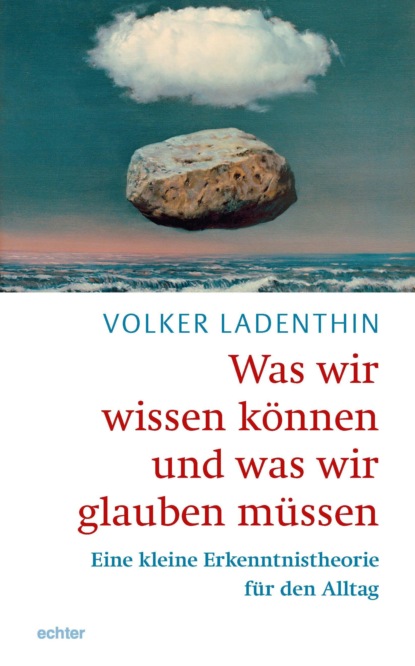- -
- 100%
- +
Nun lassen sich in allen Zeiten Denkmodelle finden, nach deren Deutung die Welt so festgelegt sei, dass die Menschen die Fakten nur noch zur Kenntnis nehmen müssten, um sich nach ihnen richten zu können.
Die unsichtbare Hand
Besonders das 18. und 19. Jahrhundert war fasziniert von dieser Idee. Adam Smith (1723–1790) glaubte, im Marktgeschehen das Prinzip des Fortschritts entdeckt zu haben. Er mühte sich ab, zu zeigen, dass es immer dann besser für die Menschen wurde, wenn Wettbewerb und freier Markt eingeführt worden waren. Erkenntnis führt zu richtigen und moralischen Handlungen. Der Mensch ist frei dazu, das zu erkennen, was auch ohne ihn da ist und ihn bestimmt.
Einsicht in die Notwendigkeit
Ein anderes (zu Adam Smith spiegelverkehrtes) ökonomisches Modell, das des »dialektischen Materialismus«, ist so ausgelegt worden: Der Mensch ist frei dazu, das zu erkennen, was auch ohne ihn da ist und ihn bestimmt. Wir finden es in einem halboffiziellen Wörterbuch der DDR, in dem die Autoren aus der »Lehre von den allgemeinen Entwicklungsgesetzen des Seins« abzuleiten versuchen, was die Partei auf dem nächsten Parteitag beschließen sollte. Im »Philosophischen Wörterbuch« (Berlin [Ost] 1972) der DDR ist auf S. 470 zu lesen:
»Andererseits aber kann das Handeln in philosophisch-soziologischer Sicht nur innerhalb seiner sozialen Determination durch den Gesellschafts- und Geschichtsprozeß und in seiner Wirksamkeit in diesem Prozess verstanden werden.«
Und zur Absicherung zitieren die Verfasser den russischen Journalisten und Philosophen Georgi Walentinowitsch Plechanow (1856–1918), der die »Grundprobleme des Marxismus« (dt.: 1910) aufzulösen versucht hatte:
»Wenn eine bestimmte Klasse im Streben nach ihrer Befreiung eine gesellschaftliche Umwälzung durchführt, so handelt sie dabei mehr oder weniger zielbewußt, und jedenfalls erscheint ihr Handeln als Ursache dieser Umwälzung. Allein dieses Handeln samt all den Bestrebungen, durch die es hervorgerufen wurde, ist selbst Folge eines bestimmten Verlaufs der ökonomischen Entwicklung und wird daher selbst durch die Notwendigkeit bestimmt. Die Soziologie wird zur Wissenschaft nur in dem Maße, in dem es ihr gelingt, das Entstehen der Zwecke beim gesellschaftlichen Menschen (die gesellschaftliche »Teleologie«) als notwendige Folge des gesellschaftlichen Prozesses zu begreifen, der in letzter Instanz durch den Gang der ökonomischen Entwicklung bedingt wird.«
Wer den Gang der bisherigen Entwicklung erkennt, der weiß, was er künftig tun muss. Sein Handeln ist die »Folge« der Entwicklung und wird »durch die Notwendigkeit« der Sachanalyse bestimmt. Der Mensch ist »in letzter Instanz« »bedingt« – also determiniert. Friedrich Engels (1820-1895) hatte allerdings recht vieldeutig geschrieben:
»Hegel war der erste, der das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit richtig darstellte. Für ihn ist die Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit. ›Blind ist die Notwendigkeit nur, insofern dieselbe nicht begriffen wird.‹ Nicht in der geträumten Unabhängigkeit von den Naturgesetzen liegt die Freiheit, sondern in der Erkenntnis dieser Gesetze und in der damit gegebenen Möglichkeit, sie planmäßig zu bestimmten Zwecken wirken zu lassen. Es gilt dies mit Beziehung sowohl auf die Gesetze der äußern Natur wie auf diejenigen, welche das körperliche und geistige Dasein des Menschen selbst regeln – zwei Klassen von Gesetzen, die wir höchstens in der Vorstellung, nicht aber in der Wirklichkeit voneinander trennen können. Freiheit des Willens heißt daher nichts andres als die Fähigkeit, mit Sachkenntnis entscheiden zu können« (S. 106).
Das hätten die griechischen Philosophen der Antike kaum anders formuliert. Denn ohne Sachkenntnis kann man nicht frei entscheiden und handeln, sondern sich nur beliebig verhalten. Weiter mit Engels:
»Je freier also das Urteil eines Menschen in Beziehung auf einen bestimmten Fragepunkt ist, mit desto größerer Notwendigkeit wird der Inhalt dieses Urteils bestimmt sein; während die auf Unkenntnis beruhende Unsicherheit, die zwischen vielen verschiednen und widersprechenden Entscheidungsmöglichkeiten scheinbar willkürlich wählt, eben dadurch ihre Unfreiheit beweist, ihr Beherrschtsein von dem Gegenstande, den sie grade beherrschen sollte« (S. 106).
Dann freilich wird Friedrich Engels undeutlich, weil er sich selbst widerspricht:
»Freiheit besteht also in der auf Erkenntnis der Naturnotwendigkeiten gegründeten Herrschaft über uns selbst und über die äußere Natur; sie ist damit notwendig ein Produkt der geschichtlichen Entwicklung« (S. 106).
Was heißt »gegründet«? Anlässlich oder verursacht? Müssen wir angesichts von Fakten (mit Sachkenntnis) handeln oder können wir unser Handeln aus den Fakten ableiten? Einmal meint Engels dies, einmal meint er das.
Hier unterscheiden sich die Systeme grundlegend. Das eine ist mit dem anderen nicht kompatibel und kombinierbar. Entweder sind wir in unseren Entscheidungen frei oder nicht. Ein bisschen frei geht nicht. Engels erläutert nun seine These am Beispiel; vielleicht bringt diese historische Rekonstruktion Klärung:
»Die ersten, sich vom Tierreich sondernden Menschen waren in allem Wesentlichen so unfrei wie die Tiere selbst« (S. 106)
… was heißt: »in allem Wesentlichen«? Wenn die Menschen »wesentlich« unfrei waren wie die Tiere, waren sie … (Verzeihung) … Tiere. Entweder waren sie »in allem Wesentlichen« (also dem, was das Wesen des Menschen ausmacht) frei, dann waren sie keine Tiere. Oder sie waren wesentlich unfrei, dann waren sie keine Menschen.
Vielleicht meint Engels, dass man von den Dingen abhängig ist, wenn man die Dinge nicht kennt. Klar: Wer seinen PC nicht mit dem WLAN verbinden kann, muss einem Techniker glauben, der ein wenig zaubert und – zack – die Verbindung herstellt. Gegen Honorar selbstverständlich. Wenn man weiß, wie es geht, kann man es selbst machen. Mehr freies Wissen führt zu mehr Handlungsfreiheit. So ähnlich sagt es auch Engels: » … aber jeder Fortschritt in der Kultur war ein Schritt zur Freiheit« (S. 106).
Allerdings: Ist es nicht (auch) umgekehrt? Mit der Entdeckung der Freiheit entstand erst Kultur? Wenn man dem zustimmt, dann folge ich Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) wieder: Je mehr man weiß, desto mehr Entscheidungen kann man fällen. Es geht demnach um drei Freiheitsbegriffe: erstens die Freiheit des Menschen, instinktfrei zu handeln, also frei zu denken. Zweitens die gesellschaftliche Möglichkeit, diese vorauszusetzende Freiheit auch zu gestalten. Drittens die Freiheit, nach Erkenntnis von Naturgesetzen mit diesen (und nicht gegen sie) frei zu handeln (z. B. Medikamente oder tötende Gifte zu entwickeln), die Einsicht in den Zwang (der Naturgesetze) als Möglichkeit anzusehen, sie »planvoll« zu unserem Nutzen einzusetzen.
Was wir gleichwohl in den Formulierungen des DDR-Lexikons lesen konnten, ist der Versuch der radikalen Revolutionäre, den uralten Glauben an den guten Sinn des Seins zu beerben, so, wie er in der Antike formuliert worden war. Die Genesis legte bereits die Beschlüsse des XXIII. Parteitags fest.
Triebwerk
Wenn man das Weltgesetz erkannt hat, dann muss man nur noch gemäß diesem Gesetz handeln. Der gleiche Gedanke findet sich auch bei den Vulgärdarwinisten: Man stellte fest, dass in der Natur immer der Stärkere, der Gesündere, der Angepasstere siegt – und so leitete man daraus ab, dass es auch so sein soll. Selbst bei einem so modernen Autor wie Sigmund Freud (1856–1939) stoßen wir 1938 auf die Auffassung, man könne alles menschliche Handeln auf eine zu erkennende Grundgröße zurückführen, die dem Menschen keine Wahl lässt, sondern ihn letztendlich antreibt:
»Die Kräfte, die wir hinter den Bedürfnisspannungen des Es annehmen, heißen wir Triebe. Sie repräsentieren die körperlichen Anforderungen an das Seelenleben. Obwohl letzte Ursache jeder Aktivität, sind sie konservativer Natur; aus jedem Zustand, den ein Wesen erreicht hat, geht ein Bestreben hervor, diesen Zustand wiederherzustellen, sobald er verlassen worden ist. (…) Für uns ist die Möglichkeit bedeutsam, ob man nicht all diese vielfachen Triebe auf einige wenige Grundtriebe zurückführen könne« (Abriß der Psychoanalyse, S. 11).
Wenn man den Menschen und seine ihn bestimmenden Grundtriebe erkennt, weiß man, wie man handeln soll. Handeln muss. Aus dem Sein kann man das Sollen und Müssen ableiten. … Hier spricht das Zeitalter der Wissenschaftsgläubigkeit. Der Versuch, aus dem, was ist, abzuleiten, was sein soll. Die Fakten sollen herrschen. In anderen Schriften hat Freud das wesentlich vorsichtiger formuliert:
»Die Schicksalsfrage der Menschenart scheint mir zu sein, ob und in welchem Maße es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. In diesem Bezug verdient vielleicht gerade die gegenwärtige Zeit ein besonderes Interesse. Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, daß sie es mit deren Hilfe leicht haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das, daher ein gut Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe, ihres Unglücks, ihrer Angststimmung. Und nun ist zu erwarten, daß die andere der beiden ›himmlischen Mächte‹, der ewige Eros, eine Anstrengung machen wird, um sich im Kampf mit seinem ebenso unsterblichen Gegner zu behaupten. Aber wer kann den Erfolg und Ausgang voraussehen?« (Das Unbehagen in der Kultur, S. 128 f.).
Basis und Überbau
Das war der Traum der letzten Jahrhunderte: Wir stellen fest, was ist, und leiten daraus ab, was wir tun sollen. Ein solches Handeln wäre dann wirklich nicht mehr postfaktisch. Das wäre faktenbasiertes Handeln, und wenn Sie glauben, das Wort hätte ich mir jetzt gerade ausgedacht, so muss ich Sie enttäuschen. Nein! Es gibt etwas, was sich evidenzbasierte Beratung nennt, einschließlich Homepage. Die Vorstellung: Fakten sagen uns, was wir tun sollen. Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (DNEbM) e.V. schreibt auf seiner Homepage:
»Die Evidenzbasierte Medizin (EbM = beweisgestützte Medizin) ist demnach der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Unter Evidenz-basierter Medizin (›evidence based medicine‹) oder evidenzbasierter Praxis (›evidence based practice‹) im engeren Sinne versteht man eine Vorgehensweise des medizinischen Handelns, individuelle Patienten auf der Basis der besten zur Verfügung stehenden Daten zu versorgen. Diese Technik umfasst die systematische Suche nach der relevanten Evidenz in der medizinischen Literatur für ein konkretes klinisches Problem, die kritische Beurteilung der Validität der Evidenz nach klinisch epidemiologischen Gesichtspunkten; die Bewertung der Größe des beobachteten Effekts sowie die Anwendung dieser Evidenz auf den konkreten Patienten mit Hilfe der klinischen Erfahrung und der Vorstellungen der Patienten. Ein verwandter Begriff ist die Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (›Evidence-Based Health Care – EbHC‹), bei der die Prinzipien der EbM auf alle Gesundheitsberufe und alle Bereiche der Gesundheitsversorgung, einschließlich Entscheidungen zur Steuerung des Gesundheitssystems, angewandt werden.«
Hier kommt es nun wieder, wie eigentlich immer, auf jedes Wort an: Selbstverständlich ist »der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz« Voraussetzung dafür, welche Tabletten oder Therapien ein Arzt verschreibt. Nun äußere ich aber ganz vorsichtig und behutsam: Das war doch immer der Anspruch. Dann ist nicht die Regel neu, sondern nur an ihrer Umsetzung oder Kontrolle mag es hapern. Die Vorstellung nämlich, dass Ärzte bisher und in großer Zahl gewissenlos, unbewusst und krankhaft Gebrauch der gegenwärtig schlechtesten wissenschaftlichen Aussagen machen, scheint mir abwegig. Immerhin schrieb schon der Grieche Hippokrates (460–370):
»Man muss darauf sehen (achten), dass alles, was man zur Behandlung bedingt, auch ja zweckdienlich sei (…). Wo man etwas tun muss, muss man das Mehr oder (das) Weniger bedenken. Denn es macht einen großen Unterschied, ob man dabei nach beiden Seiten hin das richtige Maß trifft oder nicht« (Hippokrates, S. 89).
Hippokrates liegt zusätzlich zum Wissen am rechten Maß. Leitidee ist die Zweckdienlichkeit, nicht die Faktenbasierung. Dass die Fakten stimmen müssen, setzt Hippokrates voraus. Die ärztliche Kunst aber besteht darin, das richtige Maß anzulegen.
Keine Diagnose sagt, was zu tun ist. Als ich in den 1970er Jahren auf einer kleinen Kanareninsel im Urlaub Zahnschmerzen bekam, riet mir der Reiseleiter: »Gehen Sie hier keinesfalls zum Zahnarzt. Kaufen Sie sich eine Schachtel Aspirin und warten Sie, bis Sie wieder zu Hause sind. Und dort gehen Sie zum Arzt.« Das war ein postfaktischer Rat. Kein Faktum sagt, was wir tun sollen. Auch Zahnschmerzen nicht.
Auch nicht, wenn die Götter die Fakten bestimmen. Wer glaubt, sein Handeln sei faktenbestimmt und damit (darf ich einmal so formulieren?) präpostfaktisch, macht sich etwas vor. Das hat zwei Gründe: einen anthropologischen und einen handlungslogischen Grund.
Über Rom und einige Wege
Zuerst möchte ich den handlungslogischen Grund betrachten, warum wir aus Fakten oder Zielen keine Handlungen ableiten können. Da ich keinerlei Scheu vor einfachen Beispielen habe (weil sie oft das Problem eines Sachverhalts deutlicher darstellen als komplizierte Beispiele), wählen wir als Beispiel eine Reise nach Rom. Sie steht unumstößlich fest und ist ein nicht in Frage zu stellendes Faktum: Wir wollen nach Rom. Nun stellt sich die Frage, wie wir nach Rom kommen, und es besteht die Erwartung, wir könnten dies aus dem Faktum, dass wir nach Rom wollten, ableiten. Zwingend ableiten, so dass jeder unserer Entscheidung folgen muss. Gewissermaßen mit gesetzmäßiger Kraft, so, wie wir aus dem Faktum, dass zwei plus zwei genau vier ergibt, ableiten können, dass gilt: 4 – 2 = 2. Daran ist ja auch nicht zu rütteln.
Wie kommen wir nach Rom? Mit dem Flugzeug, dem Zug, dem Fernbus, dem Auto, dem neuen E-Bike oder zu Fuß. Wie auch immer man sich nun entscheidet, keine dieser Entscheidungen ist aus dem Satz abgeleitet, dass wir nach Rom wollen. Es sind Nebenentscheidungen, die wir hinzuziehen. Wir wollen schnell nach Rom, weil es Karsamstag ist und wir den Papst Ostern auf dem Petersplatz erleben wollen: Da verbieten sich Fußmarsch und Radtour. Sollten wir aber lieber etwas für unsere Gesundheit tun wollen und haben Zeit, dann verbieten sich Flugzeug, Auto, Bus und Bahn. Haben wir wenig Geld zur Verfügung, wird man vielleicht den Fernbus nehmen oder per Anhalter fahren. Entscheiden wir uns für die Bahnfahrt, weil sie recht schnell geht und umweltverträglich ist, so haben wir zwei Nebenentscheidungen eingeführt, die sich keineswegs zwingend aus der Absicht, nach Rom zu fahren, ergeben. Aber es wird noch komplexer: Wenn wir mit der Bahn fahren, können wir einen Zug am Tag oder den Nachtzug nehmen. Und dann können wir überlegen, ob wir die etwas teurere schnelle Verbindung nehmen oder eine preisgünstige langsame. Wollen wir Sitzplätze reservieren und dabei lieber am Fenster sitzen oder im Gang, Großraum oder Abteil? Nebenentscheidungen implizieren weitere Nebenentscheidungen.
Man könnte sehr lange noch so weiterfragen (und den Zug verpassen), und man könnte es nicht nur, man tut es auch, wenn man handelt. Keine der Handlungen ist aus der ersten Entscheidung, aus dem Faktum, abzuleiten, obwohl alle Entscheidungen auf dieses erste Faktum bezogen bleiben. Handlungen – so nun die Regel – können nie und nimmer aus Fakten abgeleitet werden, und zwar deshalb nicht, weil unzählige Nebenentscheidungen einfließen, die mit der Zielentscheidung in keinem notwendigen Zusammenhang stehen. Insofern gilt er wirklich, der schöne Satz, dass alle Wege nach Rom führen. Aber welchen Weg wir wählen werden, lässt sich aus dieser Volksweisheit nicht ableiten.
Transfer
Selbstverständlich gilt dieser Lehrsatz der Handlungslogik auch für politische Entscheidungen. Sicher wünschen wir uns alle, dass Friede auf Erden sei. Und nun stellen wir fest, dass es um den Weltfrieden nicht so bestellt ist, wie wir es uns wünschen. Das sind die harten Fakten. Aber folgt nun daraus, wie wir den Frieden sichern? Frieden schaffen ohne Waffen? Abschreckung? Wehrhafte Demokratie? Aber wo verteidigt man die? Auch außerhalb der Landesgrenzen? Wäre das Verhandeln nicht die einzige Möglichkeit, eine Möglichkeit allerdings, die von einer weiteren Gruppe als »Appeasement-Politik« beurteilt wird, als falscher Umgang mit aggressiven Regierungen? Zu all diesen Möglichkeiten gibt es Argumente, und zu diesen Argumenten gibt es wieder Argumente usw. usw. usw. Aus dem Faktum »Wir leben in friedlosen Zeiten« lässt sich nicht ableiten, welche Maßnahme die beste ist, um Frieden zu sichern. Es ist umgekehrt, es ist wie bei der Romreise: Wir müssen alle Nebenentscheidungen mitbedenken und uns dann für die beste aller Möglichkeiten entscheiden, die dem Ziel des Friedens am nächsten kommt. Das Ziel gibt nicht den Weg vor, sondern wir überprüfen mögliche Wege, ob sie zum Ziel führen.
Noch ein Transfer? Bitte schön!
Bildungsungerechtigkeit sei ein Faktum – und deswegen müssten wir mehr Gesamtschulen einrichten! Oder aber sollte man den Ganztag verbindlich machen? Klassen verkleinern? Schüler-Bafög reaktivieren? Die Eltern fördern? Inklusion? Oder Individualförderung? Das Niveau senken? Die Schulzeit verlängern? Bildungsgutscheine vergeben?
Alle diese Maßnahmen werden sicherlich Folgen zeitigen – aber welche Maßnahmen wir ergreifen, hängt davon ab, wie viel Geld der Staat investieren will, ob die Eltern mitmachen, was Pädagogen empfehlen, welche Erfahrungen wir bisher mit welchen Maßnahmen haben, ob privat vor Staat geht oder umgekehrt, usw. usw. usw. Wir müssen weitere Argumente anfügen, um eine Entscheidung zu begründen. Wir ziehen Nebenentscheidungen heran, die nicht aus Zielvorgaben oder Fakten abzuleiten sind. Die sich aber auf Ziele und Fakten beziehen.
Das heißt nun keinesfalls, dass Entscheidungen beliebig sind. Es heißt nur, dass sie nicht aus Fakten oder Zielen ableitbar sind. Am Ende muss unsere Entscheidung wasserfest begründet sein, nachvollziehbar, evident. Fakten helfen uns dabei, sind aber nicht der Grund. Und das hat einen weiteren, nämlich den angekündigten zweiten Grund:
Vive la liberté – nur in Freiheit handelt man!
Aus Fakten lassen sich keine Handlungsnormen so stringent ableiten wie aus mathematischen Grundsätzen praktische Anwendungen. Auch das Regelkreismodell funktioniert zuverlässig nur beim Kühlschrank, nicht aber im Leben: Missstand



Der Grund liegt darin, dass wir Menschen keine Thermostate sind, sondern Vernunftwesen, die Fakten schaffen, auslegen, verstehen und schließlich bewerten. Warum wir das können, weiß kein Mensch; dass wir es können, muss man voraussetzen.
Daher die notwendige Unterscheidung: Wenn der Mensch unfrei wäre, verhielte er sich auf Grund von Fakten (wie die Tiere, die auf Grund von Signalreizen reagieren, so dass wir sie dressieren können). Da der Mensch frei ist, handelt er angesichts von Fakten (weshalb man Menschen nicht dressieren kann; nicht mal die Konditionierung klappt so, wie Strafgesetzbuch und Werbeindustrie sich das wünschen).
Sind wir frei? Ich sage an dieser Stelle (mehr in meinem Buch »Mach’s gut? Mach’s besser!«) knapp »ja!« und schiebe die kürzeste Begründung nach, die es gibt: Wären wir unfrei, lohnte es sich nicht, die These zu bezweifeln, dass wir frei sind. Ohne eine vorausgesetzte Freiheit des Menschen sind alle Bücher sinnlos, alle Gedanken und alle Pläne. Denn wenn wir unfrei wären, dann bräuchten wir nicht zu denken; dann kommt alles, wie es kommt. Sobald wir aber unsere Beine aus dem warmen Bett in die eisige Morgenluft schwenken, gehen wir davon aus, dass wir frei sind. Wir alle leben immer, »als ob« wir frei wären.
Im Hinblick auf Erkenntnis sind wir frei, alle Fragen zu stellen, um uns Antworten anzuhören. Wir können nach allem fragen, wir können alles erkennen wollen. Diese Fragen sind nicht vorgegeben – und wären sie es, dann würden wir sie sowieso genauso stellen. Wir sind folglich immer auf der richtigen Seite, wenn wir Freiheit voraussetzen: Weil wir alles wissen wollen können, sind wir frei, alle Fragen zu stellen. Das kann kein Tier.
Wir handeln anlässlich von Fakten, aber nicht auf Grund von Fakten. Das war immer so oder jedenfalls fast immer: Ich habe ja einige Theorien vorgestellt, die glaubten, das Handeln aus den Fakten ableiten zu können. Man nennt dies in der Fachsprache den naturalistischen Fehlschluss. Die postfaktische Gesellschaft macht diesen Fehlschluss nicht.
Aber wie handeln wir richtig? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch klären, was Fakten sind. Ich hoffe, ich schaffe das in überschaubarer Zeit. Aber bis zum letzten Kapitel des Buches müssten Sie sich schon gedulden. Dann versuche ich zu erklären, wie wir handeln können – und wie wir handeln sollen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.