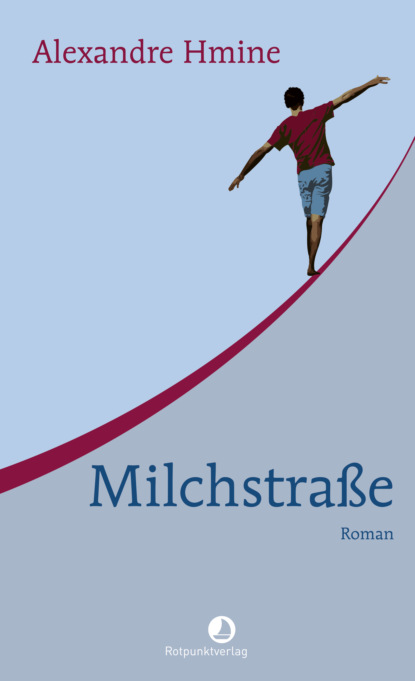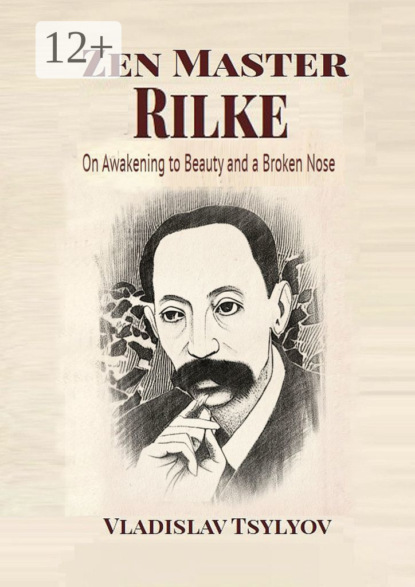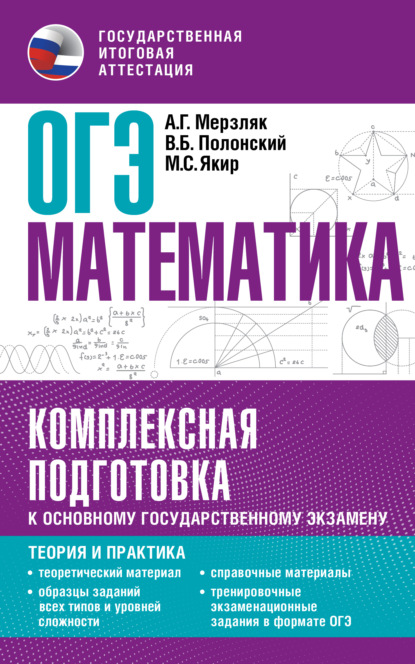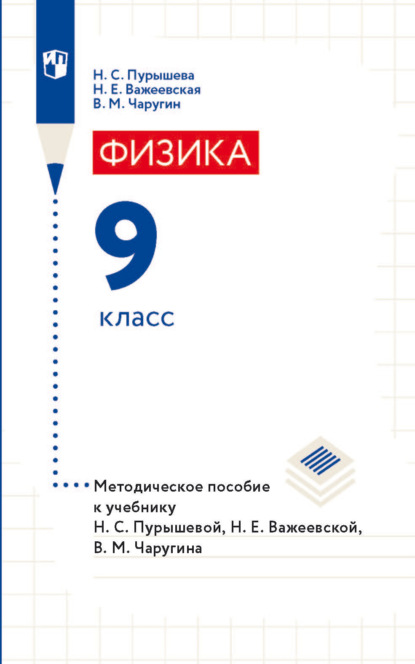Die Annonce

- -
- 100%
- +


Paul, 46, ist Bauer in der Auvergne. Mitten im Nirgendwo, auf tausend Metern Höhe, betreibt er den familieneigenen Hof. Nur will er nicht wie seine beiden alten Onkel als Junggeselle enden und gibt eine Annonce auf.
In einer tristen Industriestadt am anderen Ende Frankreichs hat Annette, 37, gerade eine gescheiterte Beziehung mit einem straffälligen Alkoholiker hinter sich. Einen Vater im Gefängnis möchte sie ihrem elfjährigen Sohn Éric nicht auch noch zumuten, und sie reißt die Annonce aus der Zeitschrift aus.
Nach ersten Treffen auf halber Strecke hat Annette außer ein paar Fotos von einer unbekannten Welt besonders Pauls Hände vor Augen – Hände, die auf sie warten. Sie geht das Wagnis ein und zieht mit Éric und ein paar Möbeln aufs Land. Doch der Empfang ist frostig. Pauls sture Onkel und seine Schwester Nicole lassen die beiden Neuankömmlinge unmissverständlich spüren, dass auf dem Hof kein Platz für sie ist.
Mit plastischer, rhythmischer Sprache und einem untrüglichen Gespür für Seelenzustände erzählt Marie-Hélène Lafon, wie die Ankunft der Fremden in der bäuerlichen Bergwelt allen Beteiligten etwas abverlangt – und, trotz allem, eine leise Liebe geschieht.
Marie-Hélène Lafon
Roman
Aus dem Französischen
von Andrea Spingler
Edition Blau im Rotpunktverlag
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des Institut français.

Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016-2020 unterstützt.
Die Originalausgabe ist 2009 unter dem Titel
L’Annonce bei Buchet/Chastel erschienen.
© 2009, Libella, Paris
© 2020 Edition Blau im Rotpunktverlag, Zürich
(für die deutschsprachige Ausgabe)
www.rotpunktverlag.ch
www.editionblau.ch
Lektorat: Daniela Koch
eISBN 978-3-85869-893-3
1. Auflage 2020
Papier ist geduldig.
Was man ihm auflädt, trägt es.
Sprichwort
Für Jacotte und Marcus
Annette schaute in die Nacht. Sie begriff, dass sie sie nicht gekannt hatte, bevor sie nach Fridières kam. Die Nacht von Fridières senkte sich nicht, sie zog auf wie ein Sturm, ergriff die Häuser die Tiere die Leute, sie brach von überallher gleichzeitig ein, breitete sich aus, ertränkte in ihrer Tinte die Konturen der Dinge, der Körper, verschlang die Bäume, die Steine, verwischte die Wege, radierte alles aus. Die Scheinwerfer der Autos und die Straßenlampe der Gemeinde durchdrangen sie kaum, streiften sie nur, vergeblich. Sie war voll von blinden Wesenheiten, die sich kundtaten durch Geraschel Geknister Gefauche, die Nacht hatte Hände und einen Atem, sie ließ den losen Fensterladen und die schlecht verschlossene Tür schlagen, sie hatte einen abgrundtiefen Blick, der einen durch die Fenster in die Zange nahm und nicht mehr losließ, die Menschen, die in die erleuchteten Zimmer der lächerlichen Häuser geflohen, verkrochen waren. Am Anfang, im Juni, im Juli, war alles so neu gewesen in diesem verblüffenden Landstrich unter dem ungezügelten Licht, dass Annette nichts gesehen, nichts gespürt hatte. Außer an einem Abend; später im Winter, im schwärzesten Februar, hatte sie sich an jenen Montag im Juli erinnert, als das einzige richtige Gewitter dieses ersten so trockenen und so heißen Sommers tobte. Gegen fünf hatte Paul gesagt, das würde ernst werden, man müsse den Stecker vom Fernseher rausziehen, einmal, man wusste nicht mehr, in welchem Jahr, hatten die Onkel einen neuen Apparat anschaffen müssen. Das Gewitter war für Annette und Éric ein neues und wildes Schauspiel gewesen, sie hatten in dem vom Schatten verschluckten Zimmer gewartet, in sicherem Abstand zu den drei Fenstern, deren Scheiben zitterten, sie hatten gewartet und die von heftigen Zuckungen befallene und in einem brutalen, dichten, grauen, waagrechten Regen absaufende Landschaft nicht wiedererkannt. Paul war etwas früher vom Stall hochgekommen und hatte sich gefreut, kein gemähtes Gras und keinerlei Ernte mehr zu haben, die den Launen des Wetters ausgeliefert wären; er hatte die Deckenlampe angeschaltet und von den Tollheiten der Hündin Lola erzählt, die bei jedem noch so bescheidenen Gewitter sonderbar überschnappte; sie war in dem Moment unten, geflohen, ein Häufchen Elend, zusammengekauert unter dem Ausguss der Abstellkammer, die sie ungeniert verwüstet hatte, um sich in der hintersten Ecke zu verkriechen. Man hatte gelacht und zerstreut gegessen, während man die Blitze zählte und Paul die Geschichte zum Besten gab, wie die Onkel, als sie jung waren, den Feuerpfeil des Blitzes quer durch die große Stube hatten schießen sehen, von der Tür zum Fenster gegenüber, das aus dem wurmstichigen Rahmen gerissen worden war. Von diesem Gewitter mit dem Feuerpfeil, der ihnen auf der oberen Wiese drei Jungtiere getötet hatte, sprachen beide Onkel stets mit den gleichen von heimlicher Ehrfurcht erfüllten Worten. Kurz vor acht steigerte sich das Getöse noch, nach einigen warnenden Unterbrechungen ging das Licht aus, und Paul zündete überlegen die drei Kerzen an, die er, als man sich zu Tisch setzte, aus der Vorratsschublade geholt hatte. Éric sorgte sich um Lola, man merkte, dass er auf der Lauer lag, dass ihn das unerwartete Ausbleiben der Hündin verunsicherte. Sie hatten sich vom ersten Tag an verstanden; vom ersten Abend an hatte Éric Lola in den Arm nehmen können, zum größten Leidwesen Nicoles, der Schwester von Paul, die sich hinter ihren glatten Stirnfransen im Stillen gewundert hatte, dieses störrische Tier derart erobert eingenommen umschlungen zu sehen, das man nur mit unendlicher Mühe hatte erziehen können und das man nicht durcheinanderbringen sollte, indem man zu viel mit ihm herumspielte, jetzt wo es anfing, zu den Kühen zu gehen, wie es sich gehörte, und sich nützlich zu machen, was ja die Rolle der Tiere auf einem Bauernhof war; der Junge müsste es verstehen, auf dem Land arbeiteten die Tiere, dafür ernährte man sie und nicht für nichts oder nur für ihre Gesellschaft wie in der Stadt, wo man vielleicht die Mittel hatte. Am Tag nach dem großen Gewitter, nach einer kurzen, von einsamen Wachphasen zerhackten Nacht neben dem in tiefen Schlaf versunkenen Paul hatte Annette sich gewundert, alles an seinem Platz zu finden, die Bäume im Hof, das Gartentor, das Schuppendach, die kaum zerzausten Phloxbüschel und weiter weg, Richtung Le Jaladis, das Wispern der unerschütterlichen Wälder. Wie diesem apokalyptischen Gewitter war Annette den Herbst- und Winternächten zunächst hilflos ausgeliefert. Sie hielt stand, sie wollte nicht davongerissen werden, sie würde es nicht; Paul beharrte auf seinen drei nackten Fenstern, ohne Vorhänge, ein Luxus, den man sich in einem Landstrich, wo jeder Wert darauf legte, nicht gesehen zu werden, nur deshalb leisten konnte, weil das Haus am Ausgang des Weilers lag und man gegen den Rat der Familie in den oberen Stock, also in die Scheune gezogen war. Die Fenster zu verhüllen, mit Vorhängen zu beladen, begriff Annette, wäre für Paul ein schweres Zugeständnis an die herrschenden Sitten und für sie das Eingeständnis einer Niederlage. Man musste es ertragen und den nötigen Beistand in den gewohnten, wiederholten Gesten einer bis zu diesem unausweichlichen Moment aufgeschobenen Arbeit finden, vielleicht auch in Éric, der um fünf aus der Schule kam, oder notfalls im bequemen Gebrabbel des Fernsehers. Das hätte sie sich nie vorstellen können, diesen Kampf gegen die rasende Flut, die ab Mitte des Nachmittags rundherum anstieg und nicht zurückging, nicht nachließ. Man hatte keine Möglichkeit, sie einzudämmen, es war organisch und souverän, brutal und unwiderruflich. Annette schaltete die Lichter an und hatte eine klobige, gelbe Nachttischlampe ans mittlere Fenster gestellt, das nackteste, das nur auf Wiesen und Wald hinausging, auf dieses dichte Gewoge, dessen bloßer Anblick ihr zu manchen Stunden Schauder über den Rücken jagte. An den ersten Abenden sagte Paul nichts, dann fragte er warum, warum am Fenster diese Lampe, die er von den Schuppen aus sah. Annette hätte gern erklärt, erzählt; von Bailleul oder Armentières, den Kleinstädten, in denen sie aufgewachsen war, wo sie gelebt hatte, und von der öffentlichen Beleuchtung, die, und sei sie dürftig, die Nacht in Schach hielt durchdrang zerriss, auch wenn diese, gescheucht, in die Enge getrieben, noch in manchen abgelegenen Straßen, wo die neusten Annehmlichkeiten fehlten, Zuflucht fand. Annette hätte gern, aber stets fehlten die Worte. Sie hatte nur von einer Möglichkeit, das Haus anheimelnd zu machen, und von einem von ihrer Mutter übernommenen Brauch geredet. Später hatte sie an die zusätzlichen Kosten gedacht und vor allem an Nicole, der die Lampe auffallen und die gegenüber den Onkeln ihre Bemerkungen machen würde. Man erführe davon, die Onkel würden etwas sagen; nicht fragen. Sie stellten Annette und Éric keine Fragen, sie redeten mit ihnen, als wären sie weit weg, und schienen auf etwas anderes zu blicken, durch ihre beiden fremden Körper hindurch, die von anderswoher gekommen waren, aus dem Norden aus der Welt aus der Stadt, aufgrund des radikalen Wollens und sonderbaren Tuns ihres Neffen Paul, der nicht ohne Frau hatte bleiben können. Es war nicht sein erster Versuch. Nachdem er sich hier und da auf den Tanzfesten herumgetrieben hatte, wie es die jungen Leute machen, hatte er, noch bevor er dreißig wurde, den Onkeln bedeutet, dass er ihnen in diesem Punkt nicht nacheifern werde, um allein mit seiner Schwester in Fridières zu enden, im eigenen Saft. Durch Nicole oder durch ihn oder auch durch sie beide würde neues Blut ins Haus kommen; und er hatte eine zwanzigjährige Sandrine vorgestellt. Für sie, eine Postbeamtentochter, die in Aurillac zur Krankenpflegerin ausgebildet wurde, hatte er kurz entschlossen die Scheune aufgerissen und oben die Wohnung eingebaut, Tag und Nacht schuftend, beinahe zwei Jahre in seine Baustelle vergraben, wenn er nicht im Stall oder auf der Weide oder auf dem Traktor war. Das Fräulein, denn ein Fräulein war sie, zierlich, quecksilbrig, lustig, mit hoher Stimme, würde sich in Fridières selbstständig machen und unaufhörlich kreuz und quer durch den Kanton fahren, wo die immer zahlreicheren und immer vernachlässigteren Alten bestimmt alle gern ihre Dienste bemühen würden. Die Onkel, wenig daran interessiert, mit einem sich in Sicherheit wiegenden Neffen über dieses delikate Kapitel zu streiten, ließen die Jugend träumen und waren nicht so grausam, offen zu triumphieren, als Sandrine, zum Praktikum in Brive, sich in einen ordentlichen Apotheker verguckte. Der Winter war streng; verstört wurde Paul dreißig und bestand darauf, allein in den auf eine andere Nutzung zugeschnittenen großen Räumen zu wohnen. Im Frühjahr wurde er wild und ließ seine Wut an der Arbeit und an den überholten Methoden der Onkel aus, die wie mittelalterliche Rüpel vorgingen und sich unterordnen oder zurückziehen sollten. Man sträubte sich, man drohte, man sprach scharfe Worte; Paul stieß auf Widerstand, Nicole lieferte ihre Nummer ab, das Gespann wankte. Die Nachbarschaft, eingeweiht, wenn auch dünn gesät, zählte die Punkte, bis im Lauf des nächsten Winters die Auseinandersetzung zu einem sehr vorhersehbaren Status quo gerann, denn alle vier, Junge und Alte, waren ja hier, zwischen Wald Ackerland Tieren und Gehöft, lebenslang, so lernten Paul und Nicole, gefesselt festgehalten eingebunden und vorsintflutlichen Kräften ausgeliefert, die sie nicht hätten benennen können. Auch wenn Paul sicherlich andere Liebschaften hatte, sagte er darüber nichts und schien in die leidigen Vierziger als resignierter Junggeselle einzutreten. Die stumme Verblüffung der Onkel wurde daher nur noch von der Nicoles übertroffen, als er mit sechsundvierzig am ersten Sonntag im April, und zwar am Palmsonntag, Nicole erinnerte sich, nach dem Kaffee in drei Sätzen verkündete, er werde im Frühjahr einige Renovierungsarbeiten im oberen Stockwerk vornehmen, wo Ende Juni Annette zu ihm ziehen würde, eine siebenunddreißigjährige Frau aus Bailleul im Norden, mit ihrem elfjährigen Sohn Éric, der im September ins Collège von Condat käme.
Im Juni war das Land eine Pracht, ein Wahnsinn. Die beiden Linden im Hof, der Ahorn in der Ecke des Gartens, der Flieder an der Mauer, alles rauschte wisperte wogte, war angeschwollen von grünem Licht, glänzend, fast schwarz in den schattigen Winkeln, eine unglaubliche Herrlichkeit, die einen an Tagen mit leichtem Wind packte, einem die Sprache verschlug, die Worte blieben schwächlich, unhörbar im Hals stecken. Wortlos, perplex stand man in dem üppigen Leuchten. Das geschah seit jeher, dieses Zusammenströmen im Juni, diese Vereinigung der Kräfte, Licht Wind Wasser Blätter Gras Blumen Tiere, um den Menschen, den Zuschauer, den verirrten, in seine enge Haut eingezwängten, kleinwinzigen Zweibeiner zu überwältigen. Das Auge ermüdete, weil es nichts erfasste; Gerüche stiegen auf, nach Heu nach schwarzer Erde nach schweren Tieren auf zertrampelten Wegen. Die Autotüren krachten ins Bellen der Hündin Lola, die zu Füßen ihres Herrchens zappelte, von ihm gebändigt, daran gehindert zu schnüffeln und die Fremden zu feiern, wie sie es gern tat, freundlich, die Schnauze von einem rosa-weißen Lächeln geschlitzt, in ununterdrückbare Lebhaftigkeit ausbrechend, sobald ein Fahrzeug ihr den Gefallen tat, im Hof anzuhalten und seine kostbare Fracht abzuladen. Der Hof war leer, von grünem Wind umspielt, von neuer Sonne geblendet. Zunächst beruhigte Paul die Hündin, sprach zu ihr, sagte zu ihr, das ist Annette, das ist Éric, sie werden hier mit uns leben. Zu dritt blieben sie in dem wahnwitzigen Licht stehen. Die Hündin leckte die Hände des Jungen, der sich nicht rührte und mit großen Augen alles in sich aufnahm, den Hof die Bäume das schwarze Loch des alten Brotofens, wo das Werkzeug aufbewahrt wurde, und die Kaninchenställe an der hinteren Mauer. Er ging auf die bekannten Tiere zu, stellte sich vor ihnen auf, plötzlich ganz versunken in den Anblick ihres Hoppelns und Wühlens und sonstigen unerklärlichen Treibens. Die Hündin hatte von ihm abgelassen, um sich der Frau zuzuwenden, deren Knöchel und weiße Waden natürlich Aufmerksamkeit verdienten, umstanden wie sie waren von Koffern, Taschen, Kartons, die der Mann, das Herrchen, energisch packte, und nun verfielen beide, Mann und Frau, in gemeinsame Betriebsamkeit zwischen Auto und Haus, Haus und Auto, während der Junge ihnen den Rücken zukehrte, der Nacken blass und gebeugt, die Arme lang am Körper. Die Frau machte sich eifrig, emsig zu schaffen, damit alles getan war, damit alles hineingetragen, untergebracht war, ehe sie ganz offiziell den Onkeln und der Schwester vorgestellt wurde, die sich in der Küche versteckten und die sie kennenlernen, zu sehen bekommen würde; Paul hatte von ihnen gesprochen, zuerst in kurzen, knappen Sätzen, gleich beim ersten Mal am Telefon und dann, als sie sich sahen, er hatte gesagt, er lebe nicht allein auf dem Hof, sondern mit seiner Schwester Nicole, elf Monate jünger als er, und den Onkeln, dem älteren Louis und Pierre, achtzig und einundachtzig, denen das Land mit den Gebäuden gehörte und die immer da gelebt hatten, da geboren waren. Er hatte erklärt; Nicole kümmerte sich für die drei Männer um alles im Haus, sie hatte einen Führerschein, sie war sehr unabhängig und brachte auch die Onkel, die nie gute Autofahrer gewesen waren, zum Arzt oder zur Bank. Die anderen Alten des Weilers und der Umgebung, die keine Kinder in der Nähe hatten, verließen sich auf sie, wenn sie im Lebensmittelladen einkaufen wollten, was man am Wagen von Vater Lemmet nicht bekam, oder Arzneimittel beispielsweise. Bei ihrem Treffen in Nevers hatte er viel von seiner Schwester gesprochen. Sie war wie sein Zwilling, ihre Eltern hatten beide zusammen, mit sechzehn und siebzehn, bei den Onkeln gelassen, die unverheiratet waren und keine Kinder hatten. Sie waren es schon gewohnt, sie verlebten alle Ferien in Fridières. Die Eltern brachten sie da unter, der Vater arbeitete im Straßenbau, und die Mutter war überfordert mit den fünf, zwei Jungen, drei Mädchen, die danach kamen, das waren zu viele Kinder am Hals für einen Straßenarbeiterlohn und hier und da eine Putzstelle; die Mutter konnte nicht dauernd weg sein, bei anderen, sie hatte schon zu Hause mehr als genug zu tun, und die beiden, Paul und Nicole, waren zu früh zu schnell gekommen; Mutter und Vater waren neunzehn und zwanzig, wegen Paul hatten sie eilig heiraten müssen, das war selten damals, niemand hatte sich gefreut, es war eine traurige Hochzeit; überstürzt hatte man eine kleine Landwirtschaft gepachtet, dann hatte der Vater diese Stelle als Straßenarbeiter gefunden, die ihm zusagte, er mochte die Landarbeit nicht, schon gar nicht die mit Tieren. Man hatte im Dorf gewohnt, in einem feuchten, kalten Haus, die anderen Kinder wurden geboren, drei Jahre nach Nicole, eins alle achtzehn Monate oder fast. Paul erinnerte sich, er spuckte all das in Brocken, in erratischen Blöcken aus, als wäre er selbst bestürzt, sich auf seine alten Tage so vollgepackt mit schroffen Bildern zu entdecken. Sie hörte zu, schaute ihm dabei ins Gesicht, schaute auch auf seine flach daliegenden Hände, die kräftig, lang, dennoch breit, stark und erstaunlich gepflegt waren; sie würde es später in Fridières verstehen, wenn sie sah, wie er sie mehrmals am Tag unter dem Wasserhahn der Spüle wusch, um und um drehte, als massierte er sie, und es nie versäumte, bevor er wieder in den Stall, auf die Weide oder in die Scheune ging, sie mit einer grauen Salbe einzureiben, die er Melkfett nannte und mit der er auch die Kuheuter einschmierte. Das würde sie lernen, das Melkfett und das empfindliche Euter der Kühe. Als er in Nevers so redete, zutraulich und gierig, die Hände ruhig, hatte sie gespürt, dass sich etwas tief, ganz tief in ihrem Bauch zusammenzog; vor allem, als er sagte, seine Schwester und er, Nicole und er, seien bei den Onkeln gelassen worden wie die Jungen eines zu großen Wurfs. Die Mutter war nicht sehr alt, sie lebte noch, nach einem Schlaganfall geistig verwirrt, in einem Altersheim in Issoire, wo eine jüngere Schwester wohnte. Der Vater war schon lange tot. Die Beziehungen zu den fünf jüngeren Brüdern und Schwestern hatten sich gelockert, sie waren keine Bauern, keiner der fünf, sie hatten Berufe und Häuser und Kinder bei Lyon, Saint-Étienne und Clermont-Ferrand. Ein Bruder und seine Frau hatten den elterlichen Besitz behalten, eine enge muffige Bruchbude im Dorf. Paul, der manchmal mit dem Auto am Haus vorbeifuhr, hielt nicht an, trat nicht ein, auch dann nicht, wenn zwei oder drei Wochen lang im August die Fensterläden auf einen kleinen geteerten Hof geöffnet waren, wo in schnurgerader Reihe vier Töpfe mit Geranien oder Petunien standen. Als die Mutter ins Altersheim kam, war ihnen, den beiden aus Fridières, zusammen eine Waschmaschine und ein Gasherd zugefallen. Paul und Nicole brauchten nichts, sie würden den Besitz der Onkel erben, Land und Gebäude, das stammte von der Seite der Mutter, die auch in Fridières geboren und von da oben weggegangen war, um mit achtzehn schwanger zu werden, einzige Tochter und spät noch hinterhergekommen, nach den vierzehn und fünfzehn Jahre älteren Onkeln; von der Erbteilung zwischen der Mutter und ihren Brüdern redete man besser nicht mehr. Paul und Nicole hatten nicht kämpfen müssen wie die anderen, um sich anderswo, bei Fremden, einen Platz zu sichern, mit einem richtigen Arbeitgeber und einer Miete und den Raten am Monatsende; sie waren da oben untergekommen und mussten sich keine besondere Mühe geben, konnten in Ruhe vor sich hin arbeiten, mit Fernsehen, Auto und allem Komfort; die Bauern lebten jetzt wie alle anderen Leute, selbst in diesen Einöden, und die Onkel, die eingefleischte Junggesellen waren, liebten ihre Bequemlichkeiten, man wusste, dass sie Zentralheizung, Badezimmer und Parabolantenne hatten installieren lassen; man würde nicht Leuten ein Erbteil abtreten, die obendrein all diese Beihilfen für die Berglandwirtschaft einsteckten und dann immer noch Gründe zum Jammern fanden, also wirklich nicht.
Nicole betreute die Alten ganz offiziell, ihre bezahlten Leistungen wurden von einem Verein kontrolliert, der sich im ganzen Departement um die alleinstehenden, isolierten, mehr oder weniger betagten Personen kümmerte, die körperlich und geistig noch so gesund waren, dass sie zu Hause leben konnten. Für Frauen wie sie, ohne Ausbildung und anerkannte Berufserfahrung, war es ein Glücksfall, eine großartige Gelegenheit, die sie zu ergreifen wusste, wobei sie sich nicht scheute, Not kennt kein Gebot, auch unappetitliche oder eigenartige Aufgaben zu erledigen. In ihrer Lage konnte man es sich nicht leisten, die feine Dame zu spielen; sie füllte ihren Terminkalender und besuchte pflichtbewusst ihre Schäfchen, flink, tüchtig, umso dringender erwartet, als sie eine wandelnde Zeitung war und leidenschaftlich über die großen oder kleinen, bedeutenden oder zweitrangigen Angelegenheiten der Gegend diskutieren konnte. Man vertraute ihr, sie würde das Blutdruckmittel nicht vergessen und auch an die drei Salate denken, die verpflanzt werden mussten und mit denen sie in Fridières nichts mehr anfangen konnte bei diesen pedantischen Gärtnern, die die Onkel waren. Nicole kannte die Gepflogenheiten und die Leute, und das war etwas anderes als mit einer Fremden, die nicht gewusst hätte, wie man ins Gespräch kommt, und beim ersten Schnee in Panik geraten wäre. Man verlangte nach ihr, sie wusste es, sie bildete sich etwas darauf ein und blickte von ihrem Sockel einer Frau, die ihr eigenes Geld verdient, auf Annette herab; die Onkel versäumten keine Gelegenheit, sich über ihren Stolz lustig zu machen, indem sie ein ums andere Mal erklärten, sie hätten die beste Krankenschwester und Gesellschaftsdame und kultivierte Vorleserin der ganzen Gegend zu Hause, und ohne einen Cent auszugeben. Jahre bevor die beiden aus dem Norden importierten Fremden nach Fridières kamen, hatte auch schon das Auftauchen der sonderbaren Mimi Caté ihnen einen willkommenen Grund für ewige spöttische Bemerkungen geliefert. Man sollte die Mimi Caté nicht mit der Mimi du Bourg oder der Mimi Santoire des Chazeaux verwechseln, daher die fest in den Sitten verankerte Hinzufügung des durchsichtigen Beinamens Caté, der mit dem Haus verbunden war, seit eine unverheiratet gebliebene Urgroßtante der besagten Mimi in arge Frömmigkeit verfallen und dem Ortspfarrer bei der delikaten Aufgabe zur Hand gegangen war, der Jugend die Anfangsgründe der Religion beizubringen, bevor sie sich mit über vierzig samt Hab und Gut in einem fernen Kloster im Osten Frankreichs vergraben hatte. Von der in unbestimmtem Alter im Weiler aufgetauchten Mimi Caté wusste man so gut wie nichts; man redete von Ruhestand und Scheidung, man erregte sich umsonst, bevor man sich daran gewöhnte, sie allein und nicht sehr liebenswürdig alt werden zu sehen zwischen ihrem winzigen Haus und den eingezäunten, abschüssigen Stücken Land, die es flankierten und die sie energisch und unermüdlich in üppige Gemüsegärten zu verwandeln verstand. Wenn sie nicht die Kinder den Katechismus lehrte, züchtete sie Geflügel und Kaninchen und lebte kärglich, zumindest nahm man es an, von ungewissen Einkünften und vom Verkauf ihrer Produkte, deren ausgezeichneter Ruf sich bald verbreitet hatte; die wohlhabenden Gattinnen der Veterinäre, Ärzte und anderer Notabeln der Umgebung deckten sich bei ihr ein, kamen zu ihr ins Haus, um die vollen Körbe abzuholen, denn dass die griesgrämige Mimi Caté einen Stand auf irgendeinem Markt haben könnte, schien undenkbar. Ohne Gatten ohne Sohn ohne Bruder oder Schwager, ohne irgendeinen männlichen Schutz verblüffte sie ihre Umgebung, stand ihren Mann und ihre Frau gleichermaßen, schlug ihr Holz für den Winter und perfektionierte ihre Kaninchenterrine, meisterlich und auch irgendwie gefürchtet wegen dieses stillen Könnens, das umso unfassbarer war, als sie weder Fernseher noch Radio noch Auto hatte. Man wusste, dass sie La Montagne abonniert hatte, das Echo der Provinz kam einzig auf diesem Weg zu ihr, und von Nicole erfuhr man, dass sie darin in erster Linie die Seiten mit französischer Politik und internationalen Nachrichten schätzte und die Glückstombolas des Altersheims von Riom-ès-Montagne und sonstige dürftige Ergüsse über das Bleu-d’Auvergne-Fest oder die Basketball-Regionalmeisterschaften für dummes Zeug hielt. In ihrem zweiundachtzigsten Lebensjahr sollte die Mimi Caté, ansonsten schlank und kräftig, fest in ihrem Fleisch und stolz in ihrer Haltung, nahezu vollständig erblinden, wahrscheinlich infolge eines leichten Schlaganfalls, den sie nicht wahrhaben wollte. Man fand sie verwirrt auf ihrem Kartoffelacker, sie wurde ins Krankenhaus von Saint-Flour gebracht und kehrte umgehend zurück, organisierte sofort ihr Leben neu, band es enger ans Haus, ans Innere, wie ein Seemann bei Schlechtwetter die Segel refft, und alles ohne Klage, ohne Kommentar, denn sie lebte ohne ein Ohr, das diese gehört hätte. Doch so stark und verrückt die Mimi Caté auch war, sie vermochte nichts gegen die gräulichen Flecken, mit denen die Zeitungsseiten nun für sie übersät waren. Das Schauspiel der Welt entzog sich ihr, und das erschien ihr so unerträglich, dass sie, die störrische Mimi Caté, Nicole bat, ihr einmal täglich zu beliebiger Stunde vorzulesen. Die Sache erregte großes Aufsehen; die eigensinnige Mimi Caté hatte die von der Gemeinde angebotene Haushaltshilfe abgelehnt, war aber bereit, eine Stunde täglich an sechs Tagen in der Woche die Dienste einer Vorleserin zu bezahlen. Nicole, die in zwanzig Jahren Nachbarschaft nie das Haus der Mimi Caté betreten hatte, erzählte, wie perfekt in Ordnung gehalten und wie nackt es war, was für sie eine Abwechslung von den unwahrscheinlichen Drecklöchern darstellte, die sie manchmal bei anderen Altersverwirrten entdeckte, um die sie sich kümmern musste, größtenteils Junggesellen allerdings, die nach dem Tod der Eltern vor lauter Einsamkeit und Alkohol verwilderten. In vier Jahren und acht Monaten Dienst bei der Mimi Caté musste Nicole nicht ein einziges Mal zum Besen, Putzlappen oder Schwamm greifen und niemals ein eventuelles Versäumnis mit dem Kauf einer Kleinigkeit bei Vater Lemmet wettmachen, dem ambulanten Bäcker und Krämer, dessen treue Kundin die Mimi war. Jeden Tag zwischen elf Uhr und Mittag thronte Nicole in der niedrigen, düsteren Küche unter dem Rund der mit einer 100-Watt-Birne ausgerüsteten höhenverstellbaren Hängelampe; vom Licht wie von einem Heiligenschein umgeben, las sie über die gefährlich sinkenden Rohölpreise, die Attentate vom 11. September, die von Madrid und die von London, das beängstigende Vordringen der Chinesen auf dem Textilmarkt und das Zaudern der sozialistischen Partei bei der Aufstellung ihres Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2007. Berauscht von diesem Wortschwall, benommen vom Lärm der zahllosen Länder, verließ sie mittags die Mimi Caté, die sie immer gleich verabschiedete mit einem »danke Nicole«, »bis morgen Nicole« oder »bis Montag Nicole«. An einem Februarmorgen hatte es geschneit es schneite es würde schneien, Nicole wunderte sich, als sie kam, dass die Fensterläden der Küche geschlossen waren. Bereits angezogen, das Bett gemacht, das Haar zum ewigen grauen Knoten gebunden, war die stolze Mimi auf der Schwelle ihres Zimmers gestürzt und lag da, lang und weiß, noch nicht ganz kalt. Man beerdigte sie im schütteren Kreis, man kannte keine Angehörigen von ihr und man sah sie auch nicht, weder in der Kirche noch auf dem Friedhof. Nicole fand im Schlafzimmer auf der Marmorplatte der einzigen Kommode einen nicht zugeklebten Briefumschlag mit einer Summe, die für die Kosten der Bestattung im seit Langem vernachlässigten Familiengrab gerade so reichen mochte. Das Haus wurde geschlossen, es wurde weder besichtigt noch verkauft, und man gewöhnte sich an das zusätzliche Geheimnis um die Mimi Caté. Danach hieß es im Dorf, diesmal hätte die Nicole, die immer so gut kann mit den Alten, nichts abgekriegt. Sie bekam Wind davon, war maßlos gekränkt, wie vernichtet, wärmte die Sache immer wieder auf, ohne dass die Galle sich erschöpfte, sodass Paul im folgenden Winter diese erbärmliche Geschichte mitverantwortlich machen konnte für die unverhohlene Bitterkeit seiner Schwester gegenüber der Welt im Allgemeinen und den beiden Eindringlingen im Besonderen, die er in das geschlossene Reich von Fridières eingeführt hatte.