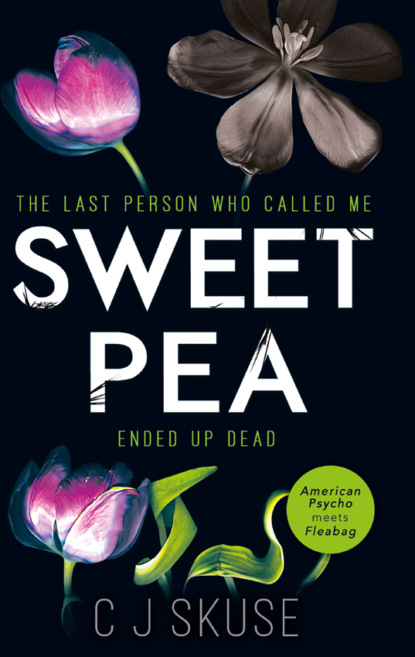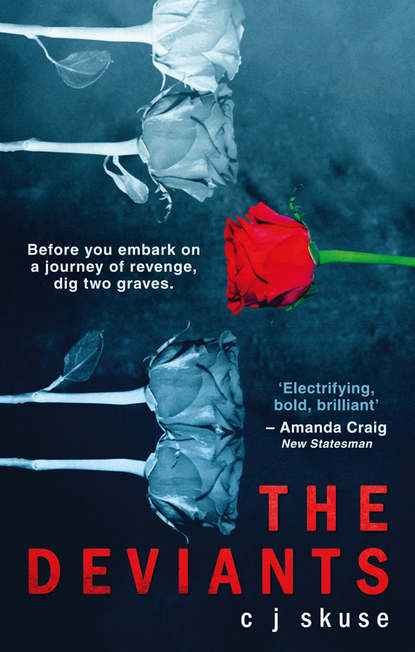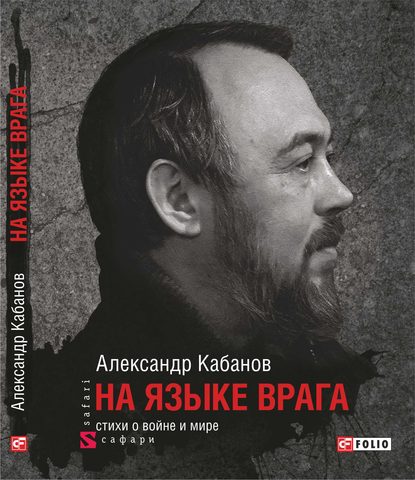Wenn die Nacht stirbt und dein Herz aufhört zu schlagen

- -
- 100%
- +
Das penetrante Klopfen hielt an, während ich mich im großen Spiegel des Badezimmers betrachtete. Als ich das nervige Geräusch nicht mehr aushielt, legte ich mir das Handtuch um die Hüften und stellte mich zur Tür. Als das nächste Klopfen ertönte, riss ich noch währenddessen die Holztür beiseite, doch es war niemand zu sehen.
»Was zum Teufel ist denn hier los?«, schrie ich verärgert, weil mich das Klopfen an die kindischen Telefonscherze aus der Unterstufe erinnerten.
Wütend schlug ich mit der Faust gegen den Türrahmen und knallte die Tür wieder zu. Im Nachhinein erinnere ich mich nicht mehr, wie genau es damals passiert ist. Ich weiß nur noch, dass ich mich plötzlich in einer Menge von Scherben wiederfand, nachdem alle Fensterscheiben im Haus, zur selben Zeit als mein Schrei ertönte, zersprangen. Meine Arme waren mit kleinen Wunden versehen und Blut rann über meine Finger. Schmerzhaft bohrten sich die Glassplitter in meine nackte Haut und ich biss meine Zähne zusammen, als mir die Tränen in die Augen traten. Minutenlang saß ich da wie ein kleines Häufchen Elend, nachdem meine Beine unter mir weggesackt waren. Dann rollte ich mich auf dem Scherbenhaufen zusammen. Das Handtuch war in der Zwischenzeit von meinem Körper gerutscht und gab die Sicht auf meinen vernarbten Rücken frei. Vorsichtig zog ich die erste Scherbe aus meiner Hand und eine Träne löste sich aus meinem Augenwinkel.
Als fremde Stimmen laut wurden, konnte ich nur daran denken, dass ich so schnell wie möglich hier weg sollte. Ohne auf die Qualen und das Blut zu achten, zog ich die Splitter nacheinander aus meiner Haut und zwang meine Beine, aufzustehen. In Windeseile zog ich mir neue Kleidung über und stopfte die alten Klamotten zurück in meinen Rucksack. Ich schulterte meine Tasche und putzte flink meine Zähne, um den ekelhaften Geschmack loszuwerden. Als es wieder klopfte, hatte ich das Gefühl, den Verstand zu verlieren, aber diesmal öffnete sich die Tür von alleine. Im Türrahmen befand sich kein menschliches Wesen, sondern eine dünne schwarze Katze, die mich ansah und unzufrieden miaute. Das Tierchen mit den weißen Augen ließ ihren Schwanz schwingen, machte einen Katzenbuckel und setzte zum Sprung an. Aus Reflex fing ich die Katze auf, die sich mit der Zunge über die Nase strich.
»Wer bist du denn?«, fragte ich und schüttelte im nächsten Moment schon meinen Kopf.
Ich verlor wirklich langsam meinen Verstand, sonst würde ich mich nicht mit einer Katze unterhalten und eine Antwort erwarten. Als ich das eigensinnige Tier absetzen wollte, krallte es sich an meine Kleidung und meine geschundene Haut. Das Fell kitzelte mich an der Nase und ich musste mehrmals hintereinander niesen. Fluchend versuchte ich, das Tier abzuschütteln, doch es gelang mir nicht. Kurz mahlte ich meine Zähne aufeinander und beschloss, die streunende Katze einfach ein Stück mitzunehmen, da ich wieder aufgeregte Stimmen hinter der Tür hörte. Auf schnellsten Weg verließ ich die Pension. Von Menschen, die meinen Weg kreuzten, bekam ich nur einen verwunderten Blick geschenkt, doch niemand hielt mich auf. Zu groß war die Hysterie über das Chaos im Hotel. Mit gesenktem Blick und Kapuze über dem Kopf kam ich an einer Bushaltestelle an. Ich blieb stehen, um die kleine Raubkatze loszuwerden. Glücklicherweise fuhr sie ihre Krallen diesmal nicht aus. Jedoch folgte sie mir, als ich meinen Weg fortsetzte.
»Geh doch einfach!«, bat ich die Katze, aber sie miaute nur und beschleunigte ihre Schritte, um mit mir mithalten zu können.
Stur versuchte ich eine Zeit lang, das Tier zu ignorieren, doch als wir nach mehreren Stunden an einem Bahnhof ankamen und ich mich hinsetzte, um auf den Zug zu warten, legte sie sich auf meinen Schoß. Kaum legte ich ihr die Hand ins Fell, schnurrte sie los und schmatzte zufrieden. Zwei Züge ließ ich unbeachtet ein- und ausfahren. Beim Dritten stieg ich in den einfahrenden Zug. Auch wenn ich meinen Wegbegleiter gewaltsam von meinem Schoß stieß, folgte die Katze mir in das Zugabteil. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Zug gesessen hatte. Wahrscheinlich bei der Auslandswoche in Rom, als wir fast sechs Stunden zusammengepfercht in einem Zugabteil saßen und unsere Lehrerin uns erklärt hatte, wie toll die kommende Woche werden würde. Ohne zu übertreiben konnte man sagen, dass die Woche furchtbar gewesen war. Im Nachhinein verfluchte ich mich selbst, dass meine Mutter mich mit dem Argument überredet hatte, dass alle mitfahren würden und es aussähe, als ob wir es uns nicht leisten könnten, wenn ich nicht mitfuhr. Danach blieb nur die Frage zurück, ob eine Woche auf engsten Raum mit drei anderen Mädchen in einem Zimmer besser war, als meine Mutter mit ihren göttlichen Konsequenzen.
In dem Moment, als ich mich hinsetzen wollte, stützte ich mich am Sitzpolster der Lehne ab. Meine Handfläche erhitzte sich und begann zu glühen. Langsam löste sich der Stoff rund um meine Finger auf, als würde er schmelzen. Der Gestank nach verbrannten Fasern und Plastik kroch mir in die Nase und ich musste würgen. Fasziniert konnte ich für wenige Sekunden nur auf die verkohlten Fäden starren. Als ein richtiges Feuer ausbrach, riss ich meine Hand reflexartig zurück und presste sie geschockt gegen meinen Brustkorb. Doch sie war wieder abgekühlt, als wäre nie etwas passiert. Die Katze machte mit einem lauten Miauen auf sich aufmerksam. Sie saß auf dem Nebensitz, während ihre Augen die Brandstelle und das Feuer reflektierten. Das Tier miaute, als würde es über mich lachen. Schnellstmöglich schnappte ich mir die Katze, deren Schwanz bereits leicht angekokelt war, weshalb sie herzzerreißend quietschte. Panisch klopfte ich auf den Türöffner und stieß erleichtert ein Keuchen aus, als sich die Zugtür öffnete. Ich sprintete zurück auf den Bahnsteig und presste das Kätzchen an meine Jacke, die danach wahrscheinlich einen Staubsauger benötigen würde, um die Tierhaare wieder loszuwerden. Meine langen Haare hingen mir ins Gesicht und Schweißtropfen rannen an meinen Schläfen entlang. Wieder spürte ich diese Angst vor der Zukunft in mir, als ich das Kribbeln in meinen Fingern bemerkte. Ich umklammerte das schwarze Tier und hielt nach einer Bank, auf der ich mich ausruhen konnte, Ausschau.
Ich war erschöpft von der Anstrengung. Der Blutverlust durch die vielen Wunden machte mir zu schaffen. Als ich eine kleine Eisenbank gefunden hatte, setze sich gerade jemand auf die Sitzfläche und erwiderte meinen Blick. Ich blieb angesäuert stehen und wollte mich bereits nach einer anderen Sitzgelegenheit umsehen, als ich die Gestalt genauer begutachtete. Sie war klein und hatte langes, blondes Haar. Ein schwarzes enges Kleid zierte ihren Körper und ihre Haare waren im Nacken zusammengebunden. Wie ein Blitz traf es mich, als ich ihr Lächeln wiedererkannte. Ich hatte sie schon einmal gesehen. Erst vor wenigen Stunden war ich ihr das erste Mal begegnet. Sie grinste, doch ihre Augen wirkten traurig. Nur wenige Meter entfernt saß das Wesen und streckte mir seine Hand entgegen.
»Komm!«
Das war alles, was es zu mir sagte.
»Wohin?«, fragte ich, um wenigstens irgendetwas zu sagen.
Schon wieder liefen mir salzige Tränen übers Gesicht. Für meinen Geschmack hatte ich in den letzten Stunden zu viel geweint. So oft heulte ich normalerweise nicht einmal in einem ganzen Jahr.
Mit den blutigen Schnitten auf den Armen, meinem verletzten Bein, das durch den Sprint wieder angeschwollen war, und dem verquollenen Gesicht, musste ich für sie aussehen wie das Opfer eines Verkehrsunfalls. Als sie nach Minuten, die mir wie eine halbe Ewigkeit vorkamen, immer noch nicht geantwortet hatte, versuchte ich eine Reaktion von ihr zu erzwingen.
»Verschwinde! Lass mich in Ruhe! Ich bin keine von Euch merkwürdigen Wesen. Halt dich gefälligst von mir fern«, brüllte ich und wollte mich zum Gehen abwenden.
»Hexen! Du bist kein sonderbares Wesen, sondern eines der mächtigsten Geschöpfe dieser Welt. Du bist eine Hexe«, sagte sie.
Geschockt riss ich die Augen auf, bevor ich lauthals anfing zu lachen. Natürlich, ich war eine Hexe, was auch sonst? Das war einfach lächerlich!
Mit einer fließenden Bewegung erhob sich das Mädchen von der Bank, während ihr Blick an mir hoch und runter wanderte. Sie kam direkt auf mich zu und ich hatte keine Möglichkeit, ihr auszuweichen, da sich hinter mir nur die Bahngleise befanden. In der Mitte des Bahnsteigs blieb sie jedoch abrupt stehen, worüber ich mehr als froh war. Ich wusste, dass mein Verhalten kindisch war, aber ich wollte unter allen Umständen verhindern, dass sie mich berührte. »Du kannst weiterhin hier stehen und mich angaffen, aber es wird nicht ändern, was du bist. Auch deine Flucht wird dich nicht vor deinem Schicksal retten können. Entweder du kommst jetzt mit mir mit, oder du wartest noch länger und bringst auf deinem Weg unschuldige Menschen durch deine Unwissenheit um«, zischte sie erzürnt.
Vor meinem inneren Auge sah ich das Mädchen mit der Porzellanpuppe aus meinem Tagtraum und ich stellte mir vor, wie ich mich fühlen würde, wenn ich für ihren Tod verantwortlich wäre. Ich schniefte leise und meine Knie begannen bei der Vorstellung, wie das Feuer aus meinen Händen ein Haus in Brand setzte und die Haut von einem kleinen Mädchen Blasen warf, zu zittern. Eine Gänsehaut überzog meinen Körper und ich schüttelte panisch den Kopf, um die Bilder von schreienden Kindern loszuwerden. Eine kühle Hand, die mein Handgelenk umklammerte, zog mich aus meiner Trance.
»Es gibt eine andere Möglichkeit«, flüsterte die Chooserin und plötzlich war es mir egal, ob wir Hautkontakt hatten, solange sie mir helfen würde die Horrorszenarien zu verhindern.
Lieber würde ich eine gewisse Zeitspanne mit Verrückten verbringen, als Unschuldigen Leid zuzufügen. Mit etwas Glück würden diese Freaks in ein paar Tagen bemerken, dass sie bei mir einen Fehler gemacht hatten und mich gehen lassen. Ich schluckte schwer, bevor ich zögerlich nickte. Die Umgebung um mich begann sich zu drehen und ich spürte, wie die Müdigkeit von mir Besitz ergriff. Ein dumpfes Gefühl breitete sich in meinem Kopf aus und ein stechender Schmerz ließ mich zusammenzucken, als mein verletztes Bein unter mir wegbrach. Kurz bevor alles um mich schwarz wurde, konnte ich nur noch das mürrische Miauen der Katze hören und sehen, wie das Lächeln der Chooserin verschwand. Sie würde auch lange nichts mehr zu lächeln haben, nicht wahr? Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es nur der Anfang allen Übels sein würde und ich ihr am Ende mehr verdanken würde als jedem anderen. Selbst wenn sie mich zum schwarzen Wald bringen und mein Leben für immer verändern würde.
Alles Liebe, Deine Read
Die Nacht beginnt
Liebe Marie Estelle Lauro!
Das erste Mal, als ich im Hexeninternat aufwachte, glaubte ich in einem schlechten Horrorfilm gefangen zu sein. An den Wänden hingen alte Bilder, die großteils verstaubt waren. Die Fenster waren durch dunkelrote Vorhänge verhüllt und auf dem Tisch, in der Mitte des Raums, stand ein Kerzenleuchter, an dem drei Kerzen heruntergebrannt waren. Überall hingen Spinnennetze und die stickige Luft machte das Atmen kaum möglich. Mein Hals war ausgetrocknet und schrie nach Wasser, doch augenscheinlich gab es neben fehlendem Strom auch keine Wasserleitungen. Alles erschien mir alt, verdreckt und kurz vor dem Zusammenbrechen zu sein. Kurz dachte ich daran, was Emma wohl sagen würde, wenn sie hier wäre. Wahrscheinlich würde sie Witze über klischeehafte Hexen reißen und fragen, wo die Besen, auf denen sie durchs Wunderland reiten können, waren.
Meine Glieder brannten schmerzhaft und es war unerträglich heiß in dem Zimmer, das dem Geruch nach nie gelüftet wurde. Ich lag auf einer weißen Matratze, die mit Flecken übersät war. In meiner Position wollte ich lieber erst gar nicht darüber nachdenken, woher die Überreste stammten. Ein wenig erinnerte mich die Schlafunterlage an meine Matratze zuhause. Auch die war mit der Zeit, trotz Spannleintuch, fleckig geworden,
weil die Wunden an meinem Rücken nicht gänzlich geschlossen waren, als ich mich auf den Schaumstoff legte.
Außer mir war der Raum leer und es herrschte eine unheilvolle Stille, weshalb ich aufsprang, um die Gegend zu erkunden. Jedoch legte ich mich sofort wieder unter die Decke, da ich splitterfasernackt war und mein Rucksack sich auch nicht in diesem Raum, der an Draculas Höhle erinnerte, befand. Plötzlich hörte ich ein Knarren und schloss schnell meine Augen, weil ich noch nicht bereit war, mich mit einem der Verrückten auseinanderzusetzen.
Während ich mich schlafend stellte, öffnete sich eine der schwarzbraunen Türen, die mit goldenen Verzierungen umrandet waren.
»Und was willst du tun, wenn sie aufwacht? Du hast sie quasi gekidnappt«, sagte eine weibliche Stimme aufgeregt.
»Früher oder später hätten ihre Kräfte sie umgebracht. Was ist, wenn sie zu lang gebraucht hätte, um hierher zu kommen oder sich unbeabsichtigt selbst in die Luft gejagt hätte? Du hast das Feuer, das sie im Zug gelegt hat, nicht gesehen. Es war riesig und hat sich rasend schnell ausgebreitet. Außerdem hat sie zugestimmt, mir zu folgen, bevor sie das Bewusstsein verloren hat. Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie den Blutverlust nicht verkraften würde«, erwiderte eine andere Stimme und ich hätte schwören können, dass ich die Stimme kannte.
»Hoffentlich kooperiert sie auch jetzt, obwohl sie nicht freiwillig hierhergekommen ist. Wir brauchen sie noch«, flüsterte die erste Frau geheimnisvoll.
Ich spitzte meine Ohren. Obwohl ich die beiden Sprecherinnen zu gern gesehen hätte, traute ich mich nicht, die Augen einen Spalt zu öffnen, da sie vermutlich ihre Unterhaltung beenden würden, wenn ich wach wäre.
»Kümmere dich um sie und hilf ihr, zurechtzukommen! Das bist du ihr schuldig«, sagte die fremde Stimme, bevor eine Hand mir eine Strähne aus dem Gesicht strich.
»Bring sie in ihr Zimmer, sobald sie aufwacht, decke ihre Narben ab und sei vorsichtig! Nicht auszumalen, was passieren würde, wenn andere Schüler erfahren, dass sie nicht von allein zu uns gekommen ist«, befahl die Fremde. Die kühle Hand verschwand und kurze Zeit später konnte ich wieder das Knallen der schweren Türen hören.
»Du machst es uns wirklich nicht leicht, Read«, murmelte die helle Stimme und langsam konnte ich sie einem Gesicht zuordnen.
Das Mädchen in meiner Schule. Natürlich kannte ich ihre Stimme, doch wovon hatten die andere Frau und sie gesprochen? Warum war es wichtig, dass ich hier war und warum hatte die Chooserin mich mitgenommen? Schon klar, nach dem Flammenmeer wäre ich sowieso nicht mehr lange auf der Flucht gewesen, aber normalerweise wurden Menschen auserwählt, von den Choosern markiert und mussten selbst den Weg zum schwarzen Wald finden oder starben auf dem Weg dahin.
Ich zitterte und bekam eine Gänsehaut. Es war immer noch sommerlich warm in dem Raum, doch das Mal auf meinem Schlüsselbein begann sich zu erhitzen, bis ich es kaum noch aushielt, ohne einen Laut von mir zu geben. Als ich im Hintergrund auch noch eine Katze miauen hören konnte, war es mit meiner Selbstbeherrschung vorbei und ich zuckte zusammen.
»Sehr gut, du bist endlich wach«, meinte die Chooserin belustigt. Ich öffnete die Augen und sah wieder ihr dümmliches Lächeln.
»Wie fühlst du dich?«, fragte sie und in dem Moment wäre ich ihr am liebsten an die Kehle gesprungen.
Wie sollte ich mich denn fühlen? Ich war kilometerweit von Zuhause entfernt, hatte riesige Brandzeichen oberhalb meiner Brust, würde meinen früheren Klassenkollegen als Freak, der markiert wurde, in Erinnerung bleiben, hatte ein Gespräch mit einer Fremden, die sich einbildete, sie könnte sich in mein Leben einmischen und wurde praktisch entführt. Natürlich sollte auf dieser Liste auf keinen Fall meine neue stalkende Katze fehlen, die sich gerade an meinem Bein rieb. Innerlich schrie ich mir die Seele aus dem Leib, doch alles, was ich resignierend herausbrachte war:
»Gut.«
»Dann lasse ich dich kurz allein. Im Schrank hängt eine Schuluniform für dich. Willkommen im Internat St.Ghidora, der Heimat der Hexen.«
Ich versuchte, schwach zu lächeln, doch mein Gesicht verzog sich zu einer Grimasse. Danke, dachte ich und wollte mich am liebsten übergeben, noch bevor die Verrückte den Raum verlassen hatte. Zittrig stand ich von der unbequemen Matratze auf und bewegte mich durch den Raum. Die Kerzen leuchteten hell und ich fragte mich, wie lange ich wohl geschlafen hatte. War es schon Nacht oder noch Nachmittag? Im Endeffekt spielte es keine Rolle, doch ich fühlte ein nagendes Gefühl in meinem Inneren, als ob es wichtig wäre, wie spät es war. Ich war sowieso schon viel zu spät dran. Ich bewegte mich weiter in die Richtung des großen Holzkastens, der mich stark an den Horrorfilm »Conjuring« erinnerte, bei dem das besessene Mädchen plötzlich auf dem Kleiderschrank lag.
Ein wenig überrascht war ich schon, als die Uniform exakt meine Größe hatte, aber ich beschloss, nicht darüber nachzudenken, da es mit Abstand nicht das Seltsamste war, dass mir in den vergangenen Stunden passiert war und mir die Antwort keinesfalls gefallen hätte. Der Rock war in schwarz gehalten und dazu gab es eine rote Bluse mit kurzen Ärmeln. Auch wenn eine Krawatte dabei hing, verzichtete ich darauf, sie mir um den Hals zu binden und ließ sie einfach im Kasten hängen. Stattdessen zog ich lieber die schwarze Weste mit silbernem Reißverschluss über. Meine langen Haare band ich mit dem Haargummi, das um mein Handgelenk gebunden war, zusammen. Keine zehn Sekunden später stand die Chooserin in der Tür und hielt mir rote Ballerinas vors Gesicht. Sie selbst war nun ebenfalls mit Rock und Bluse bekleidet, doch sie trug die skurrile Krawatte und ihre Uniform, die im Internat nur zu besonderen Anlässen getragen wurde, war in Grüntönen gehalten. Schnell schlüpfte ich in die mädchenhaften Schuhe und sah mein Gegenüber wartend an. Innerlich verfluchte ich die Schühchen, die an meiner Ferse rieben, jetzt schon. Bestimmt würde ich am Ende des Tages mehrere Blasen an meinen Füßen wiederfinden.
Ohne ein Wort drehte sich die Chooserin um und lief leichtfüßig über den Marmorboden.
»Wohin gehen wir?«, fragte ich verwirrt und versuchte,
mit ihr schrittzuhalten.
Sie ging nicht besonders schnell, doch wegen meinem verletzten Bein konnte ich nur schwer mit ihr mithalten, weshalb ich nach wenigen Metern anfing zu keuchen.
»Zu Direktorin Enyo Terrent, dem Verderben der Schule und danach bringe ich dich in dein Zimmer«, sagte sie und lachte über sich selbst.
Irritiert sah ich sie an, doch sie winkte ab. Während wir den Gang entlangliefen, versuchte ich, mir jedes Detail einzuprägen, aber schon nach wenigen Minuten gab ich auf. Dieses Gebäude war ein einziger Irrgarten. Die
Wände waren weiß und hin und wieder waren rote Pentagramme auf den Mauern, doch nirgendwo sah ich auch nur eine einzige Tür. Jeder Gang glich bis ins kleinste Detail dem Letzten. Von der Decke hingen alle zwanzig Meter Fackeln, die den Weg beleuchteten. Der Boden war schwarz. Obwohl, genaugenommen war er nicht nur schwarz, sondern in verschiedenen Schwarztönen schattiert. Immer wieder schien der Boden an einer Stelle heller und dann wieder dunkler zu werden. Noch während ich versuchte, zu verstehen, wie das Gebäude belüftet wurde, da es keine Fenster gab, blieb die Chooserin plötzlich vor einem der Pentagramme stehen. Ich kam ins Straucheln und beinahe hätte mein Gesicht Bekanntschaft mit dem Marmorboden gemacht, wenn die Blondine mich nicht festgehalten hätte. Die Chooserin rollte mit den Augen und meine Wangen färbten sich rötlich.
»Pass auf, wo du hintrittst«, zischte sie und klopfte in die Mitte des Sterns.
Sie fuhr mit dem rechten Zeigefinger die Zacken nach. Kurz sah ich sie verwundert an und war nicht mehr weit davon entfernt, zu fragen, ob sie nun völlig den Verstand verloren hatte, doch dann qualmte es unter der Wand hervor. Das Pentagramm begann zu glühen. Meine Führerin trat einen Schritt zurück und die Mauer schien sich zusammenzuziehen, bis in der Wand ein Loch entstand und den Blick auf ein kleines Zimmer freigab. Es war schlicht eingerichtet, doch auch hier befanden sich keine Fenster. Ein großer Kasten und ein Schreibtisch nahmen den halben Raum ein und eine Frau, Mitte vierzig, saß hinter dem Tisch und spielte gerade mit der Maus eines Computers. Wenigstens waren wir nicht ganz von der Zivilisation abgeschottet, dachte ich beim Anblick des technischen Geräts.
Die Chooserin räusperte sich und die Dame sah auf. Kurz schweifte ihr Blick über uns und ein Lächeln erschien auf ihren Lippen. Ganz ehrlich, warum grinsen diese Freaks ständig? Sah ich heute irgendwie komisch aus oder wird das Leben lustiger, wenn man den Verstand verloren hatte?
»Willkommen Read«, flüsterte die Frau, deren lockige Haare ihr ins Gesicht hingen.
Leicht kicherte meine Begleiterin, bevor sie zu Boden sah. Mit ihren grünen Augen, den Sommersprossen und der roten Haarpracht sah die Direktorin aus wie das lebende Klischee einer Hexe. Dennoch wäre sie auf eine eigenartige Weise schön gewesen, wenn sich nicht von ihrem linken Auge bis unter ihren Hals eine rote vernarbte Brandwunde gezogen hätte. Die Narbe verdeckte einen Teil ihrer blauen Tattoos, die die Form von Buchseiten, die sich in Vögel verwandelten, hatten.
»Du siehst deiner Mutter sehr ähnlich«, sagte die Direktorin ehrfürchtig und ihre schmalen Lippen vertieften ihr Lächeln.
Ich brachte nicht einmal ein Schnauben zustande, denn das war eine glatte Lüge. Meine Mutter war so ziemlich das Gegenteil von mir. Sie war blond, ich war schwarzhaarig. Sie hatte braune Augen, ich hatte grüne. Sie war schlank, ich hatte überall Fettpolster, die ich nicht loswurde. Ihre Stupsnase war klein und süß, während meine die Hälfte meines Gesichts einnahm. Auch brauchte meine Erzeugerin keine Brille, die ihre miserablen Augen ausbesserte.
»Wir brauchen für Read ein Zimmer, Madame Terrent«,
meinte die Chooserin mit ihrer hellen Stimme.
Kurz blieb der Blick der Ältesten an mir haften, bevor sie sich umdrehte und einen Schlüssel aus der Schublade des Schreibtischs holte.
»Bitte schön«, wisperte sie und drückte mir einen kleinen silbernen Schlüssel in die Hand.
Ihre Finger umfassten mein Handgelenk und ihr Blick lag ungewöhnlich lang auf mir, bevor sie sagte: »Wir hoffen, dass du dich hier wohl fühlst. Marie wird dir bei allem helfen, wenn du Hilfe brauchst. Wende dich einfach an sie.«
Das war der Moment, in dem ich endlich wusste wie die Chooserin, die mir alles genommen hatte, hieß. Endlich hatte ich für das personifizierte Böse in meinem Leben einen Namen.
Marie sah mich aufmerksam an, machte auf dem Absatz kehrt und deutete mir an, ihr zu folgen. Natürlich hätte ich jetzt schreien, weinen und fluchen können. Ich hätte toben und von der Direktorin verlangen können, dass sie mich nach Hause brachte, doch jetzt war ich schon einmal hier und es bestand die Möglichkeit, diesen Wahnsinn zu überstehen. Also folgte ich Marie auf Schritt und Tritt, während die schwarze Katze sich immer wieder zwischen meinen Beinen hindurchschlängelte und mein Knöchel mich fast umbrachte. Bei jeder Bewegung fühlte ich mein Fußgelenk pochen, aber ich ging einfach weiter, als wäre nichts.
»Süß. Woher hast du sie?«, fragte mich Marie und ich sah sie verwirrt an.
Augenrollend deutete sie auf das schwarze Tier zu meinen Füßen und bückte sich, um die Katze zu streicheln.
»Sie gehört nicht mir«, beharrte ich auf meinem Standpunkt und versuchte, nicht über das Fellknäuel, das sich an meinen Unterschenkel drückte, um sich vor Marie in Sicherheit zu bringen, zu stolpern.
»Das scheint sie aber anders zu sehen. Katzen sind eigensinnige Wesen. Sie suchen sich ihre Gefährten aus, doch wenn eine dich erwählt hat, kannst du dich glücklich schätzen, denn sie wird dir treu bleiben und dich vor Unheil bewahren. Du solltest ihr einen Namen geben«, riet die Chooserin mir.
Sollte ich ihr nun erklären, dass ich nicht vorhatte hier zusammen mit einer Katze, die nicht mal mir gehörte, zu leben? Oder sollte ich einfach schnauben und ihr mit meiner Faust die Nase brechen, weil sie sich schon wieder in mein Leben eingemischte?
In dieser Situation hätte es so viele Reaktionen gegeben und was tat ich? Ich überlegte mir im Stillen schon einmal einen Namen für ein Tier, das anscheinend einen Narren an mir gefressen hatte.