- -
- 100%
- +
Assinger sitzt mir in einem schwarzen Ledersessel gegenüber und hört gespannt zu. Zum ersten Mal in unserem Gespräch verlässt ihn der hemdsärmelige Schmäh, und er wird nachdenklich. Ich höre es in seinem Kopf rattern, als er nach Worten ringt: „Ja, da hast du wohl recht. Du öffnest gerade eine Seitentür in meinem Hirn. Über all diese Themen habe ich bisher noch nie so bewusst nachgedacht.“ Diese Offenheit überrascht mich und gleichzeitig macht sie mich fassungslos. Wie kann es sein, dass ein 56-Jähriger das Thema Gleichberechtigung noch nie auf dem Radar hatte? Wie kann es sein, dass es spurlos an ihm vorübergegangen ist, dass Frauen in vielen Belangen benachteiligt sind? Und warum hat er nicht versucht, mehr Zeit in Familie und Kinder zu investieren? Als könnte er meine Gedanken lesen, sagt Assinger rechtfertigend: „Es hätte sicher mehr sein können. Aber ich komme eben auch aus einer Sportart, wo du in gewisser Weise eine Egosau sein musst. Einzelsportler sind ja auch Egoisten, und wenn du dann aufhörst, kannst du den Schalter nicht komplett umlegen und sofort ein Teamplayer werden. Das muss man einem auch ein bisschen nachsehen.“
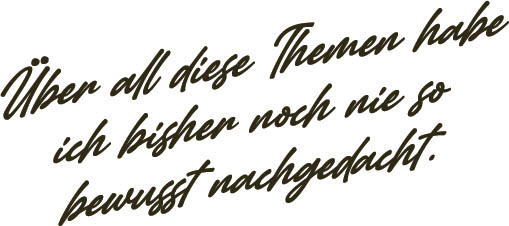
Muss man das wirklich? Vieles, das Armin Assinger sagt, kann ich ihm tatsächlich nachsehen. Von seiner Warte aus betrachtet, kann ich viele seiner Aussagen und Entscheidungen nachvollziehen. Aus einer privilegierten Sicht, und die hat man als Mann zweifellos, redet es sich aber auch leicht. Aus einer privilegierten Sicht nimmt man viele Ungerechtigkeiten gar nicht wahr. Oder vielleicht will man sie auch nicht wahrnehmen, um das angenehme Gefühl nicht zu trüben. Denn wie kann es einem als Vater gut gehen, wenn man weiß, dass die eigene Tochter sich ihre Lebensträume aufgrund ihres Geschlechts vielleicht nicht erfüllen wird können? Dass sie sich zwischen Kind und Karriere entscheiden wird müssen und dass sie eines Tages weniger verdienen wird als der eigene Sohn? Wie kann man das nicht höchstgradig ungerecht finden? Aber wahrscheinlich ist das wie mit vielen Dingen im Leben. Der dunkelhäutige Nachbar ist eh ganz nett, aber alle anderen Schwarzafrikaner sind Drogendealer. Der nette Obdachlose vor dem Supermarkt kann sicher nichts für sein Schicksal, aber alle anderen sind selbst schuld. Und die eigene Tochter wird es dann schon nicht so schwer haben, auch wenn Frauen generell benachteiligt sind. Wahrscheinlich ist das eine Art Selbstschutz, den wir Menschen eingebaut haben, um die vielen Ungerechtigkeiten in der Welt nicht spüren zu müssen. In Bezug auf die Gleichberechtigung ist dieser Schutzmechanismus aber fatal. Denn wie soll sich etwas ändern, wenn Gleichberechtigung immer nur als individuelles Problem gedacht wird? „Was bräuchte es denn, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird?“, will ich von Assinger wissen. Weil er darauf keine Antwort hat oder weil ihm das Thema langsam auf die Nerven geht, greift er zu einem der drei Joker, die ich ihm am Anfang des Gesprächs ganz in Millionenshow-Manier präsentiert habe. Er legt die rosafarbene Richtungswechsel-Karte vor mich auf den Tisch und schaut mich herausfordernd an. Ich schaue auf die zwei Pfeile, die ich mit den Filzstiften meiner Kinder draufgemalt habe, und finde das plötzlich alles ziemlich absurd: Muss man im Jahr 2020 wirklich noch so über Gleichberechtigung diskutieren? Offensichtlich schon.
Wie es meine Spielregeln also vorgeben, beantworte ich jetzt die Frage. „Es gibt so vieles, das sich ändern müsste“, sage ich, und dass ich mit den „Frauenfragen“-Interviews einen kleinen Teil dazu beitragen möchte. Außerdem müssten Frauen endlich genauso viel verdienen wie Männer und in alle beruflichen Ebenen vordringen können. Wenn es sein muss, auch mit einer gesetzlich geregelten Quote. Das Wort Quote löst bei Assinger, wie übrigens bei vielen Menschen, große Emotionen aus. „Muss das wirklich mit Zwang sein, dass, wenn ein Mann und eine Frau sich bewerben, automatisch die Frau genommen wird? Dann sind doch wieder die Männer diskriminiert, und das wollen wir ja auch nicht“, sagt er, fügt dann aber noch hinzu, dass er Quoten prinzipiell schon ganz gut findet. Natürlich will ich nicht, dass Männer diskriminiert werden. Wer will das schon ernsthaft? Aber kann man nicht über eine faire Aufteilung sprechen, ohne dass gleich der Angstschweiß ausbricht? Ohne dass man gleich eine Notrufnummer für den diskriminierten Mann einrichten muss? Eine Studie des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2020 besagt übrigens, dass, wenn es in Sachen Gleichberechtigung in dem Tempo weitergeht, es noch 100 Jahre dauern wird, bis Frauen und Männer tatsächlich gleichgestellt sind. Die Rede ist von gleichgestellt, nicht bessergestellt. Also kein Grund zur Panik! Assinger bleibt trotzdem skeptisch. Auch als ich über den Gender-Pay-Gap spreche, also die Tatsache, dass Frauen nach wie vor weniger verdienen als Männer. „Dass Frauen so viel weniger verdienen als Männer, muss man schon differenziert sehen. Zum Beispiel im Staatsdienst, bei den Beamten. Da ist die Bezahlung ja schon angeglichen worden.“ Jetzt ist der ehemalige Skirennläufer so richtig in Fahrt. Gerade bei den Beamten sei es manchmal nicht fair, dass Frauen, die zum Beispiel weniger Dienstjahre vorweisen können, nur aufgrund ihres Geschlechts bevorzugt werden. Und dass man sich generell anschauen müsse, wie viele Menschen in Österreich überhaupt erwerbstätig sind und wie viele davon dann Beamte sind. Ich frage mich, ob er mir jetzt tatsächlich erklären will, dass es den Gender-Pay-Gap gar nicht gibt. Dass er vielleicht nur eine Erfindung von uns ach so aufgeklärten Feministinnen in der Stadt ist. Die Zahlen sagen jedenfalls etwas anderes: Im Jahresdurchschnitt 2019 gab es, laut Statistik Austria, 4.355.000 Erwerbstätige, ungefähr gleich viele Frauen wie Männer. Davon waren rund 200.000 Beamt*innen. Obwohl im öffentlichen Dienst gleichwertige Arbeit unabhängig vom Geschlecht gleich bezahlt wird, verdienen auch Beamtinnen im Schnitt weniger als ihre männlichen Kollegen. Das liegt u.a. daran, dass auch hier Frauen eher in Teilzeit arbeiten und weniger in Führungspositionen zu finden sind.1
In Sachen Gleichberechtigung gibt es also definitiv noch viel zu tun. Darauf einigen sich Assinger und ich nach gut eineinhalb Stunden, die wir bereits in diesem nüchternen Besprechungsraum sitzen, am Prosecco-Glas nippen und über „Frauenfragen“ diskutieren. Als wir thematisch bei der Frauenquote in der Unterhaltungsbranche ankommen, schlägt der Showmaster plötzlich die Hände zusammen und meint: „Do is a Gössn.“ Da ist eine Gelse. Ich kann keine sehen und mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, wie ein Insekt in diesem klinisch sauberen Zimmer überleben könnte. Vielmehr habe ich den Eindruck, dass Assinger mit dieser Nebensächlichkeit ablenken will. Dass es ihm unangenehm ist, über Themen zu sprechen, in denen ihm die Expertise fehlt. „Du hast mich heute wirklich am falschen Fuß erwischt, weil ich ja nicht gewusst habe, worüber wir reden werden. Deswegen kann man nicht jede Aussage von mir für bare Münze nehmen. Mir ist bewusst, dass das Thema ein sehr sensibles ist, und ich will ja auch niemanden vor den Kopf stoßen.“
Vor den Kopf gestoßen werden Frauen in der Unterhaltungsbranche aber immer wieder. Oder wie ist es zu erklären, dass die meisten großen Unterhaltungssendungen im Fernsehen von Männern präsentiert werden? Und wenn Frauen vorkommen, sie häufig nur als Co-Moderatorinnen fungieren dürfen, oder wie eine Schweizer Zeitung über Michelle Hunziker bei „Wetten, dass ..?“ geschrieben hat, als „schönster Sidekick der Fernsehgeschichte“2? Wie ist es zu erklären, dass der Programmdirektor der ARD 2020 in einem Interview meinte, er finde keine Frau für die Showunterhaltung, und dafür berechtigterweise heftige Kritik erntete? Und warum wurde auch die Rate-Sendung „Die Millionenshow“, die bereits in über 100 Ländern ausgestrahlt wurde, weltweit hauptsächlich von Männern moderiert? Als Barbara Stöckl im Jahr 2000 in Österreich die Moderation der Quizsendung übernahm, war sie weltweit die einzige Frau für dieses Format. Mittlerweile haben einige Fernsehstationen nachgezogen, doch immer noch sind Frauen als Quizshow-Moderatorinnen die Ausnahme. „Jemand in führender Position hat mal gesagt: Quiz ist Männersache“, ergänzt Assinger. In Bezug aufs Moderieren geben ihm die Fakten recht. Wenn man sich jedoch anschaut, wie viele Frauen in der Millionenshow bereits die Millionen-Frage geknackt haben, stimmt die Aussage nicht mehr. Denn seit Beginn der Ausstrahlung der Sendung im ORF sind bisher fünf Frauen und zwei Männer mit der Million nach Hause gegangen. Vielleicht könnte man daraus jetzt auch wieder etwas Schlaues ableiten, denke ich, verkneife mir dann aber, es laut auszusprechen. Anders als Armin Assinger, der geradeheraus sagt, was er sich denkt. Und so meint er gegen Ende unseres Gesprächs: „Jetzt fängt es langsam an, unbequem für mich zu werden, weil du auf diesem Thema so herumreitest, und ich merke, wie wenig Gedanken ich mir im Laufe der letzten Jahre dazu gemacht habe. Aber kommendes Wochenende bin ich allein, und da werde ich sicher darüber nachdenken.“ Kaum hat er den Satz beendet, muss er auch schon los zu seinem nächsten Termin. Denn wenn der Kärntner einmal in Wien ist, ist sein Zeitplan dicht gedrängt. Lässig wirft er sich seine Jacke über, nimmt seinen kleinen Rollkoffer und eilt zum Ausgang. Bevor die Tür zufällt, dreht sich Assinger noch einmal um, winkt freundlich und ruft: „Bis bald, Marilein.“ Und damit wird mir einmal mehr bewusst, wie viel in Sachen Gleichberechtigung tatsächlich noch zu tun ist.
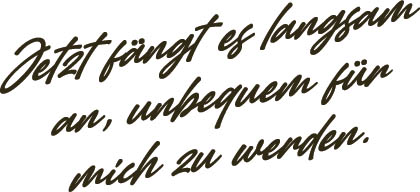
Alma Zadić
JUSTIZMINISTERIN
Ich werde als junge Mutter immer wieder gefragt, wie ich Job und Kind unter einen Hut bekomme und ob es meinen Mann nicht stört, dass er jetzt zu Hause bleibt und sich um das Baby kümmert. Ich habe noch nie gehört, dass man Männer in vergleichbaren Positionen fragt, wie sie Job und Kind unter einen Hut bekommen und ob es deren Frauen stört, die Kinder zu betreuen. Es kann nicht nur die Aufgabe der Frau sein, sich um die Erziehung und den gemeinsamen Haushalt zu kümmern. Es ist die Aufgabe beider Partner und die Frage ist daher an beide Elternteile zu richten.
Raphaela Scharf
MODERATORIN, JOURNALISTIN
Ich wurde einmal gefragt, ob ich auch noch andere Qualifikationen hätte, außer schön zu sein. Vor allem im Fernsehjournalismus werden Frauen häufig auf das Aussehen reduziert, und auch die Vereinbarkeitsfrage ist immer wieder Thema. „Teilzeitjob erwünscht? Kaum machbar.“ Von männlichen Kollegen habe ich noch nie gehört, dass sie so etwas gefragt wurden.
Mirjam Weichselbraun
MODERATORIN
Sätze wie: „Wo sind denn deine Kinder, wenn du arbeitest?“, „Mausi, mach dir darüber keinen Kopf“ oder „Du bist aber schon sehr ehrgeizig“, habe ich persönlich schon oft gehört. Vor allem von den sogenannten alten, weißen Männern, aber immer wieder auch von Frauen. Es wäre schön, wenn wir uns da etwas kritischer hinterfragen würden. Denn im Grunde wollen wir doch alle selbstbestimmt und gleichberechtigt leben, und mit mehr Frauensolidarität kämen wir bestimmt schneller ans Ziel.
AM ROTEN TEPPICH
Christian Kern trägt bei unserem Treffen ein
weißes Hemd und darüber ein khakifarbenes
Sakko, klassische Bluejeans sowie blaue Socken
und braune Lederschuhe.
MEIN BEAUTY-GEHEIMNIS
… ist, dass ich die Gene meiner Mutter habe.
SMARTPHONE ODER HAUTCREME? AUF EINE EINSAME INSEL NEHME ICH
… mein Telefon mit. Das ist schon nützlich. Wobei, ich besitze natürlich auch eine Hautcreme.
UNGESTYLT BIN ICH
… wenn ich mit meinem Hund in der Früh die erste Runde mache.
MASSANZÜGE
… habe ich keine. Dafür bin ich viel zu ungeduldig.
ANGST, DURCH JÜNGERE FRAUEN ERSETZT ZU WERDEN
… habe ich nicht. Im Gegenteil, ich habe zeit meines Berufslebens, Frauen gefördert.

CHRISTIAN KERN
Kein Joker, Preis: Schokolade
CHRISTIAN KERN
Ich habe es zwei Mal probiert, aber richtig gut fand ich es nie, das Schwanger-Sein. Ich hatte fürchterliche Stimmungsschwankungen, nach kürzester Zeit Sodbrennen, und den berühmten Glow habe ich beim Blick in den Spiegel auch nie gefunden. Ein Kind zu kriegen, hatte ich mir definitiv besser vorgestellt. Schließlich wird einem überall vermittelt, dass die Schwangerschaft „die schönste Zeit im Leben einer Frau ist“. Vielleicht empfinden es manche tatsächlich als schön, ständig Kommentare zur Größe des Bauches zu bekommen, mehrmals am Tag gefragt zu werden, wann das Baby denn kommt und ob es ein Bub oder ein Mädchen wird. Mich hat das meistens genervt. Ich frage Menschen, die zugenommen haben, ja auch nicht, ob da ein Sixpack Bier oder eine Schwarzwälder Kirschtorte drin ist. Für schwangere Frauen gilt aber offenbar ein anderer Maßstab, wenn es um die Überschreitung persönlicher Grenzen geht. Oder ist es allgemein üblich, dass Kolleg*innen einem ungefragt den Bauch küssen und Fremde beim Wandern einfach so – „Oh, wie schön! Darf ich mal?“ – draufgreifen? Als Schwangere wird man plötzlich zu einer Art Allgemeingut und nicht mehr als Frau, sondern vor allem als schwanger gesehen. Besonders im beruflichen Kontext empfand ich das als äußerst unangenehm. Und so war ich bei meiner letzten offiziellen Begegnung mit Christian Kern im Jahr 2016 fast froh, dass er nicht meine Schwangerschaft, sondern mein Outfit thematisiert hat.
Der heute 54-Jährige war damals noch Bundeskanzler und sprach bei einer Podiumsdiskussion mit führenden Europapolitikern über die Zukunft der Europäischen Union. Ich war zu dem Zeitpunkt hochschwanger und führte als Moderatorin etwas atemlos durch das Gespräch. Denn das Baby im Bauch boxte an dem Tag besonders stark gegen mein Zwerchfell, und das lange Sitzen machte mir zu schaffen. Als wir fertig waren, schüttelte Kern mir die Hand und meinte: „Cooles Outfit.“ Ich trug ein graues Shirt, eine dunkelblaue Stoffhose, blau-weinrot karierte Socken und dazu weinrote Schnürschuhe. Ich weiß es noch so genau, weil mich die Aussage einerseits gefreut, andererseits aber auch irritiert hat. Hätte er das auch zu mir gesagt, wenn ich ein Mann gewesen wäre? Hätte er in dem Fall nicht vielmehr meine fachlichen Qualitäten beurteilt? War das ein klassischer Fall von: Frauen werden ständig auf ihr Äußeres reduziert? Oder können sich Frauen und Männer nicht auch einfach über Mode unterhalten, ohne dass gleich irgendeine Form von Sexismus dahintersteckt? „Jetzt darf man Frauen nicht einmal mehr ein Kompliment machen“, werden einige vielleicht sagen. Natürlich darf man das. Sehr gerne sogar. Aber ebenso darf man sich bewusst machen, dass Frauen und Männer, vor allem in beruflichen Kontexten, mit unterschiedlichem Maß gemessen werden. Dass Männer vorrangig nach ihrer Kompetenz und Frauen nach ihrem Äußeren beurteilt werden. Das darf man durchaus hinterfragen und darüber diskutieren. Und genau deshalb habe ich Christian Kern, vier Jahre nach unserem Zusammentreffen im Haus der Europäischen Union, zu einem „Frauenfragen“-Gespräch eingeladen.
Wir sitzen also wieder nebeneinander und ich habe, natürlich absichtlich, fast das Gleiche an wie damals. Während sich Kerns Labradorhündin Samy unter den Tisch verkriecht, frage ich ihn, ob ihm mein Outfit immer noch gefällt. „Auf jeden Fall. Das ist sehr gelungen. Aber das war damals gar nicht so gemeint, wie es jetzt vielleicht bei dir rüberkommt“, erklärt der ehemalige Bundeskanzler. „Das war wirklich ein sachliches, interessiertes Kompliment bzw. mehr eine Einschätzung. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, das zu einem Mann zu sagen. Nur ist bei Männern oft das Bewusstsein für Mode nicht so vorhanden.“
Das Bewusstsein für Mode ist bei Christian Kern, der 2018 aus der Politik ausgeschieden ist und heute wieder in der Privatwirtschaft arbeitet, auf jeden Fall vorhanden. Bei unserem Treffen trägt er ein legeres Business-Outfit: Bluejeans, weißes Hemd und khakifarbenes Sakko, und auch sonst ist er stets gut gekleidet. Während seiner Zeit in der Politik fiel er optisch durch seine engen, gut sitzenden Anzüge auf, die ihm die Bezeichnung „Slim-Fit-Kanzler“ einbrachten. Die satirische Onlinezeitung „Die Tagespresse“ widmete Kerns körperbetontem Kleidungsstil sogar einen ganzen Artikel. „Das war knapp! Bundeskanzler Christian Kern musste heute Früh von einem Notarzt aus einem zu engen Designer-Anzug geschnitten werden“, war da etwa zu lesen.3 Kein österreichischer Politiker wurde je so auf sein Äußeres reduziert wie Kern. Altkanzler Wolfgang Schüssel fiel zwar auch mit seinen bunten Mascherln auf, doch der Einheitsbrei aus dunklen Anzügen und Krawatten war damals in den Medien nie wirklich Thema. Erst seit einigen Jahren werden Anzüge, Uhren und Socken von Politikern kommentiert und bewertet. Christian Kern hat sicher seinen Teil dazu beigetragen. „Ich muss gestehen, ein bisschen habe ich es schon nervig gefunden. Denn nur weil du nicht bei jedem Schweinsbraten am Wegesrand schwach wirst, heißt das ja noch lange nicht, dass du nur noch darauf zurückgeführt werden musst“, sagt der gebürtige Wiener, als ich ihn frage, wie er den Fokus auf sein Äußeres empfunden hat.
Für Frauen ist das, was Kern in seiner knapp zweijährigen Polit-Karriere widerfahren ist, Alltag. Während sich Politiker vor allem gegen ihre Konkurrenten durchsetzen müssen, sind Politikerinnen zusätzlich noch mit abwertenden Zuschreibungen und Objektivierungen konfrontiert – im Parlament genauso wie auf Social Media und in klassischen Medien. So wurde zum Beispiel die Europaabgeordnete der Neos Claudia Gamon als „Miss Neos“4 und „Schöne Claudia“ bezeichnet, die erste österreichische Außenministerin Benita Ferrero-Waldner wurde abfällig „Chanel-Pupperl“5genannt, und als Brigitte Bierlein 2019 Übergangskanzlerin wurde, dauerte es keine 24 Stunden, bis Zeitungen ihre Kleidungswahl kommentierten. „Das ist wahrscheinlich wirklich so ein Geschlechterstereotyp“, meint Kern dazu. „Wenn mir meine Ehefrau ein Kompliment macht, bin ich glücklich darüber, aber sonst tue ich mir schwer, damit umzugehen. Als Mann bist du es einfach nicht so gewohnt, in dieser Kategorie gemessen zu werden.“ Gut, als Mann ist man vieles nicht so gewohnt. Zum Beispiel auch nicht, dass man aufgrund seines guten Aussehens im Berufsleben als weniger kompetent wahrgenommen wird. Kern hat das in seiner bisherigen Karriere jedenfalls noch nicht erlebt, wie er sagt – weder in der Politik noch in der Wirtschaft, wo er zuerst im Vorstand der Verbund AG6 und danach als Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Bundesbahnen tätig war. „Ich denke aber, es ist im Gegenteil schon hilfreich, gut auszusehen. Attraktive Menschen werden, so unfair das ist, a prima vista als sympathischer wahrgenommen“, meint er. Bereits 1972 prägten amerikanische Wissenschaftler den Satz „What is beautiful is good“, der bis heute zu gelten scheint. Auch aktuellere Studien belegen, dass schönen Menschen positive Charaktereigenschaften zugeschrieben werden. Allerdings trifft das nicht auf alle Lebensbereiche und auch nicht auf beide Geschlechter gleichermaßen zu. Erst kürzlich hat mir mein Mann, der in der IT-Branche tätig ist, einen Erfahrungsbericht geliefert, der das bestätigt. Seine Kollegin, eine große, schlanke, blonde und sehr kompetente Technikerin, hat, wie er sagt, immer wieder Probleme, von den größtenteils männlichen Kunden ernst genommen zu werden. Blöde und anzügliche Bemerkungen stünden regelmäßig auf der Tagesordnung. Das Vorurteil, eine Frau könne nicht gleichzeitig schön und intelligent sein, geistert also noch immer durch diverse Großraumbüros, auch in der prinzipiell aufgeschlossenen und, was Geschlechtergerechtigkeit betrifft, recht fortschrittlichen IT-Welt.
„Also, bei mir ist das sicherlich nicht so“, sagt Kern, fast so, als hätte ich ihm mit meiner Anekdote etwas unterstellen wollen. „Ich mache mir bei meinen Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen keine Gedanken darüber, ob sie gut ausschauen oder nicht.“ Mag sein. Die Mehrheit der Personalchef*innen tut das jedoch schon, vor allem, wenn es um die Besetzung von Spitzenpositionen geht. Das haben Wissenschaftler der Yale University bereits Ende der 1970er-Jahre nachgewiesen, und auch eine Studie aus dem Jahr 2019 kommt zu dem Ergebnis, dass Schönheit für Geschäftsfrauen eher ein Nachteil ist.7 Offenbar liegt das daran, dass Führungspositionen eher mit „männlichen“ Eigenschaften assoziiert werden und attraktive, also besonders weibliche Frauen, für diese Jobs deshalb unpassender erscheinen. Die Konsequenz? Frauen, die Karriere machen wollen, sollten sich so unattraktiv und maskulin wie möglich geben, meinen die Wissenschaftler. Auch wenn diese Empfehlung auf den ersten Blick plausibel erscheint, ist sie meiner Meinung nach viel zu kurz gedacht. Denn warum müssen sich Frauen an die Gegebenheiten eines männlich dominierten Wirtschaftssystems anpassen? Warum denken wir nicht stattdessen darüber nach, wie wir die Vorurteile, Codes und Verhaltensvorschriften, die in der Geschäftswelt vorherrschen, aufbrechen und verändern könnten? Ich bin mir sicher, dass auch Männer davon profitieren würden. „Ein gutes Mittel gegen all diese Ungerechtigkeiten sind Quoten“, meint Kern. „Aber neben Frauenquoten in allen Lebensbereichen wäre es genauso wichtig, ein anderes Männerbild zu entwickeln. Denn oft hängt es von den Chefs ab, ob sie Frauen fördern oder nicht, und das sind zu einem Großteil einfach noch Männer.“ Plötzlich ist ein lautes Gähnen zu hören, und ich bin irritiert, weil ich fast vergessen habe, dass Kerns Hund ja auch noch im Raum ist. Demonstratives Gähnen deute ich immer als Hinweis für Langeweile, und so frage ich mich, während Samy aufsteht und sich genüsslich streckt, ob unser Gespräch bisher vielleicht etwas fad war. Als ob ein Labrador das beurteilen könnte! „Hast du Samy, die ja ein Weibchen ist, eigentlich bewusst zu einem Gespräch über ‚Frauenfragen‘ mitgebracht?“, will ich von Kern wissen, um die ernsthafte Stimmung ein bisschen aufzulockern. „Nein, sie ist meine ständige Begleiterin. Sie ist unglaublich anhänglich, was ich großartig finde. Ich nehme sie auch immer mit ins Büro, wo sie dann zu meinen Füßen liegt.“ Nach einer kurzen Pause fügt er noch hinzu: „Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir jemand zu Füßen liegt.“ Höflich beantwortet Kern jede Frage, schweift dabei jedoch nie aus und sagt stets nur so viel, wie notwendig erscheint. In dem Buch „Christian Kern: Ein politisches Porträt“8 wird der Ex-Kanzler als „fleißig, belesen und gescheit“ beschrieben. Außerdem als „distanziert und kontrolliert“, und diesen Eindruck habe ich bisher auch von ihm.
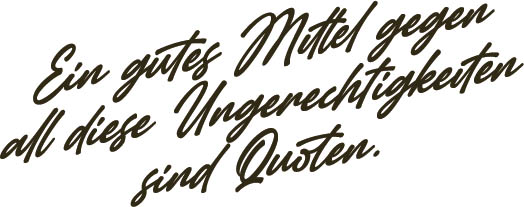
„Inwiefern hast du dich denn in die Familienarbeit eingebracht?“, will ich von Kern wissen und mache damit das große Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere auf. Zu lange über das Aussehen zu reden, ist ja wirklich langweilig. Als er Vorstandsvorsitzender der ÖBB wurde, war seine Tochter aus zweiter Ehe gerade mal drei Jahre alt. „In diesen Managementberufen muss man zwar am Wochenende auch immer arbeiten, Unterlagen lesen und da und dort einen Termin absolvieren, aber im Wesentlichen habe ich schon versucht, mir diese Tage freizuhalten. Unter der Woche ist das aber oft schwierig gewesen und vieles ist an meiner Frau hängen geblieben“, erzählt der 54-Jährige, der seit 2009 mit der Unternehmerin Eveline Steinberger-Kern verheiratet ist. Die beiden haben sich beim Verbundkonzern kennengelernt, wo Steinberger-Kern knapp zehn Jahre beschäftigt war. „Ich bin in der Holding in den Vorstand gekommen und sie war damals Geschäftsführerin im Vertrieb. Da gab es dann natürlich eine Vereinbarkeitsthematik, und deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass sie geht und etwas anderes macht. Im Nachhinein glaube ich, dass es für ihren weiteren Weg gut war, aber das hat man natürlich nicht wissen können.“ Ich runzle die Stirn. Im Nachhinein kann man sich wirklich alles schönreden. Weil Kern meine kritischen Gedanken möglicherweise spürt, fügt er erklärend hinzu: „Eveline ist etwas jünger als ich, und wenn man will, war ich in meinem Karriereverlauf durch die Lebensjahre schon etwas weiter. Deshalb war es in dem Fall recht klassisch, dass sie verzichtet hat. Als ich jedoch aus der Politik ausgeschieden bin, war es genau umgekehrt. Da sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass jetzt genug ist. Vermutlich wäre ich ohne den Klartext meiner Frau noch länger in der Politik geblieben.“ Gleichberechtigung wird in der Familie Steinberger-Kern offenbar sehr großgeschrieben, und so ist es nicht nur dem Ex-Kanzler möglich, Karriere zu machen, sondern auch seiner Frau. Zwei Jahre nach der Geburt der gemeinsamen Tochter machte sie sich in der Energiebranche selbständig. 2014 gründete Eveline Steinberger-Kern ein Unternehmen in Israel und ist neben Managementtätigkeiten dort derzeit auch noch Mitglied im Aufsichtsrat zweier großer Konzerne.


