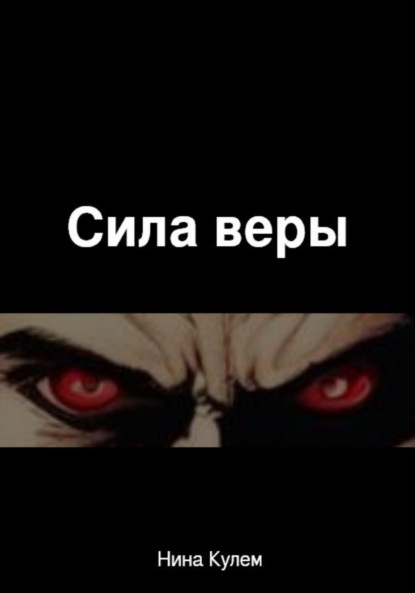- -
- 100%
- +
„Der war nicht nur Professor, sondern auch Priester. Hatte auch noch als Toter diesen Kragen um den Hals. Noch als Leiche was Besonderes! Und wer den umgebracht hat, das möchte ich auch gern wissen. Nee, falsch, das muss ich sogar wissen. Ich habe den Fall übertragen bekommen. Aber“, er trank die Flasche leer, stand auf und ging zum Kühlschrank, um sich Nachschub zu besorgen, „das ist nicht so leicht. Wir haben erst mal keine Spur. Da gehen so viele Leute ein und aus. Das kann jeder gewesen sein.“
„Ist denn etwas gestohlen worden?“, wollte Beate Kellert wissen. „Nicht, soweit wir das bis jetzt feststellen konnten“, gab ihr Mann zurück und trat sanft nach dem Kater, der mit seinen Zehen spielen wollte. „Hau ab, du Vieh“, sagte er halb im Ernst, denn eigentlich mochte er keine Katzen. Aber wie so oft hatte seine Familie ihn bei der Anschaffung überstimmt.Ihre Tochter Jenny wollte halt als Zehnjährige unbedingt eine Katze. Um ihr den damaligen Schulwechsel zu erleichtern, hatte er zähneknirschend zugestimmt.
Inzwischen hatte sich Bernd Kellert an den Mitbewohner ganz gut gewöhnt. „Vieh“, nannte er den großen Kater meistens, aber natürlich hatte er auch einen richtigen Namen: ‚Barry‘. ‚Typisch‘, dachte er oft, ‚da schafft man sich so ein Vieh für die Kinder an und dann gehen sie. Was bleibt, ist das Vieh!‘
Für solche Gedanken war jetzt aber kein Platz. Kellert erzählte weiter: „In dem Büro, wo man ihn erschossen hat, war alles aufgeräumt. Geld oder Wertsachen gibt es dort sowieso nicht. Und auch die Computer waren alle noch an ihrem Platz. Aber wir überprüfen das noch. Die haben da eine ziemlich fitte Sekretärin, die kennt sich wohl am besten aus. Die hat ihn auch gefunden, steht aber noch unter Schock. Aus der war heute kaum etwas herauszubekommen.“
„Rrrunnter!“, brüllte er den Kater an, der auf die Sofalehne gesprungen und gerade dabei war, seine Krallen in den Stoffüberzug zu schlagen. Bernd Kellert nahm einen Teil des auf dem Tisch liegenden Friedensberger Anzeigers, rollte ihn zusammen und schlug nach dem Tier. „Runter!“
„Hey, lass Barry in Ruhe“, fuhr ihn seine Frau an, während das Tier langsam auf den Boden sprang, davor aber wie absichtlich noch einen kleinen Faden aus dem Bezug gerissen hatte. „Na, das kann ja eine nette Woche werden“, meinte Beate Kellert mit süßsäuerlichem Unterton. „Aber das bin ich ja gewohnt. Komm, ich massiere dir ein bisschen den Nacken, hm?“
Sie wusste, dass ihr Mann dabei am besten entspannen konnte. „Und, wie war dein Tag?“, fragte er, nachdem er Barry auf den Balkon gelassen hatte, von wo aus er die ganzeNachbarschaft unsicher machen konnte. Der Kater lebte mehr draußen als drinnen. Frech, klug und stark, wie er war, kontrollierte er das Tierleben der ganzen Nachbarschaft. Bernd Kellert setzte sich zu seiner Frau auf das Sofa, und beide wussten, dass er eine Antwort auf seine Frage gar nicht hören und sie auch gar keine geben wollte.
Dienstag, 11. Mai, vormittags
Ein Mord, viele Fragen
„Liebe Kolleginnen und Kollegen!“ Prodekan Hermann-Josef Kösters versuchte sich Gehör zu verschaffen. Nur langsam starb das aufgeregte Gemurmel und Getuschel um ihn herum ab. Mehr als fünfzehn Personen hatten sich im Beratungszimmer der Fakultät eingefunden. Unter den zumeist gestrengen Blicken der Porträts von ungezählten Dekanen der Fakultät, gemalt oder fotografiert jeweils zur Beendigung ihrer Amtszeit, hatten sie sich an die zu einem Rechteck zusammengestellten Tische gezwängt, verwickelt in hektische Gespräche.
Alle waren der Einladung zur außerplanmäßigen Sitzung gefolgt, die ihnen per Mail oder Anruf zugegangen war. Neben Kösters waren die verbliebenen zehn amtierenden Professoren erschienen, außerdem die Religionspädagogin Klara Mechtersheim als einzige Frau im Professorium, ferner drei Damen und zwei Herren aus dem Mittelbau, daneben – ungewohnt blass und mit noch immer verweinten Augen – Dekanatssekretärin Silvia Hoberg und, zur allgemeinen Überraschung, die Studentin Verena Obmöller.
„Nun kommen Sie doch bitte zur Ruhe!“, ermahnte Kösters die Anwesenden. „Bitte sehr: Kolleginnen und Kollegen!“ Er musste jetzt doch die Rolle spielen, die er sich so gern noch erspart hätte. Aber es half alles nichts, als Prodekan oblag ihm die Übernahme der Dienstgeschäfte und der Verantwortung.
Kösters hatte am Vorabend noch den seit drei Jahren emeritierten Altdekan Füstner – immer noch als graue Eminenz im Hintergrund des Fakultätslebens aktiv – angerufen und um Unterstützung gebeten. Aber der Ruheständler hatte nur gesagt: „Nein, das werden Sie selbst übernehmen müssen, Kösters. Tut mir leid – und: Kopf hoch!“ Nun lag es also an ihm, die Situation so gut wie möglich zu meistern. Es galt vor allem, die Form zu wahren.
„Liebe Kollegin“ – hierbei verbeugte er sich leicht zu Frau Mechtersheim – „liebe Kollegen. Sie wissen, warum ich Sie hierhergebeten habe. So unfassbar das für uns alle ist: Unser Dekan, Professor Anton Gerstmaier, ist ermordet worden. Ich habe Sie zusammengerufen, um Sie über den Stand der Dinge zu informieren und um über das weitere Vorgehen zu beraten.“
„Wann ist der Mord denn passiert?“, rief Professor Schulze-Vorrath dazwischen, ein absichtsvoll ungepflegt wirkender Mittfünfziger mit wirren grauen Haaren und Drei-, eher Fünftagebart. Schulze-Vorrath war Fundamentaltheologe, bildete sich auf seinen offen zur Schau getragenen Nonkonformismus etwas ein, war aber der deutschlandweit und auch international bekannteste Theologe seiner Fakultät. Er hatte mehrere erfolgreiche Bücher über den interreligiösen Dialog verfasst und war als Experte in diesem Bereich in Radio und Fernsehen ein viel gefragter Mann.
„Bitte lassen Sie mich in Ruhe berichten. Ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten, aber der Reihe nach!“ Kösters blickte – um Unterstützung bittend – in die Runde und hoffte, sein geplantes Vorgehen durchsetzen zu können. Zustimmendes Kopfnicken! „Genau“, stimmte ihm einer zu. „Ja, das ist besser“, ein anderer.
Schulze-Vorrath hatte nur wenige Freunde im Kollegium. Den einen gefiel seine selbstdarstellerische Art nicht, andere waren insgeheim neidisch auf seinen Erfolg, obwohl sie seine Bücher als populistisch abtaten und dagegen den wissenschaftlichen Ernst und Wert der wenigen eigenen Veröffentlichungen hervorhoben. Nun lehnte sich Schulze-Vorrath brummelnd zurück, kreuzte die Arme und wartete ab, was passieren würde.
„Danke!“ Kösters nickte in die Runde. „Ich schildere Ihnen nun, was wir bislang über den Verlauf des Geschehens wissen. Ein gewisser Hauptkommissar Kellert von der Kripo wird in – Moment“, er blickte auf seine Armbanduhr, „in einer Viertelstunde bei uns sein und uns befragen.“ „Wieso das denn?“, platzte Dr. Schachner, einer der anwesenden wissenschaftlichen Mitarbeiter, dazwischen, fing sich dafür aber nur einen tadelnden Blick von Kösters ein.
„Also, was ich von Kommissar Kellert weiß, ist Folgendes“, fuhr dieser unbeirrt fort: „Gerstmaier war wie jeden Freitag noch lange in seinem Büro. Es ist ja bekannt, dass er freitags oft noch lange hier im Haus ist. Frau Hoberg ging – wie immer – um ein Uhr nach Hause.“ „Stimmt nicht, ich war noch bis halb zwei da“, unterbrach diese ihn mit leiser, aber bestimmter Stimme. „Ich musste noch das Protokoll vom Fakultätsrat fertig tippen.“
„Gut, also bis halb zwei. Frau Obmöller hatte noch bis ungefähr um vier Uhr im Dekanatsbüro zu tun, stimmt’s?“ Er nickte der Studentin aufmunternd zu, die das Wort ergriff. Sie war eine gerade im Fachbereich Theologie auffallende Erscheinung. Lange schwarze Haare, dezent geschminkt, selbstbewusst gekleidet und – wie Kösters aus einem Seminar wusste – wissbegierig, fleißig, intelligent und redegewandt.
„Ja, ich war bis kurz nach vier hier“, bestätigte sie. „Ich musste die Einladungen für den Gastvortrag übernächste Woche fertig machen. Kurz bevor ich ging, schaute Gerstmaier, ich meine: der Herr Dekan, noch einmal herein. Er suchte etwas in den Ordnern, fand es aber wohl nicht. Mit mir hat er kein Wort geredet, aber das“ – sie blickte sich im Kreis Verständnis heischend um und ihr Blick blieb bei der Sekretärin haften – „das hat er eigentlich nie getan. War also nichts Besonderes.“
„Haben Sie sich noch von ihm verabschiedet?“, fragte unvermutet Professor Günter Brossl, ein junger Kirchengeschichtler, der erst vor einem halben Jahr an die Universität Friedensberg berufen worden war. Verena Obmöller schaute ihn kurz an und meinte dann: „Nee, das haben wir nie gemacht, das hätte ihn doch auch nur gestört!“
„In jedem Fall“, so ergriff Kösters nun wieder das Wort, „sind Sie damit die Letzte, die den Dekan noch lebend gesehen hat.“ „Bis auf den Mörder“, flüsterte die Religionspädagogin Klara Mechtersheim dazwischen, gerade laut genug, dass jeder es hören konnte. Erschrocken legte sie sich die Hand auf den Mund, zog den Kopf zwischen die Schultern und wurde rot.
Der Prodekan sprach ungerührt weiter: „Der Tod von Kollege Gerstmaier muss zwischen zehn und elf Uhr am gleichen Abend, also mindestens sechs Stunden später eingetreten sein. So lautet zumindest die Auskunft von der Gerichtsmedizin drüben in der Gmeinerstraße. Was Gerstmaier in dieser Zeit gemacht hat, ob er noch Termine hatte, ist noch nicht bekannt. Von hier aus telefoniert hat er nicht, zumindest nicht von den offiziellen Telefonen. Oder hat irgendjemand von Ihnen noch Kontakt zu ihm gehabt?“, fragte Kösters in die Runde.
Das hätte er besser nicht getan. Sofort erhob sich ein Getuschel und Gemaule, in dem man kaum das eigene Wort verstehen konnte: „Wieso Kontakt?“ „Ich war doch in Tübingen auf dem Ethikerkongress!“ „Freitags, dass ich nicht lache!“ „Mit dem spreche ich schon seit sieben Monaten nicht mehr!“ „Unverschämtheit!“ …
Kösters wollte gerade wieder um Aufmerksamkeit bitten, als ein lautes Klopfen an der Tür zu hören war. „Entschuldigung.“ Mit diesen Worten trat Sebastian Tränkner, seines Zeichens ausgebildeter Schreiner und nun fünfundzwanzigjähriger Student der Diplomtheologie, Mitglied der Fachschaft und studentischer Vertreter im Fakultätsrat, ein und wies einem energisch eintretenden Mann Anfang vierzig den Weg. „Hier ist der Herr Kommissar Kellert.“
‚Erstaunlich, wie folgsam der eben noch so wild durcheinanderredende Haufen plötzlich den Worten des Kommissars lauscht‘, dachte Kösters, froh, die Gesprächsführung an den Polizisten abgeben zu können. „Wir tappen noch völlig im Dunkeln“, sagte der, nachdem er sich am Kopfende des Tisches aufgebaut hatte. Die Anwesenden konnten es kaum spüren, aber Kellert war sich unsicherer als sonst. Wie geht man mit Professoren um? Wie redet man zu Priestern? Das war ein Gebiet, in dem er überhaupt keine Erfahrung hatte.
„Einfach so sein wie immer“, hatte ihn seine Frau Beate ermuntert. Er versuchte, ihren Ratschlag zu befolgen. „Bitte verstehen Sie, dass ich deshalb mit jedem von Ihnen sprechen muss.“ „Geh, sie verdächtigen doch nicht etwa uns?“, rief mit tief bellender Stimme und unverkennbar österreichischer Dialektfärbung Elmar Maria Brandtstätter, ein mindestens eins neunzig großer, rundgesichtiger Mann mit mächtigem Körper, der Pastoraltheologe der Fakultät.
„Nein, nein“, beschwichtigte Kellert und strich sich durch sein millimeterkurz geschnittenes blauschwarz schimmerndes Haar, „aber wir müssen alle relevanten Informationen zusammentragen. Ich bitte Sie um Verständnis und um Ihre Kooperation.“ „Selbstverständlich werden wir Ihnen in allem nach bestem Vermögen helfen“, versicherte Kösters, der sich nun aufgefordert sah einzugreifen, eilfertig.
„Wir alle haben das größte Interesse, dieses furchtbare Verbrechen so schnell wie möglich aufzuklären. Eine Bitte habe ich jedoch, Herr Kommissar: Wenn es geht, bitte ich Sie darum, den Studienbetrieb so wenig wie möglich mit den Ermittlungen zu belasten. Die Studierenden sind schon so total ausgelastet und ziemlich verstört.“ „Jep“, ließ sich Verena Obmöller vernehmen und Schulze-Vorrath ereiferte sich: „Mein Seminar gestern, das konnte ich völlig vergessen!“.
Kommissar Kellert blickte in die Runde und sagte dann: „Also versprechen kann ich nichts. Aber ich werde tun, was in meiner Macht steht, damit Ihr Betrieb hier so normal wie möglich weitergehen kann.“ Dabei schlug er mit der rechten Hand einen großen Bogen. „Darf ich Sie nun bitten, mir einzeln einige Fragen zu beantworten? Können wir dazu vielleicht in Ihr Büro gehen?“, fragte er Kösters. „Das Dekanat wird ja noch vom Spurendienst untersucht.“
Bevor Kösters antworten konnte, wurde er von Frau Hoberg unterbrochen. „Entschuldigen Sie, Herr Kommissar!“, stammelte sie. „Kellert, bitte nennen Sie mich einfach Kellert“, sagte er in die Runde. „Was gibt es denn?“ „Mir ist noch etwas aufgefallen. Ich glaube, dass einige Akten fehlen. Bei mir im Büro, aber auch im Zimmer vom Chef, äh, vom Herrn Dekan. Ich weiß aber nicht genau, was. Er hat sich seine Unterlagen meistens selbst geholt und zusammengestellt, wissen Sie. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da einiges fehlt.“
Aufmerksam hatte Kellert zugehört und pfiff sich kaum hörbar durch die Zähne. Eine erste Spur! Niemand lässt grundlos Akten verschwinden! Das vergrößerte die Wahrscheinlichkeit, dass der Tod des Dekans etwas mit seiner Arbeit hier an der Universität zu tun hatte. Womöglich war einer der Anwesenden in den Mord verstrickt. ‚Sei vorsichtig! Hör genau hin, auch auf die Zwischentöne! Stelle die richtigen Fragen! ‘, gab er sich mit auf den Weg.
„Danke, Frau, äh“ – „Hoberg“ – „Ja, danke für die Information, das ist sehr wichtig. Bitte versuchen Sie herauszufinden, was genau alles fehlt. Ich werde Mansfeld, meinen Kollegen von der Spurensicherung, gleich anweisen, dass er Sie in das Dekanszimmer hineinlässt und dort mit Ihnen auf die Suche geht. Wir aber“ – hier wandte er sich an die Übrigen – „sollten uns im Zimmer des Herrn Prodekan unterhalten. Kommen Sie bitte mit!“
Dienstag, 11. Mai, abends
Pizza, Pasta und ProfessorInnen
Ganz dezent untermalte italienische Musik die gedämpften Gespräche und Geräusche bei ‚Da Luigi‘. Eine geschmackvolle Einrichtung betonte zwar den italienischen Charakter des Ambientes, versagte sich aber jeglichen Eindruck von billigem Kitsch. Die Tische standen so weit voneinander entfernt, dass man sich an jedem von ihnen ungestört unterhalten konnte. Bernd Kellert hatte die Idee gehabt, sich abends hier mit seiner Frau zu verabreden. Das würde ihm lange Wege ersparen und sie würde sich auf den Abend bei gepflegten Speisen in angenehmer Atmosphäre freuen.
Gerade hatten sie sich über ihre Kinder ausgetauscht. Tobias studierte Wirtschaftsingenieurswesen im zweiten Semester in München. Er hatte die Metropole ihrer überschaubaren Universitätsstadt vorgezogen. „Friedensberg, da kennt jeder jeden“, hatte er zum Abschied gesagt. „Das ist mir zu klein und zu eng, große Tradition hin oder her.“ Und Jenny, die inzwischen sechzehnjährige Tochter, war gerade für ein Jahr an einer Austauschschule in Leeds in Nordengland.
Beate Kellert fiel es auch nach mehr als acht Monaten nicht leicht, nach so langer gemeinsamer Zeit ohne ihre beiden Kinder zu leben. Selbst Barry, der Kater, war die meiste Zeit unterwegs. Sie hätte sich gern noch einen Hund angeschafft. „Zu Hunden kann man eine ganz andere Beziehung aufbauen als zu Katzen“, sagte sie immer. „Außerdem sind sie treu. Treuer als Männer …“
Aber erstens war ihr Mann, der diesen letzten Halbsatz nur kopfschüttelnd und schweigend zur Kenntnis nahm, alles andere als begeistert von dieser Idee und zweitens: Solange der Kater in ihrem Haushalt lebte, war das Ganze sowieso nicht mehr als nur ein Hirngespinst „Hund und Katze, ich glaube du träumst!“, hatte Bernd Kellert geknurrt, als sie diesen Gedanken einmal probehalber ausgesprochen hatte. Der Kater gehörte ja eigentlich Jenny, aber nun kümmerte sich eben hauptsächlich ihre Mutter darum. Sie war halbtags in einer Steuerkanzlei tätig, aber diese Tätigkeit füllte sie nicht wirklich aus.
„Ehrlich, Bernd, ich freue mich, wenn Jenny im Juli wieder nach Hause kommt“, sagte sie gerade. Ihr Mann, der soeben dabei war, die letzten Reste seiner ausgezeichneten Spinatlasagne zu vertilgen, brummte zustimmend mit vollem Mund. Mutter und Tochter hatten in den letzten Jahren einige heftige Auseinandersetzungen miteinander ausgetragen. Er war gespannt, wie sich ihr Verhältnis nach diesem Jahr weiterentwickeln würde.
„Na ja, Tobias kommt ja am nächsten Wochenende auch mal wieder vorbei“, sagte er, nachdem er den Bissen heruntergeschluckt und einen Schluck Rotwein getrunken hatte. Die beiden blickten sich eine Zeit lang schweigend an. Nach einundzwanzig Ehejahren waren sie es durchaus gewohnt, dass man nicht unbedingt immer reden musste. Sie wussten, wann man dem anderen die Zeit für eigene, nicht mitgeteilte Gedanken lassen musste. Dann brach Beate das Schweigen.
„Und wie geht’s deinem toten Professor? Also ich meine: Was macht dein Fall mit diesem Theologen?“ Bernd Kellert atmete tief durch und blies die Wangen auf. „Puhh, nicht so leicht. Eine richtige Spur haben wir noch nicht. Aber hoi, also bei denen arbeiten möchte ich nicht!“ „Wieso das denn?“ „Na, da herrscht eine Spannung, dagegen ist das bei der Polizei richtig angenehm. So etwas von … Verschrobenheit, von Neid und Eifersucht! Da gönnt keiner dem anderen auch nur den Dreck unter dem kleinen Fingernagel!“
Dann besann er sich. „Das gilt bestimmt nicht für alle, okay. Manche duzen sich sogar, aber das ist die Ausnahme. Kannst du dir das vorstellen: Arbeiten dreißig Jahre zusammen und siezen sich! Das sagt doch alles!“ Beate seufzte zustimmend und fragte dann nach: „Ja, und der Fall?“
„Schwierig, schwierig! Diese Uni ist ja ein offenes Haus, da kann jeder raus und rein. Es gibt eine Bibliothek, die hat wochentags bis dreiundzwanzig Uhr geöffnet. … Eh, Moment …“ Er winkte einen vorbeigehenden Kellner herbei: „Für mich noch einmal einen Rotwein, den Chianti. Für dich auch?“ Er blickte zu seiner Frau. Als diese kaum merklich nickte, verbesserte er sich: „Also zwei, noch zwei Chianti bitte!“
Er lehnte sich wieder bequem zurück und fuhr fort: „Und der Dekan, also dieser Professor Gerstmaier, hat alle möglichen Feinde gehabt. War total unbeliebt. Aber ein Motiv, ihn umzubringen, sehe ich beim besten Willen nicht.“ „Unbeliebt, wieso?“ „Na ja, das war wohl so ein sturer Paragraphenheini. Kannte alle Vorschriften und jeden Gesetzestext und hat alle anderen damit genau kontrolliert und gegängelt. Und das mögen Professoren offenbar gar nicht. Der war noch gar nicht so lange hier in Friedensberg. Ist erst mit über fünfzig Professor geworden und wollte es deswegen denen zeigen, die das schon mit Ende dreißig oder Anfang vierzig geworden sind. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ehrlich, ich habe mit nicht einem geredet, der wirklich positiv über den Dekan gesprochen hat.“
„Furchtbar!“, gab Beate Kellert zurück. „Das wird für den ja auch nicht gerade angenehm gewesen sein, oder?“ „Ich weiß nicht“, gab ihr Mann zurück. „Es gibt eben Typen, die sich am wohlsten fühlen, wenn die anderen Angst vor ihnen haben. Denen wird bei Freundschaft und Nähe richtig unwohl. Da könnte ich dir bei uns auch einige nennen. Außerdem haben fast alle übereinstimmend bestätigt, dass die Atmosphäre an der Fakultät vor ein paar Jahren viel besser war. Richtig familiär. Gerstmaier wird von den meisten als Urheber dieser unguten Entwicklung genannt. Richtig traurig hat deshalb keiner auf mich gewirkt. Geschockt schon, fassungslos – ja, aber traurig – nein.“
Der Kellner brachte zwei frisch gefüllte Rotweinpokale und räumte das fast komplett geleerte Geschirr fort. „Hat es geschmeckt?“, fragte er in routinierter Höflichkeit. „Ja, danke, war sehr gut“, antwortete Beate Kellert automatisch. „Ein Nachtisch oder vielleicht ein Espresso?“ „Später vielleicht“, brummte ihr Mann, der offensichtlich in Ruhe seinen Rotwein genießen wollte. Er führte das Glas zum Mund, blickte seiner Frau in die Augen, lächelte und sagte in gespielter Förmlichkeit „Zum Wohlsein“, doch statt zu trinken, setzte er das Glas abrupt ab.
„Moment, das ist doch …“ Schon war er aufgesprungen und eilte zwei Personen entgegen, die soeben das Lokal betreten hatten, und sich – vergebens – nach einem leeren Tisch umschauten. Wenig später kam er mit den beiden auf den von ihm und seiner Frau besetzten Tisch zu, an dem noch zwei freie Plätze waren. Beate Kellert wunderte sich. Normalerweise hasste ihr Mann es, wenn er beim Essen gedrängt saß.
Doch schon traten die drei an den Tisch. Der Unbekannte war ein fülliger, bulliger, auffällig großer Mann Ende fünfzig, gekleidet mit einer nicht mehr ganz neuen Jeans, einem offenen karierten Hemd und einem lässigen braunen Cordsakko; die Frau eine eher zierliche Dame undefinierbaren Alters mit einem zeitlosen lindgrünen Kostüm und streng gescheiteltem kurzem braunem Haar, wirkte an der Seite ihres Begleiters zerbrechlich und fühlte sich sichtlich unwohl. Ihre Finger spielten nervös mit einer kleinen ledernen Handtasche.
„Darf ich vorstellen?“ Bernd Kellert ließ erst gar keine Peinlichkeit aufkommen. „Das ist meine Frau Beate, und dies sind Frau Mechtersheim und Herr, äh“ – „Brandtstätter, Elmar Maria Brandtstätter.“ „Freut mich“, sagte Beate Kellert, erhob sich, gab beiden die Hand und wies auf die beiden freien Plätze: „Setzen Sie sich doch zu uns.“ Mit fragend hochgezogener Augenbraue blickte sie zu ihrem Mann, weil ihr immer noch nicht klar war, warum er so völlig gegen seine Gewohnheiten ihm ja offensichtlich kaum bekannte Menschen an seinen, an ihren Tisch bat.
„Frau Mechtersheim und Herr Brandtstätter sind Professoren an der Theologischen Fakultät“, klärte er sie auf. „Und ich dachte, wir könnten hier vielleicht einiges ganz ungezwungen bereden, oder?“, wandte er sich an die beiden. „Von mir aus gern“, meinte der massige Mann. „Hauptsache, ich bekomme bald etwas zu essen. Ich habe heute wirklich nicht eine Minute Zeit gehabt, etwas zu mir zu nehmen. Du auch, Klara?“ ‚Aha, also doch eine Duz-Beziehung!‘, dachte Beate Kellert.
„Ja, ich nehme die Dorade auf Rucola und wie immer einen gemischten Salat“, entgegnete die Frau, die sich nach wie vor nicht sonderlich wohl zu fühlen schien. Brandtstätter bestellte für sie beide – für sich eine Pizza Hawaii, extragroß.
‚Nicht unbedingt das, was man abends bei einem Edelitaliener bestellt‘, dachte Beate Kellert, die das leichte Stirnrunzeln des Kellners sehr wohl bemerkt hatte. Ihr Blick streifte kurz die Augen von Frau Mechtersheim, die ihr Verständnis heischend zublinzelte, als wollte sie sagen: ‚So ist er nun einmal!‘
Brandtstätter schien das alles wenig zu stören. Er hatte die Speisekarte beiseitegelegt und wandte sich nun wieder dem Kommissar zu: „Was wollen Sie denn noch wissen, Herr Kommissar? Wir haben doch schon alles Wichtige zu Protokoll gegeben, oder?“ Bevor Kellert antworten konnte, mischte sich seine Frau ins Gespräch. „Entschuldigung, darf ich mal was ganz Einfaches fragen? Also, ähm, wie sag ich das denn jetzt? Sind Sie beide wirklich Theologieprofessoren? Ich habe mir die irgendwie anders vorgestellt, also in Schwarz und mit Brille oder so. Und Sie als Frau?“
Hier wandte sie sich an Klara Mechtersheim. „Ich wusste gar nicht, dass es weibliche Theologieprofessoren gibt. Geht das denn? Ich dachte, das sind alles Priester!“ Brandtstätter lachte, sein mächtiger Körper bebte und sein Bass dröhnte durchs Lokal. „Soso, das verbinden Sie also mit einem Theologieprofessor“, sagte er dann, als er sich wieder beruhigt hatte und sich auch die verwunderten Gäste von den Nachbartischen wieder ihren eigenen Angelegenheiten zuwandten. „Ja, solche Typen haben wir auch im Kollegium, stimmt schon. Aber nicht nur. Und …“, nun fixierte er Beate Kellert, „… denken Sie, ich wäre ein Priester?“
„Oh.“ So unerwartet direkt befragt, geriet Beate Kellert ins Stottern. Hilfesuchend blickte sie zu ihrem Mann, aber der schaute ausdruckslos an ihr vorbei. ‚Wenn du dich schon einmischst, dann musst du auch die Konsequenzen tragen‘, schien dies auszusagen. „Nein“, sagte sie dann, „sind Sie nicht. Oder doch?“, fragte sie nach.
Wieder fuhr ein Lachreiz durch den mächtigen Körper, aber dieses Mal unterdrückte Brandtstätter ihn. „Falsch getippt, Gnädigste“, sagte er in bewusst übertrieben breiter österreichischer Höflichkeit. „Wissen Sie, ich bin Ordenspriester. Aber wir leben nicht im Kloster, sondern haben uns auf soziale Arbeit spezialisiert. Wir leben bei denen, die uns brauchen. Und glauben Sie, das geht: Bei den Arbeitslosen herumlaufen mit Anzug und Krawatte? In die Asylunterkünfte gehen in edlem und teurem Zwirn? Vierzehn Jahre habe ich bei denen gelebt, bei den Ärmsten der Armen, die man nicht sieht und nicht sehen will. Und als ich dann hier Professor für Pastoraltheologie wurde, habe ich mir geschworen, diesen Menschen treu zu bleiben. Ich muss denen noch in die Augen sehen können, verstehen Sie? Und das ist schwer genug, wenn Sie ein gesichertes und regelmäßiges Professorengehalt beziehen. Wenn Sie ständig mit den feinen Damen und Herren des Bildungsbürgertums und der Kulturschickeria zu tun haben.“