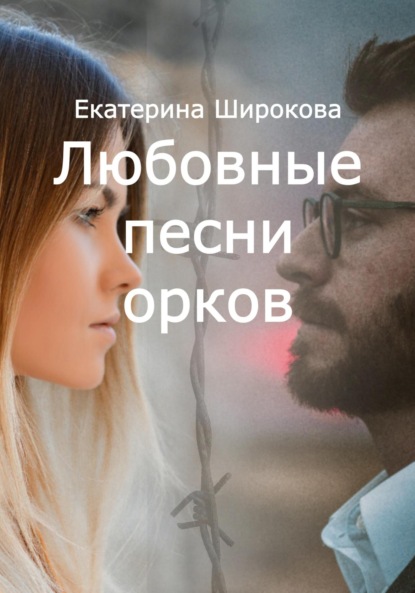- -
- 100%
- +
Wie unbedacht von Felix! Wenn Mila nicht dichthält, sind wir beide dran. Ich werfe ihm einen warnenden Blick zu.
„Im Gesicht merke ich gar nichts“, wiegle ich ab. „Wenn er zu reden anfängt, überkommt mich manchmal ein komisches Gefühl. Aber das geht doch jedem so.“
Da bricht es aus Mila heraus: „Mein Vater verabscheut den Sark auch! Das sagt er natürlich nicht laut, aber das Sektorbüro hat es trotzdem irgendwie spitzgekriegt. Jetzt haben sie ihn auf dem Kieker und wollen ihm wegen aufsässiger Gesinnung seinen Rauring wegnehmen. Dabei kann er mit seinem schwachen Herz sowieso schon nicht mehr an den Pipelines arbeiten!“ Milas Stimme ist ungewohnt laut geworden. Als sie das merkt, zieht sie verschämt den Kopf ein und schiebt leise nach: „Wenn er den Ring auch noch verliert, ist er ein Niemand, eine Unperson. Mit dem Register-Chip ist er auf einen Schlag sein Konto los und seine ganze Rente. Deshalb will ich Adoptin werden.“
Mila beißt sich auf die Lippe, als hätte sie Angst, sich verplappert zu haben. Am liebsten würde ich sie ganz fest drücken. Schließlich weiß ich jetzt, dass ich den schleimigen Sark nicht als Einzige hasse.
„Ich muss für meinen Vater sorgen“, rechtfertigt sie sich. „Seit dem Tod meiner Mutter hat er doch nur noch mich.“
„Hast du auch keine Geschwister, so wie Emony und ich?“, fragt Felix.
„Nein“, antwortet Mila, einen Tick zu energisch.
Meine Ohren kribbeln. „Bist du wirklich ein Einzelkind?“
Milas Mund bleibt eine Sekunde lang offen stehen. „Jetzt schon. Mein großer Bruder ist spurlos verschwunden. Vor einem Jahr.“ Sie zieht die Knie wieder an die Brust und legt ihren Kopf darauf. Mehr will sie nicht erzählen.
Ich weiß genau, wie es ihr geht.
Endlich ruft uns der Lautsprecher ins Medizinzentrum. Felix springt auf und verschwindet in Richtung Schlafsaal, um seinen Talisman unter der Matratze zu verstecken, bevor uns die Ärzte filzen. Wieder taste ich nach meiner Rauring-Kette, die nun unter dem hochgeschlossenen Hemdkragen verborgen ist. Hoffentlich nehmen sie mir die nicht weg. Sie ist zusammengelötet und hat keinen Verschluss. Um sie abzunehmen und zu verstecken, hätte ich sie kaputt machen müssen. Aber das hätte ich nie übers Herz gebracht, denn diese Kette ist die einzige greifbare Verbindung zu meinem Vater. Die kann ich unmöglich zerreißen.
Während ich über all das nachgrüble, sind Mila und ich in dem fensterlosen, aber von kühlen Lichtfeldern taghell erleuchteten Untersuchungsraum angekommen. Schnaufend schließt auch Felix zu uns auf. Die Untersuchung soll mit einer Blutabnahme beginnen, erklärt uns eine Tonbandstimme. Zur individuellen Anpassung unseres Nomen-Implantats seien umfangreiche Labortests notwendig. Blutgruppen, Rhesusfaktoren, Rezeptorstrukturen, blabla, schwafel, schwafel. Jedes Implantat ein Unikat! Und ganz nebenbei werde uns die große Ehre zuteil, mit unserer Blutspende der weiteren Nomen-Forschung zu dienen.
„Und wenn ich nix spenden will?“, sagt Felix grummelnd, wobei er unruhig auf den Zehenspitzen auf und ab wippt.
„Gibt es denn hier keinen Arzt?“, fragt Olya und wickelt nervös eine blonde Locke um ihren Finger.
Als Antwort surrt eine Milchglasscheibe zur Seite und gibt den Blick auf eine Reihe glänzender Stative frei. Darauf sind erschreckend große leere Flaschen montiert, von denen dicke Schläuche herunterhängen. Keller, Kern, Omen … Jede hat ein Namensschild. Sie sollen ganz offensichtlich mit Blut gefüllt werden. Felix schnappt hörbar nach Luft. Alle flüstern aufgeregt durcheinander.
Mit einem Mal nähern sich polternde Schritte. Aufgeregt drehen wir uns um. Das wird doch nicht Tarmo sein? Er ist es. Schlagartig wird es mucksmäuschenstill.
„Wir prüfen jetzt eure Belastbarkeit“, erklärt er mit scharfer, schneidender Stimme. „Schwächlinge haben hier im Trainingslager nichts zu suchen, also sortieren wir frühzeitig aus.“
Nun bleibt selbst Felix die Spucke weg. Sein Mund steht halb offen. Alle Farbe ist ihm aus dem Gesicht gewichen, sogar seine Sommersprossen sind verblasst.
Tarmo klopft auf eine der leeren Flaschen. Es klingt erschreckend hohl, doch der Glatzkopf grinst. „Jetzt stellt sich heraus, was in euch Dörrpflaumen steckt!“
Beim Anblick der blitzenden Stative wird mir schummrig. Aus dem Augenwinkel bemerke ich eine Bewegung. Das Mädchen neben mir ächzt, und ihre Knie knicken ein.
„Das ist die Erste“, verkündet Tarmo höhnisch. Er winkt zwei Helfer herbei, damit sie die Ohnmächtige hinaustragen.
„Wer freiwillig gehen will, tut das am besten jetzt“, sagt er und schaut sich herausfordernd um.
Weil sich keiner meldet, werden die ersten drei an die Blutabnahmeständer angeschlossen und kriegen einen Schaumstoffball in die Hand gedrückt. Den sollen sie rhythmisch quetschen, damit das Blut im Schlauch hochsteigt. Meine Knie fühlen sich wie Pudding an. Ich blicke mich nach einem Stuhl um, allerdings gibt es keinen.
Als ich zusammen mit Mila und einem kräftigen Typen namens Ben aufgerufen werde, versichert mir mein Verstand, dass das machbar sein sollte. Aber mein Bauch ist da anderer Meinung. Mit einem flauen Gefühl im Magen beobachte ich, wie der Arzthelfer meine Unterarme nach einer passenden Vene absucht und die potenzielle Einstichstelle desinfiziert. Ein Zittern geht durch meinen Körper, kaum dass er die metallene, kalte Kanüle in meine Vene schiebt. Meine Finger fühlen sich matt und kraftlos an, doch ich schließe meine Hand um den Quetschball, der die Form einer halben WERT-Weltkugel hat, und drücke zu. Ich konzentriere mich auf das leise Zischen des Erdballs, dem bei jedem Quetschen die Luft entweicht. Im Unterarm spüre ich ein dumpfes Stechen. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Egal. Ich schaffe das.
Der Junge neben mir drückt seinen Ball mit aller Kraft und lockt so dunkelrotes Blut aus seinen Venen. Langsam steigt es in dem durchsichtigen Schlauch hoch und kriecht durch die Windungen wie Sonora, die sich auf das Chamäleon zu schlängelt. Ich wende mich ab.
„Nicht wegschauen“, befiehlt Tarmo. „Guck auf die Flasche! Da drin ist schließlich dein Innerstes.“
Olya fragt, ob die Gefäße wirklich randvoll werden müssen. Grinsend bejaht Tarmo das. Ein kollektives Aufstöhnen erfüllt den Raum.
Dann hören wir nur noch das Gurgeln in unseren Schläuchen. Nicht nur das eklige Geräusch lässt mich genauer hinblicken. Tarmos Antwort auf Olyas Frage hat auch meinen Ohrläppchenbrand ausgelöst. Und da sehe ich es: Die Flasche hat eine doppelte Wand, genau wie der Schlauch. Das Blut muss nur die äußere Gefäßhülle füllen.
Um Felix und Mila meine Entdeckung mitzuteilen, schnalze ich leise mit der Zunge und zeige mit dem Kinn auf die Flasche. Mila schaut mich fragend an, schließlich lächelt sie. Felix dagegen starrt nur blicklos ins Leere. Als Kind ist er einmal gegen einen Generatorkasten geknallt und hat sich eine Platzwunde am Kopf geholt. Es war halb so schlimm, aber er ist umgekippt, weil er sein eigenes Blut nicht sehen konnte. Kein Wunder, dass er jetzt gefährlich schwankt.
Vor lauter Sorge um Felix vergesse ich meine eigene Angst und schaue überrascht auf, als der Pfleger meine Nadel entfernt. Ich habe es geschafft. Wieder einen Schritt näher daran, eine Adoptin zu werden.
6. Kapitel
Im Ruheraum reicht mir ein dunkelhaariger Arzt einen großen Becher mit Trinkhalm. Den Typen kenne ich doch! Das ist das schweigsame Männermodel vom Trainertisch. Dann ist er also gar kein Ausbilder? Schade, in seine Gruppe wäre ich gern gekommen. Seine braunen Augen wirken so … vertrauenerweckend. Der Arztkittel steht ihm genauso wie die Sportjacke, die er gestern anhatte. Ich plumpse in den Sitz neben Mila, die mich schwach anlächelt. Das schaumige Getränk schmeckt intensiv und leicht salzig.
Lange Zeit sind nur Sauggeräusche zu hören. Der Dunkelhaarige beobachtet uns. Ich schätze ihn auf knapp zwanzig. Auf seinem weißen Kittel prangt ein großes WERT-Emblem. Emony, du starrst schon wieder, würde meine Mutter mich jetzt ermahnen. Schnell senke ich den Blick und beschäftige mich mit meinem Trinkbecher.
Wann kommt endlich Felix? Er ist doch fit. Er muss es einfach schaffen. Ohne ihn halte ich es hier nicht aus. Ich atme auf, da er nach einer gefühlten Ewigkeit durch die Tür wankt. Er greift sich einen Becher, als wäre es ein Rettungsseil, und lässt sich in den Sessel neben mir fallen. Seine Nase ist ganz weiß. Geräuschvoll schlürft er das Schaumgetränk bis auf den letzten Tropfen leer, ohne den Arzt zu bemerken, der um unsere Aufmerksamkeit bittet. Erst als ein Mädchen lacht, richtet sich Felix in seinem Sitz auf.
Der Weißkittel sieht Felix stirnrunzelnd an, bevor er sich vorstellt. „Mein Name ist Kohen Sander, ich begleite euer dreimonatiges Trainings- und Auswahlprogramm. Euren Chefausbilder Tarmo habt ihr schon kennengelernt. Auch ich heiße euch herzlich willkommen im Adoptenzentrum von WERT.“
Ich horche auf. Also ist er doch ein Trainer. Unser Trainer! Und er scheint kein besonders großer Fan von Tarmo zu sein. Das hat seine Stimme verraten. Sie war erst voll und warm, ist aber bei der Erwähnung des Chefs eine Oktave tiefer gerutscht. Noch ein Pluspunkt für den Lockenkopf.
Allerdings hat Kohen sich sofort wieder im Griff. „Mit der Blutabnahme habt ihr bereits den ersten Test bestanden“, sagt er. „Sie bereitet gleichzeitig die Nomen-Implantation vor.“
Aufgeregtes Getuschel geht durch unsere Gruppe, doch unter dem strengen Trainerblick legt es sich schnell.
„Ihr seht jetzt einen kurzen Informationsfilm.“ Kohen greift sich an das linke Handgelenk, und in der Luft neben ihm erscheint ein gläserner menschlicher Oberkörper. Das überlebensgroße Hologramm wird durch eine Reihe von Lichtschlitzen aus der Wand in den Raum projiziert. Wir erkennen den menschlichen Blutkreislauf und sehen eine Animation, die Botenstoffe durch röhrenförmige Adern rasen lässt. Dazu erklärt eine körperlose Frauenstimme, dass die Blutabnahme zur Bestimmung unseres Gesundheitszustandes dient und die Form unserer chemischen Stressreaktion testet.
Aha. Soso. Daher also der Schwindel mit den Doppelwand-Flaschen.
Jetzt schwebt ein silbrig glänzendes Nomen-Modul in zehnfacher Vergrößerung im Projektionsraum. Es besteht aus einem dreieckigen Kernstück, das an die Halswirbelsäule andockt, und aus einem kleineren Bedienteil im linken Handgelenk.
„Das Nomen schickt DNA-Sonden ins Blut seines Trägers, um dessen Gesundheitszustand laufend zu überwachen. Entdecken sie ein Gesundheitsrisiko, bildet das Implantat passende Enzyme, die automatisch regulierend eingreifen“, erklärt die Sprecherin.
„Äh, was?“ Felix schaut völlig verwirrt drein.
„Diese sogenannten DNA-Bots senden die notwendigen Wirkstoffe zielgerichtet an erkrankte Zellen, während gesunde unberührt bleiben“, spricht die Frau weiter.
Die Miene von Felix hellt sich auf. „Eingebaute Soforthilfe? Gefällt mir.“
Kohen stoppt die Vorführung mit einem knappen Wink. „Die Nomen-Gesundheitsüberwachung hat sich wirklich bewährt“, versichert er. „Fast jeder Mensch hat Entzündungen im Körper, ohne es zu wissen. Die meldet das Gerät und reguliert sie umgehend.“
Neben mir bewegt sich etwas. Morry betastet den dicken Pickel an seinem Kinn. Alle drehen sich zu ihm um und starren auf die unappetitlichen roten Pusteln in seinem Gesicht.
„Unreine Haut ist eine typische Folge winziger Entzündungsherde“, erläutert Kohen. „Die nächste Animation zeigt an genau diesem Beispiel, wie die Nomen-Technologie funktioniert.“
Morry ist rot geworden wie eine reife Tomate. „Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig“, kommentiert Olya und erntet schallendes Gelächter. Morry krümmt sich förmlich vor Scham.
„Ruhe, oder ich breche die Vorführung ab“, mahnt Kohen knurrend, wobei er unsere Runde mit einem zornigen Blick bedenkt.
„Spaßbremse“, flüstert Olya, dann allerdings verfolgt auch sie mit großen Augen den Holofilm, worin blau glänzende Wirkstoffe in einen eitrigen Pickel eindringen und ihn rückstandsfrei auflösen. Verstohlen zupfe ich an meinen Ärmeln, unter denen sich entzündete Kratzstellen verbergen. Ein unverhofftes Mittel gegen meine Feuerkrankheit! Allerdings wird meine Vorfreude gleich wieder von meinem schlechten Gewissen verdrängt. Für normale Rauringbewohner ist eine so kostspielige medizinische Versorgung unerreichbarer Luxus.
„In Notfällen bestellt das Nomen sofort ärztliche Hilfe an die Position seines Trägers“, fährt die Sprecherin fort. „Dieses fortschrittliche System, das WERT ständig weiterentwickelt, gewährleistet den Adopten optimale medizinische Betreuung, wo immer sie sich befinden.“
Und die totale Überwachung. Mit dem Nomen-Implantat weiß WERT jederzeit, wo wir sind. Irgendwie geht mir das gegen den Strich.
Während der Holofilm die Errungenschaften des innovativen DNA-Datenspeichers anpreist, betritt ein zweiter Arzt den Raum. Sein glattes Gesicht wirkt alterslos, doch die grauen Schläfen deuten auf einen Mittfünfziger hin. Mit dem kerzengeraden Rücken überragt er Kohen und strahlt einschüchternde Autorität aus. Seine altjapanischen Züge bewegen sich keinen Millimeter, bis der Film zu Ende ist. Danach gleitet sein abschätziger Blick über uns und bleibt eine lange Schrecksekunde an mir hängen.
Er räuspert sich. „Ich bin der medizinische Leiter bei WERT und führe jetzt die Nomen-Implantationen durch.“ Ich wippe unruhig mit den Füßen auf und ab. Sich namentlich vorzustellen, hat der wohl nicht nötig.
Mila runzelt die Stirn, bevor ihre Augen kugelrund werden. In ihrer Miene spiegeln sich Ehrfurcht und Sorge wider. Natürlich traut sie sich nichts zu sagen, aber kaum dass die beiden Weißkittel den Ruheraum in Richtung Operationssaal verlassen haben, bricht es aus ihr heraus: „Das ist Dr. Kaishen. Er hat das Nomen quasi erfunden, vor dreißig Jahren, und hat seitdem viele Durchbrüche zur Verbesserung der Technologie erzielt. In Medizinerkreisen ist er berühmt und gefürchtet. Zwei Patienten sollen bei seinen Versuchen schon gestorben sein.“
Abrupt schaut Felix hoch.
„Aber das ist nur ein Gerücht“, schiebt Mila schnell nach. Wie beruhigend.
Nun beginnt das Warten. Nach fünf Minuten holt Kohen den ersten Kandidaten zur Operation ab, Linkskahl Ambos. Der kommt nicht zurück. Stattdessen ist nach weiteren zehn Minuten Rechtskahl dran.
Nach einiger Zeit verstummen die Gespräche. Felix zerbeißt seine Unterlippe, während Mila die Arme so fest um sich schlingt, als würde sie frieren. Ich beobachte die Leuchtziffern der Uhr an der Wand des Wartezimmers, auf der die Minuten unfassbar langsam wechseln. Einmal glaube ich einen gedämpften Laut zu hören, erst kurz, dann langgezogen. Hat da jemand geschrien, drüben im Operationssaal? Das bilde ich mir bestimmt nur ein. Doch Anna hat es auch gehört. Erschrocken verzieht sie das Gesicht. Sie ist die Nächste. Statt des so unbekümmerten Mädchens von gestern schleicht jetzt ein zitterndes Nervenbündel hinter Kohen her.
Mit stumpfem Blick starren wir auf die Muster in den Bodenfliesen, zählen die großen und kleinen Dreiecke zum hundertsten Mal. Als Ben drankommt, ist seine dunkle Gesichtsfarbe einem kränklichen Olivton gewichen. Die Nächste bin ich. Jetzt ticken die Minuten plötzlich schneller herunter. Ich bin noch nicht bereit! Aber schon öffnet sich die Tür. Kohen wirft mir einen ermutigenden Blick zu. Ich hole tief Luft und folge ihm in den Operationssaal.
In dem weißen Raum riecht es antiseptisch. In der Mitte des Zimmers wartet eine weiß glänzende Liege auf mich, daneben ein Stativ mit Infusionsschläuchen, dahinter eine schmale Röhre. Über der Liege schwebt eine komplexe Apparatur aus Edelstahl, die mich zusammenzucken lässt. Nicht wegen der tausend Lämpchen, Schaltflächen und Displays an ihren Seiten, sondern wegen der zangenförmigen Greifarme. Das medizinische Monstrum hängt von der Decke wie eine gigantische Spinne.
Hinter einem transparenten Holoschirm befindet sich Dr. Kaishen. Er hält meine Blutflasche in der Hand und starrt mich an.
Kohen bleibt neben mir stehen. Er wartet auf Anweisungen, allerdings rührt sich der Doktor nicht. Meine Kratzwunden! fährt es mir durch den Kopf. Die erschrecken jetzt schon die Ärzte. Schnell ziehe ich meinen Hemdkragen noch höher und nestle an den Ärmeln herum, um die Wunden zu verstecken.
„Das ist Emony Keller“, sagt Kohen, als die Stille schon peinlich wird.
„Die Akte habe ich vor mir“, erwidert Kaishen scharf. „Ziehen Sie das Hemd aus“, befiehlt er in meine Richtung. Ich gehorche und nehme Platz auf der Liege. In dem verschlissenen, beige-braunen Unterhemd von zu Hause, das ich mir noch mal übergestreift habe, weil ich die kühle Luft nicht gewohnt bin, sitze ich da. Die Hitze steigt mir ins Gesicht, während der Doktor mit kalten Latexhandschuh-Fingern über meinen fleckigen Hals streicht. Seine Oberlippe kräuselt sich, bevor er die Diagnose diktiert. „Ignigitis. Akutes Kratzsyndrom im Schulterbereich, links stärker als rechts. Außerdem an den Armen.“
Kohen nickt und tippt die Angaben in den schwebenden Holoschirm, sicher und konzentriert. Seine Hände sind leicht gebräunt – ganz anders als bei den Männern im Rauring, die unter ihren Schutzanzügen käsebleich bleiben. Mit seinen dunklen Augen wirkt er richtig sympathisch. Jetzt zeigt er auf das weiße Operationshemd, in das ich schlüpfen soll.
Meine Stirn wird noch heißer. Muss ich mein Unterhemd wirklich ausziehen? Vor ihm? Damit er meine hässlichen Kratzwunden sieht? Doch Kohen scheint Gedanken lesen zu können. Sowie ich mein Unterhemd zögernd anhebe, schaut er rücksichtsvoll weg. Erst als meine Finger den Klettverschluss am Rückenschlitz nicht finden, dreht er sich wieder um. Aufmunternd lächelt er mich an. Sein Verständnis verunsichert mich seltsamerweise noch mehr.
Dr. Kaishen öffnet eins der vielen Schubfächer an der Wand und holt eine rote Tube heraus. „Normalerweise heilt das Nomen Hautverletzungen automatisch, aber bei dieser hochgradig chronischen Ignigitis ist zusätzlich eine äußere Anwendung notwendig. Tragen Sie die Salbe zweimal täglich dünn auf, bis die Entzündungen abgeklungen sind.“ Er legt die Tube auf den Beistelltisch, tritt an die Röhre hinter der Liege und erweckt ihre Displays zum Leben. Dann kommt der Satz, vor dem ich mich fast noch mehr gefürchtet habe als vor der ganzen Operation. „Nehmen Sie die Kette ab“, sagt Kaishen, ohne mich anzuschauen. „Metallteile stören die Bildgebung im Venenscanner.“
„Äh.“ Schützend greife ich nach dem Rauringsplitter an meinem Hals. „Das geht nicht. Sie hat keinen Verschluss. Ich kann sie nicht über den Kopf ziehen, sie wurde damals zusammengelötet!“
Meinen panischen Blick nimmt der Doktor gar nicht zur Kenntnis. „Kohen, schneiden Sie die Kette durch“, sagt er, während er sich mit dem surrend anlaufenden Scanner beschäftigt.
Ich umklammere den kantigen Ringsplitter. Furcht steigt in mir hoch. „Nein, bitte nicht! Die Kette ist sehr wichtig für mich!“ Meine Stimme bricht. „Sie … sie ist von meinem Vater.“
„Das lässt sich auch anders lösen“, wirft Kohen ein. Er greift nach einem Isolierband und umwickelt die Kette mit schnellen Handgriffen. „Es ist das gleiche Material wie der Rauring“, sagt er in Kaishens Richtung, während er über meinen Ring ebenfalls eine Isoliermanschette schiebt. Der Doktor kümmert sich nicht weiter darum. Anscheinend ist ihm das WERT-Verbot egal, und ich kann die Kette vorerst noch behalten.
Kohen nimmt meinen dankbaren Blick nicht wahr, weil er sich schon mit dem Verstellen der Liege beschäftigt. Ich muss mich auf dem kalten Kunststoff lang ausstrecken, bevor er mich mit dem Kopf voran in den dunklen Tunnel des Venenscanners schiebt.
Eng ist es hier drin. Verdammt eng! Meine Brust zieht sich zusammen, denn ich kann in beengten Räumen nicht richtig atmen. Schon seit ich klein war, neige ich zu Platzangst. Ich fange an zu schwitzen. Wahrscheinlich ist das schon wieder ein Test, schießt es mir durch den Kopf.
Die Röhre beginnt zu vibrieren, dunkle Klopfgeräusche ertönen von den Wänden um mich herum. Sie wecken meine ständige Furcht vor Erdbeben, vor dem Eingesperrtsein. Die Angst, nicht weglaufen zu können, wenn die Betonwände Risse bekommen. Die Panik, über mir könnte die Decke einstürzen und mich im Untergrund zerdrücken. Erst vor einem Jahr gab es einen katastrophalen Erdstoß in einer Nachbarsiedlung. Die Bilder der Verschütteten habe ich noch deutlich vor Augen.
Kaishens Stimme holt mich aus den schrecklichen Gedanken. Meine Liege bewegt sich und fährt mit mir aus der Röhre heraus. Erleichtert atme ich auf.
Der Arzt sitzt vor einem überlebensgroßen 3D-Hologramm meines Oberkörpers. Meine Haut erscheint darin transparent; die Knochen leuchten bläulich. Ich sehe mein Herz in Echtzeit schlagen und das Blut durch die Arterien pulsieren.
Das sind also meine inneren Werte.
Ein Lautsprecher überträgt meine Herztöne. Das dumpfe Pochen klingt seltsam unheimlich. Es erinnert mich an die unruhigen Nächte zu Hause, wenn ich in der stickigen Hitze unserer Wohnung nicht schlafen kann und auf meinen eigenen Herzschlag horche, der manchmal aus dem Takt gerät.
In meinem Hologrammkörper taucht nun das dreieckige Nomen-Nackenteil auf. Ein Blitz zuckt heraus und fährt in meine virtuelle Wirbelsäule. Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Was hat der Arzt vor? Ungerührt wiederholt er die Prozedur an meinem holografischen Arm.
Kohen hat meine Anspannung registriert. Kein Wunder, ich habe einen Puls von hundertvierzig. Leise spricht Kohen auf mich ein. Ich mag es, wie er das R rollt, denn es klingt irgendwie vertraut. Seine genauen Worte kommen nicht in meinem Bewusstsein an, aber seine samtene Stimme beruhigt mich. Er hat heute schon zig Operationen begleitet und kümmert sich dennoch so aufmerksam um mich. Sprich weiter, will ich sagen. Bitte, hör nicht auf zu reden.
„Können wir jetzt beginnen oder nicht?“ Kaishens harter Tonfall reißt mich aus meiner Benommenheit.
Kohen erklärt mir, dass die Operation im Wachzustand erfolgen muss, damit mein Neurofeedback analysiert und das Gerät darauf eingestellt werden kann. Oder so was Ähnliches, denn so genau verstehe ich seine Erklärung nicht. Keine Narkose ist alles, was bei mir ankommt. Na toll. Das wird ja immer besser!
„Bitte leg dich wieder hin, und spreize die Arme leicht ab“, sagt Kohen. „Handrücken nach oben – ja, so ist es gut. Wir fixieren dich jetzt auf einer Kraftfeldliege, damit wir die Position für das Implantat exakt treffen.“
Als die Apparatur anläuft, fühle ich mich augenblicklich tonnenschwer. Ich möchte den Arm anwinkeln, doch er klebt fest auf seiner Unterlage. Ich will die Finger heben, aber sie sind wie festgefroren. Adrenalin schießt mir durch den Körper. Ich spanne meine Muskeln an und stemme mich mit ganzer Kraft gegen den Widerstand, mein Rumpf lässt sich allerdings keinen Millimeter drehen. Ich bin vom Nacken abwärts gelähmt. Panische Angst breitet sich in jedem Winkel meines Körpers aus.
Kaishen tritt an meine Liege und schaut auf mich herunter. Ich fühle mich wie eine Maus in der Falle, über deren Schicksal der Fänger gleich entscheiden wird. „Noch können Sie die Prozedur stoppen“, erklärt der Doktor. „Nur voll überzeugte Kandidaten dürfen ein Nomen tragen. Nach der Operation beginnt für Sie ein neues Leben. Dann ist nichts mehr wie zuvor.“
„Hast du das verstanden?“, fragt Kohen ernst. Als ich nicke, fügt er hinzu: „Dann bist du bereit? Du willst eine Nomen-Trägerin werden?“
„Ja“, antworte ich mit belegter, allerdings fester Stimme.
Kohens Miene erhellt sich. Vorsichtig schiebt er die Infusionsnadel in meinen Handrücken und hantiert an der Tropfflasche. Die Spinnenmaschine senkt sich auf mich herunter, ihre glänzenden Zangenbeine gleiten mit rhythmisch zischenden Bewegungen über meinem linken Arm in Position. Dr. Kaishen drückt einen transparenten Schuber mit den glänzenden Einzelteilen meines Implantats in die Maschine.
„Atme tief durch, und versuche, dich zu entspannen. Das tut kaum weh“, meint Kohen.
Ein heißes Stechen schießt durch meine Ohren. Er schwindelt.
Die Maschine justiert ihre Greifarme in immer feineren Schritten. Kohens besorgter Blick hilft mir, das „Stopp“ zurückzuhalten, das mir auf der Zunge liegt. Plötzlich sticht die Medizinspinne zu. Ich schreie. Die Maschine packt wieder zu. Und dann noch einmal.