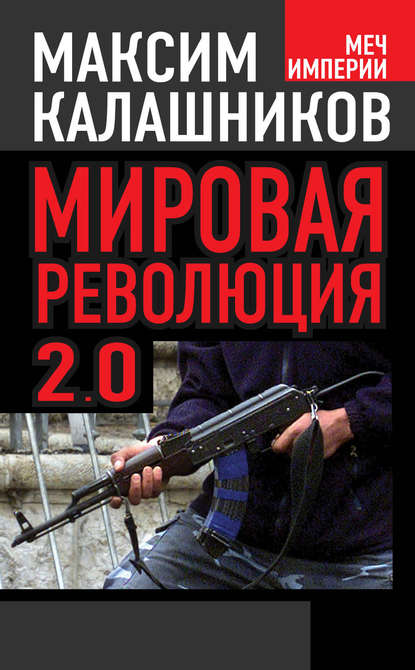- -
- 100%
- +
Wenn ich zunächst nur wenige Erfolge in der illegalen Arbeit sah, so glaubte ich doch, dass sie allein schon aus Disziplin gegenüber den Genossen, die mich dazu aufforderten, unverändert getan werden müsse, im Hinblick auf spätere, günstigere Zeiten sowieso.
Unter meinen Patienten fiel mir eines Tages eine junge Frau besonders auf. Aus ihren braunen Augen leuchtete eine solche Fülle von Licht und Schönheit, dass ich wie verzaubert war. Schöne, strahlende Menschen anzusehen, bereitet wohl jedem Freude. Auch meine Mutter war stets von solchen Menschen fasziniert, und so ging es auch mir. Das Mädchen wurde meist von ihrem Verlobten abgeholt. Wir gerieten ins Gespräch, in das wir auch ihren Verlobten einbezogen und befreundeten uns allmählich. Schließlich machten wir zu Ostern 1934 sogar eine gemeinsame Wanderung in die Berge. Der Verlobte, Gerhard Berthold, war ein junger Zeichner, in dem ich bald einen politisch ähnlich gestimmten Geist entdeckte. Er war ein frischer, natürlicher Mensch, manchmal schien er mir freilich etwas vorlaut. Auf der Wanderung sangen wir die alten Wanderlieder, und er stimmte auch manche politische Lieder an, die er noch aus früherer Zeit kannte. Das Lied der roten Flieger sang er mit heller Begeisterung, und ich höre seine Stimme noch heute: »Und höher und höher und höher, wir steigen trotz Hass und Hohn … Ein jeder Propeller singt surrend, wir schützen die Sowjetunion.« Bald heirateten die beiden Verlobten.
Als ich im Sommer 1934 von einer Auslandsreise zurückkehrte, hatte ich ein kleines Parfümfläschchen für die junge Frau mitgebracht. Berthold sagte mir kurz darauf ins Gesicht: »Es war ein billiges Parfüm«. Ich war schockiert von seinen Worten, sie trafen mich wie ein Dolchstoß in die Seite. Über Geschenke redet man doch nicht schlecht!
Warum trennte ich mich nicht sofort von ihm? Nach einer solchen Taktlosigkeit sollte man doch mit dem Menschen nicht weiter zusammen sein. Aber das Glücksgefühl, in der trostlosen Zeit damals einen politisch ähnlich gestimmten Menschen zu kennen, war zu groß. So schlug ich die innere Warnung in den Wind. Das war mein Unglück!
Damals lernte ich auch, wenn ich mich recht erinnere, durch eine Zeitungsannonce, die Thielemann, der Leiter, aufgegeben hatte, einen Kreis von »Technokraten« kennen, eine Gruppe, in der technische und wirtschaftliche Angelegenheiten mit erstaunlicher Schärfe und überraschender Erfahrung diskutiert wurden.
Wie froh war man, in einer solchen Gemeinschaft ohne Schönrednerei, ohne nationalsozialistische Verbrämung und Verfälschung unverkennbarer Tatsachen wieder einmal über ernste Dinge reden zu können, und wie begierig griff man jede Möglichkeit dazu auf.
Bald war ich mit einem Ingenieur aus den Hillewerken namens Barth, in dem ich einen Gesinnungsfreund entdeckte, etwas näher befreundet. Mit seinen tief liegenden, dunklen Augen schien er das Innere der Welt aufzuspüren. Leise verständigten wir uns über die bitteren Vorgänge um uns herum, die Gleichschaltungen, die braune Flut der marschierenden Kolonnen, die schrankenlosen Gesetzesverletzungen, die wildgewordenen Spießer in den Machtpositionen. Wie ließ sich zum Beispiel der zum »Gauleiter« avancierte Mutschmann auf seinen Jagden die Hirsche zutreiben, die er und seine Kumpane zu Dutzenden von der Kanzel herunter abschossen. Wir lachten über solch unwaidmännisches Verhalten und empörten uns über den ganzen Pomp dieser »Goldfasanen«, die durch »Arisierungen« und andere Manipulationen reich gewordenen Würdenträger und »Amtswalter«.
Peschel war der andere meiner technokratischen Freunde, ein Kaufmann; allmählich lernte ich ihn und seine Familie kennen. Zögernd fassten wir Vertrauen zueinander. Er war ernst und verbittert, wenn er vom Nationalsozialismus sprach, kühn, wenn es galt, irgend eine illegale Sache zu vollenden. Wie oft war er schon in der Tschechoslowakei gewesen und hatte Schriften über die Grenze nach Deutschland hereingeschmuggelt, hatte Leuten, die die Gestapo suchte, zur Flucht verholfen, hatte Flüchtende wochenlang in seiner Wohnung verborgen. Und wie selbstverständlich half ihm seine Frau dabei.
Es war zur damaligen Zeit in den illegal arbeitenden Kreisen Deutschlands überhaupt häufig, dass irgendein – oft unbekannter – Flüchtender oder mit illegalem Auftrag Versehener, von zuverlässigen Genossen avisiert, in den privaten Lebenskreis aufgenommen und dort für Tage und Wochen verborgen wurde. Das Risiko, von jemandem angezeigt und der Polizei übergeben zu werden, war groß, aber es fanden sich noch immer genügend Menschen, die es auf sich nahmen.
Selbst meine alte Mutter, die in einem Berliner Vorort wohnte, aus bürgerlichem Hause stammte, liberal-bürgerlich erzogen war, wie wir Kinder aber den Nationalsozialismus leidenschaftlich hasste, war zu solchem Opfer bereit. Als einer unserer guten Bekannten aus der Nachbarschaft, der alte Kommunist Rudi Reimann, der nach 1945 Bibliothekar des ZK der SED wurde, eines Tages fragte – es war 1933 –, ob nicht auch sie jemanden für eine gewisse Zeit illegal aufnehmen würde, sagte sie zu. Sie hatte das Gefühl, das ihren Kinder zuliebe tun zu müssen. Der Genosse kam, blieb wohnen, hielt sich tagsüber in der Stube auf und ging nur abends einmal weg. Mitunter besuchte ihn sogar auch seine Frau. Nach sechs Wochen musste er jedoch das Quartier wechseln. Die Nachbarn waren irgendwie aufmerksam geworden. Natürlich kam er uns dann aus den Augen. Viele Jahre später hat mir Rudi Reimann gesagt, um wen es sich bei diesem Illegalen gehandelt hatte: Es war Walter Ulbricht gewesen.
Einer von solcherart Sympathisierenden war auch Thielemann, der Vorsitzende jenes technokratischen Zirkels, ein Kaufmann in den dreißiger Jahren. Er hat übrigens die technokratische Vereinigung sehr bald selbst aufgelöst: Einige Genossen waren mit ihren Äußerungen zu unvorsichtig gewesen, sogar das Wort »Rotfront« war einmal gefallen. Außerdem vermutete Thielemann, dass die Gestapo ihre Spitzel auch in diesen Zirkel schicken würde. Mit Thielemann hielt ich weiterhin Kontakt.
Ich hatte auch Beziehungen zu einigen Genossen in Magdeburg, wo ich früher einmal gelebt hatte, und eines Tages erreichte mich ein Telefonanruf aus Magdeburg. Liesel sagte mir, dass sie eine Besuchsfahrt nach Dresden machen würde und heute nachmittag mit dem Auto käme.
Liesel brachte drei Freunde mit. »Der eine ist aus dem Konzentrationslager Oranienburg geflüchtet, du musst ihn über die Grenze in die Tschechoslowakei zu den dortigen Genossen schaffen. Die anderen sind Begleiter«, erklärte sie mir. Ich war sofort dazu bereit.
Der Geflüchtete war ein kräftiger, gesund aussehender Mann, Arbeiter im mittleren Alter. Er war auf listige Art entwichen, indem er zwei nachlässige Posten getäuscht hatte. Die sollten ihn zum Zahnarzt bringen und, zu bequem, ihn zu begleiten, hatten sie ihn ein Stück allein laufen lassen. Der Mann war übrigens der Zweite, dem bis dahin die Flucht aus dem Lager Oranienburg glückte, alle anderen Flüchtlinge waren ergriffen und erschossen worden.
Wir fuhren zu Barth. Der erklärte sich bereit, den Oranienburger bei sich aufzunehmen, bis die Flucht über die Grenze vorbereitet sei. Damals war ein Buch über das Konzentrationslager Oranienburg erschienen, geschrieben von dem SA-Führer Schäfer und gedacht als Antwort auf die Enthüllungen des ersten Entflohenen, des SPD-Abgeordneten Gerhart Seeger, der im Ausland ein Buch über die Greuel in Oranienburg geschrieben hatte. In dem von Lügen strotzenden Buch des ehemaligen Lagerkommandanten waren einige Bilder von Häftlingen abgebildet, unter denen sich auch unser Geflüchteter befand. Unrasiert, finster dreinblickend, in gestreifter Häftlingskleidung mit großem Nummernschild auf der Brust, sah er auf dem Bild wenig vertrauenerweckend aus.
In Wirklichkeit war er ein sympathischer Typ, ein Mensch wie Tausende. Es schien also keine Kunst zu sein, auf einer Fotografie einen normalen Menschen wie ein Tier verzerrt erscheinen zu lassen: ein Stück Nazipropaganda. Und so verlogen wie dieses Bild war das meiste in diesem Buch. Die Bilder aus dem KZ zeigten freundliche Baracken – die mit Maschinengewehren bestückten Wachtürme rings um das Lager waren wegretuschiert –, sie zeigten fröhlich arbeitende Menschen – von den Gemarterten und unter Qualen Gestorbenen waren weder ein Bild zu sehen, noch ein Wort zu lesen. Aber mit den Erzählungen unseres Geflüchteten erfuhren wir von alledem aus erster Hand.
Peschel, der in der Tschechoslowakei politische Freunde hatte, erklärte sich bereit, mit über die Grenze zu gehen. Thielemann hatte seine Ausweispapiere zur Verfügung gestellt, damit wir für den Flüchtling Grenzübergangsscheine bekämen.
Es war ein heißer Junitag, als wir drei losgingen: Peschel, der Flüchtling und ich. Wir fuhren ein Stück des Weges, über die Grenze mussten wir zu Fuß. Der Flüchtende hatte eine dunkle Brille aufgesetzt, aber es drohte keine Gefahr. Anstandslos bekamen wir unsere Papiere, und ohne Aufenthalt überschritten wir die Grenze. Dann wurde der Flüchtling plötzlich müde. Ich fragte ihn erstaunt: »Was, du kräftiger Mann willst nach zwei Stunden Marsch schlapp machen?«
»Du vergisst« , sagte der Flüchtling, »dass ich zwei Jahre schlechtes Essen und Entbehrungen hinter mir habe und das Bergsteigen nicht gewöhnt bin«. Ich war beschämt und verstand ihn. Wir kamen zu den tschechoslowakischen Genossen, übergaben den Flüchtling und kehrten heim.
Eine Welle des Glücksgefühls überflutete uns, dass wir diesem verhassten Dritten Reich wenigstens ein Opfer hatten aus den Zähnen reißen können. Endlich waren wir einmal aus der Passivität herausgekommen.
Eine Woche später kam ein älterer Genosse aus dem Magdeburger Parteikreis zu mir in die Dresdner Klinik: »Ich komme aus der Tschechoslowakei, kann ich eine Nacht bei dir bleiben?« Ich sagte zu. Nach einigen Tagen kam er wieder und brachte einen Bekannten mit. Auch ihn nahm ich auf. Sie wollten über die Grenze. Ich hatte aber keine Zeit, selbst mit über die Grenze zu gehen, holte Berthold heran, der sich gern bereit erklärte, die beiden zu begleiten. Ich borgte meinen Pass, Bertholds Vater den anderen, und so gingen die drei bis zur Grenzstation, wo Berthold sie hinüberbrachte. Später gab er mir meinen Pass zurück.
Es kamen in der Folge noch einige Genossen, die ich selbst teils bei mir aufnahm, teils über die Grenze beförderte. Dann erhielt ich illegale Zeitungen und auch die kleinen, als Reclamhefte getarnten Broschüren über den Reichstagsbrand. Ich las alles und gab es an Vertraute weiter. Wir waren ja alle ausgehungert nach Informationen, konnten wir doch lediglich die starr frisierte Nazipresse lesen. Nur gelegentlich erwischte man einmal eine ausländische Zeitschrift, die einem mehr Wahrheit über Deutschland brachte, mehr von dem, was man nur wisperte.
Aber wo sollte ich illegale Zeitungen aufheben? In meinem kleinen Zimmer musste ich ständig darauf gefasst sein, auch einmal eine Haussuchung über mich ergehen lassen zu müssen. Oft sah ich meine ganze Habe durch, ob sich nicht irgend etwas Verdächtiges darin fand, machte »Haussuchungen« bei mir selbst. Und für die illegalen Zeitungen fand ich im Archiv der Klinik hinter einem Stapel von alten Büchern ein gutes Versteck. Niemand kam sonst dahin.
Im März 1935 fragte mich Berthold nach einem Quartier für einen illegal Arbeitenden. Da in meinem Zimmer kein Platz war, fragte ich Peschel, der bejahte. »Gut«, sagte ich zu Berthold, »ich habe ein Quartier, aber ich möchte dir die Anschrift nicht sagen, sondern nur dem Illegalen. Ich gebe dir einen Brief für den Illegalen mit, in dem die Anschrift steht.« Ich schrieb, versiegelte den Brief und gab ihn Berthold. Später erfuhr ich, dass der illegale Genosse richtig in sein Quartier gekommen war. Ich besuchte Peschel und traf den Illegalen bei ihm. In der Unterhaltung mit ihm setzte er sich hartnäckig für die Schaffung von »Einheitsgewerkschaften« ein. Ich schüttelte den Kopf, verstand nicht, wie man unter diesem Terror Einheitsgewerkschaften fordern konnte, statt kleinste Zirkel zu schaffen. Später zeigte sich, wie recht ich damit gehabt hatte.
Viele Jahre später erfuhr ich aus einem Buch, welch riesiges Ausmaß die illegale Arbeit im Grenzgebiet zur CSR damals angenommen hatte. Allein im Jahre 1935 registrierte die Gestapo über anderthalb Millionen illegale Materialien. Dass bei solchen Mengen für Verräter oder Spitzel der Zugriff nicht besonders schwer war, lässt sich denken. Dementsprechend gingen die Verhaftungen zu dieser Zeit in die Tausende.
Erst zu jenem Zeitpunkt, als der Illegale, Hedler hieß er, bereits in Polizeihände gefallen und bei einem Fluchtversuch nach einem Treff im Dresdner Ostragehege von der Gestapo erschossen worden war, begann ich mir über Berthold Gedanken zu machen. Meine Ahnungen von damals fand ich bestätigt, als ich in dem erwähnten Buch auch tatsächlich von der verhängnisvollen Rolle erfuhr, die Berthold bei all dem gespielt hatte.
Anfang 1935 rief mich Berthold an, ob ich einen Bekannten für kurze Zeit beherbergen könnte. Ich vertraute ihm damals immerhin noch so sehr, dass ich zusagte. Berthold brachte mir einen jüngeren Mann, einen Techniker, wie er angab. Der nächtigte bei mir. Wir unterhielten uns. Der Techniker erzählte von Einheitsfrontbesprechungen, die er gehabt habe, fragte auch, ob ich nicht Leute wüsste, die vielleicht zu weiteren Gesprächen über dieses Thema bereit wären. Ich sagte, ich wüsste wohl einige und vielleicht sogar einen, der aktiv mitmachen würde.
Am nächsten Morgen wusch sich der Techniker nur flüchtig, und ich brachte ihn aus dem Haus. Wir verabredeten uns für den Nachmittag, wo ich ihn einem geeigneten Bekannten zuführen wollte. Der Techniker erschien, aber ich hatte meinen Bekannten noch nicht antreffen können. Wir gingen einige Schritte weiter, da sagte der Techniker zu mir: »Nun, ich weiß jetzt wohl genug. Hier, das kennst du doch sicher?« Und er zog aus der Tasche ein kleines Kärtchen, in Leder eingefasst, auf dem stand: »Geheime Staatspolizei«.
Es war wie ein Donnerschlag für mich.
Gestapo, Gefängnis, Zuchthaus
Ich war in den Händen der Gestapo. Wir standen an einer Straßenkreuzung, und von drei Seiten kamen Männer in Zivil auf mich zu, nahmen mich in ihre Mitte und führten mich zu einem Auto. Sie drohten, ja kein Aufsehen zu machen. Wir stiegen ein. Ich stand noch unter dem Eindruck des tödlichen Schreckens, aber ich biss die Zähne zusammen, um nicht zu zittern, um hart zu bleiben. Mich fror, und ich bat, das Außenfenster zu schließen. »Oh«, sagte der eine Beamte, »das ist nur die Reaktion auf die Verhaftung. Das äußert sich bei dem einen so, bei den anderen so.«
Wir fuhren. Dann standen wir wieder. Zwei stiegen aus, um meine Arbeitsstelle zu verständigen. »Wie viel verdienen Sie im Monat?« fragte der Beamte. Ich nannte eine Summe. Aber ich war nicht deprimiert und fragte den Beamten das gleiche, der antwortete ausweichend. Die zwei Beamten kamen wieder. »Wie heißt deine Freundin?«, wollte der eine Beamte wissen. Ich überlegte einen Augenblick, dann, als ich ganz klar wusste, dass sie nichts mit irgendwelchen illegalen Angelegenheiten zu tun hatte, sagte ich ihren Namen. »Und wo wohnt sie?« Auch das sagte ich. Wir fuhren. Der Ältere herrschte mich an: »Und nun muss die volle Wahrheit gesagt werden!« Ich biss auf die Zähne. Ich wusste genau, so lange ich lebte, könnten sie von mir nichts erfahren.
Vor dem Polizeipräsidium hielt der Wagen. Zum letzten mal grüßte ich die freie Straße mit den grünenden Bäumen. Dann betraten wir ein Zimmer. »Hände hoch!« Meine Taschen wurden visitiert, alles herausgenommen. Dann begann ein kurzes Verhör, aber als ich auf alle Fragen nur sagte: »Darüber werde ich nichts sagen«, schienen sich die Beamten eines anderen zu besinnen. Sie sagten: »Wir werden jetzt deine Freundin verhaften«.
»Sie ist völlig unschuldig und an dem Ganzen unbeteiligt«, entgegnete ich. Darauf reagierten sie nicht. Ich sagte: »Sonst hätte ich Ihnen ihren Namen nicht genannt.«
»Das hätten wir auch so herausbekommen.«
Sie ließen mich abführen. Eine eiserne Tür tat sich vor mir auf, und dann war ich in einem langen, schmalen Lichthof, von dem ich aufschauend sechs Etagen eiserner Rundgangsstiegen sah, Drahtnetze über jede Etage gespannt. Poltern dort, Schlüsselklirren, Rufen.
Man nahm mir sämtliche Sachen ab, sogar Hosenträger und Schuhbänder. Später erfuhr ich, dass das wegen der Selbstmordgefahr geschah. Sogar die Brille musste ich abgeben. Offenbar war auch Glas ein Gegenstand, der für Pulsadern gefährlich schien. Dann erhielt ich ärmliches Drillich und ein zerschlissenes Hemd. Ich war jetzt kein Zivilist mehr, das Gefangenenleben hatte begonnen.
Dann kam das Schlimmste: Ich musste beide Hände auf den Rücken legen, und sie legten mir eine Eisenfessel darum. Sie schnürte nicht nur die Hände, sondern auch die Arme zusammen, dass sie schmerzten. Dann führte man mich die äußeren, knarrenden Stiegen empor, schloss eine ächzende Tür auf, und ich betrat einen winzigen Raum, in dem ich in der dort herrschenden Dunkelheit zunächst gar nichts sah.
Der Raum war von einer Häuserwand, die unmittelbar vor dem winzigen, fast an der Decke klebenden Milchglasfenster stand, so dunkel, dass man Gegenstände erst nach einiger Zeit undeutlich unterscheiden konnte. Was war das für ein Apartment! Sechs kleine Schritte in die Länge und vier kleine Schritte in die Breite. Ein hölzernes Klappbrett als Tisch und ein kleines als Sitzgelegenheit. An der Wand befestigt eine Eisenpritsche, die anscheinend als Schlafgelegenheit dienen sollte. Gegenüber an der Wand ein kleines Holzgestell mit einem Becher und einem stumpfen Messer aus Holz. In der Ecke ein Abortkübel, in der anderen ein Krug mit Wasser und eine Schüssel, darüber ein Klingelknopf an der Wand. Weiter befand sich nichts, auch gar nichts im Raum. Und Dunkelheit, fast schwarze Dunkelheit. Hielt man in der Nähe des vergitterten Fensters einen Gegenstand hoch oben bis an die Milchglasscheibe, so konnte man ihn ziemlich genau erkennen, in den anderen Teilen des Raumes war es düster. Die Zelle war kalt, obwohl es draußen ein heißer Tag war. Aber die Steinwände waren dick, sehr dick und hielten die Kühle. Mich fror.
Ich saß, stand, ging. Die Wände hallten von meinen Schritten wieder, sonst war es totenstill in dem kleinen Raum. Allmählich begannen meine Schultern vom Druck der Fessel zu schmerzen.
Ich überdachte das bunte, farbige Leben, das ich draußen gehabt hatte, ich dachte an meine Freundin, und ich hoffte, dass sie von dem gleichen Schicksal verschont bliebe. Vielleicht hatten die Beamten nur drohen wollen.
Die Zeit verging, ich hatte keine Ahnung, wie schnell. Es musste wohl schon Abend sein. Ich hatte Hunger. Hatte man mich vergessen? Draußen schlurften Schritte auf dem Eisensteg vorbei. Ich klopfte mehrmals mit dem Fuß an die eisenbeschlagene Tür. Jemand stand vor der Tür. Ich fragte nach der Zeit. »Zum Abendessen ist es noch lange hin«, sagte die Stimme draußen. Merkwürdig, ohne Uhr, ohne bekannte Umgebung hatte ich jedes Zeitgefühl verloren. Es wurde noch düsterer in dem Raum.
Plötzlich ein Schlüsselklirren, man schloss auf. Ein uniformierter Polizeibeamter trat ein und schloss mir die Fessel auf, die »Brezel«, wie er sagte. Ich dehnte meine schmerzenden Schultern. »Ja, bewegen, immer bewegen«, meinte der Beamte. Man stellte irgendeine kümmerliche Suppe in einem Blechnapf vor mich hin. Dann ließ man die Pritsche von der Wand herab und gab mir zwei Decken. Aber die Hände wurden mir wieder auf dem Rücken gefesselt. So lag ich. Auf dem Rücken zu liegen war unmöglich, ein wenig auf der einen, ein wenig auf der anderen Seite. Aber kaum war ich eingeschlafen, so weckten mich grausam die angespannten Schultern und die gefesselten Hände. An Schlaf war kaum zu denken.
Nach einer endlosen Nacht graute der Morgen. Wieder öffnete man die Tür und schloss meine Fessel auf. Man ließ mir ein wenig Zeit, mich in der Schüssel zu waschen. Ich bekam trockenes Brot und irgend etwas Heißes zu trinken. Kurze Zeit danach schloss man meine Fessel wieder. Ich hatte mir eine Decke um die Schultern geben lassen, so dass ich nicht fror. Der Beamte hatte mir bedeutet, dass ich, wenn ich austreten müsse, klingeln solle. Mit der Stirn drückte ich dann auf den Klingelknopf an der Wand, bis nach einiger Zeit ein Beamter erschien.
Aber an diesem zweiten Tag war es insgesamt schon anders. Ich fand mich mit der Zeit besser zurecht. Irgendwo hörte ich weit in der Ferne und ganz leise eine Turmuhr schlagen und konnte ihre Schläge zählen. So hatte ich jetzt eine Tagesorientierung.
Dieser Tag war ein Sonntag. Ich fragte einen Beamten, ob am Sonntag auch Vernehmungen sein würden. »Im Allgemeinen nicht.« »Schade«, sagte ich, »so verliere ich wieder einen Tag.« Ich war noch unerfahren in diesen Dingen und naiv genug zu glauben, dass ein einzelner Tag in meinem künftigen Leben eine Rolle spielen würde. Ich dachte bei mir, viel länger als ein halbes Jahr könne die Sache doch wohl kaum dauern. Denn was konnten sie mir schon nachweisen? Ich kannte die Gestapo- und überhaupt die damaligen Polizeimethoden noch nicht, ich hatte ja niemals etwas damit zu tun gehabt.
Man holte mich zum Verhör. Ich stand, die Beamten saßen. Scharf war der Ton der Fragen. Man fragte mich nach den Leuten, die ich über die Grenze gebracht hatte oder hatte bringen lassen. Ich war überrascht. Woher wussten sie davon? Nur Berthold war davon informiert gewesen, aber der war doch zuverlässig, dachte ich. Ich leugnete alles ab. Ich wusste genau, dass ich niemanden von meinen Kameraden verraten würde. Die Beamten sagten zu mir: »Es hat keinen Zweck, wir wissen doch alles, wie Sie sehen werden. Also geben Sie es zu, und Sie werden besser behandelt. Solange Sie nicht zugeben, besteht Verdunkelungs- und Selbstmordgefahr, und wir müssen Sie fesseln«. Ich versicherte ihnen, dass mir nichts ferner liege als ein Selbstmord, aber sie gingen nicht darauf ein. Offenbar war ihnen diese Fesselung ein bequemes Mittel der Tortur, um Aussagen zu erzwingen. Sie ließen mich wieder gehen.
Nach einigen Tagen holten sie mich wieder, um mich meiner verhafteten Freundin gegenüberzustellen. Das Mädel sah verstört aus, weinte, bat, doch zu reden, damit sie freikomme. Ich war entsetzt. Das war sie also, die immer treu zu mir gestanden hatte, an deren Moral ich nicht gezweifelt hatte. Und sie bat mich nun, die Kameraden zu verraten, damit sie frei käme! Ingrimmig lachte ich in mich hinein und wandte mich ab. »Und das rührt Sie nicht?«, fragte der Beamte. Ich schwieg.
Einige Tage später rief man mich wieder hinunter. Ich fuhr entsetzt zurück, als ich meine weinende Mutter vor mir sah. Die alte Frau hatte eine weite Reise zurückgelegt, um mich zu sehen. Weinend umarmte sie mich und flüsterte mir ins Ohr: »Tue doch alles, was man dir sagt, damit du bald wieder freikommst!« Ich war befremdet. Offenbar hatten die Gestapo-Beamten es ihr so geraten. Dann meinte sie laut: »Wenn du aber in vier Wochen nicht frei bist, komme ich noch einmal zurück.«
Ich war kühl geworden, es war mir alles peinlich. In diesem zerschlissenen Drillichanzug, seit Wochen nicht rasiert, mit ungekämmtem Haar, von Polizisten hereingebracht und wieder abgeführt, mochte ich meinen Angehörigen nicht gegenübertreten. Ich wollte nicht Gegenstand ihres Weinens oder ihres Mitleids sein und nicht unter den Augen von neugierigen Beamten irgendwelche Worte wechseln. Mein Stolz ließ das alles nicht zu. Ich war froh, wieder allein zu sein. Aber offenbar hatte man meine Mutter hereingelassen, um mich weich zu machen. Gewiss, schreiben wollte ich ihr, aber das ließ man nicht zu, so oft ich auch darum bat. Ich wusste, dass die anderen politischen Gefangenen schreiben durften, aber bei mir sagte man stets: »Erst wenn Sie ausgesagt haben.« Ich durfte auch nicht wie die anderen politischen Gefangenen täglich eine halbe Stunde im Hof herumgehen oder mir Wäsche schicken lassen oder ein paar Lebensmittel kaufen oder meine Zivilkleidung tragen. Alles verweigerte man mir und immer mit der Begründung: »Erst aussagen!«
Aber das Schlimmste war die Fessel. Mit der Zeit wurde der Schmerz in den Schultern fast unerträglich. Der Wachbeamte, mit dem ich darüber sprach, sagte zu mir: »Machen Sie doch ein Gesuch, schreiben Sie, dass die Fesseln Sie in Ihrer Gesundheit beeinträchtigen.« Ich tat das. Ich wurde heruntergerufen, und man hielt mir mein Gesuch als eine bodenlose Unverschämtheit vor, man beschimpfte mich. Und wieder befahl man mir: »Erst aussagen!«
Um irgend etwas auszusagen und den unbequemen Fragereien zu entgehen, gab ich zwei Adressen an, mit denen ich angeblich in Verbindung gestanden hatte. Aber ich hatte diese Personen fingiert, sie existierten für die Gestapo nicht. Eine war, das wusste ich, bereits vor Monaten ins Ausland emigriert, für die andere gab ich eine Phantasie-Adresse an: »Berlin SW 68 postlagernd«. Das war die Anschrift eines früheren Zeitungsamtes, die mir eingefallen war.