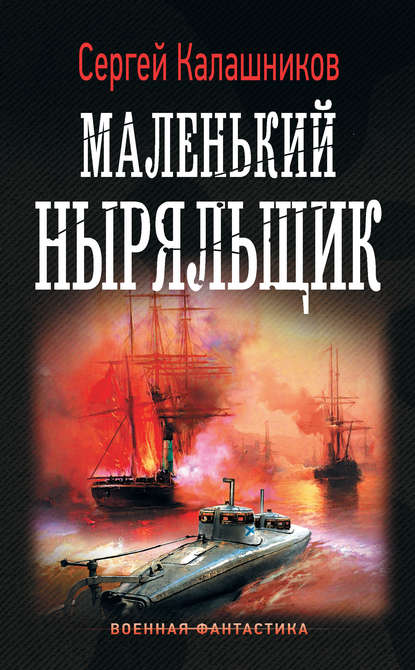- -
- 100%
- +
Nach einigen Wochen sahen auch die Gestapo-Beamten ein, dass ich sie an der Nase herumgeführt hatte. Sie waren zornig darüber, welch großen Beamtenapparat sie hatten aufbieten müssen, um das zu begreifen. Fortan war ich noch schlechter bei ihnen angeschrieben. »Nie werden Sie die Freiheit wiedersehen«, schrieen sie mich an. Ein andermal riefen sie mich zum Verhör. Als ich an der Tür stand, erblickte ich Anni Sindermann, mit der ich einen illegalen Treff gehabt hatte. Plötzlich erhielt ich einen wüsten Stoß gegen den Rücken und taumelte ins Zimmer gegen die Frau. »Du willst dich wohl an der Frau vergreifen, du feiner Bruder, wart’ nur, das werden wir dir austreiben!« herrschte mich einer der Gestapo-Beamten an.
Und als ich alles Vorgehaltene wieder einmal ableugnete, schlugen sie mir mit Fäusten ins Gesicht und traten mir gegen die Schienbeine. »Mit dir fahren wir noch einmal in den Wald!« drohten sie.
Ich war noch immer unerfahren und dachte tatsächlich, halbwegs in einem Rechtsstaat zu leben. Keuchend bat ich den uniformierten Wachbeamten vor meiner Zelle um Schutz.
Am nächsten Tag wurde ich hinuntergerufen. Gefesselt betrat ich das Zimmer eines Gestapoinspektors. Die beiden Beamten, die mich geschlagen hatten, saßen auch dabei.
»Sie haben um Schutz nachgesucht?« fragte der Inspektor.
Ich bejahte.
»Warum? Sind Sie geschlagen worden?«
Ich erklärte, hier, vor diesen zwei Beamten, könne ich nicht sprechen.
Der Inspektor befahl den Beamten, hinauszugehen. »Sind Sie geschlagen worden?«
Ich bejahte.
»Von wem?«
Ich überlegte. Würde ich jetzt die Namen der Beamten nennen, die der Inspektor natürlich genau kannte, so würden sie meine martervolle Fesselung und die übrigen Torturen bis ins Endlose weiter fortsetzen, vielleicht käme noch Schlimmeres. Es hatte also keinen Zweck, sich noch persönliche Feinde zu schaffen. Ich sagte darum: »Ich verweigere die Aussage.«
»Dann verweigere ich auch die weitere Untersuchung«, schrie der Inspektor, und er beschimpfte mich, wie man ein Stück Vieh beschimpft. Dann ließ er mich abführen. Immerhin war der Erfolg in dieser Sache doch der, dass ich bei den folgenden Verhören nun zunächst nicht mehr geschlagen wurde.
Sie hielten mir Dinge vor, über die ich erstaunt war. Nur Berthold war darüber so genau informiert gewesen. Warum hatte er das alles gesagt? Warum hatte er geradezu mit Liebe jede Einzelheit ausgemalt? Warum hatte er Dinge gesagt, die darauf schließen ließen, dass ich noch weitere Leute über die Grenze gebracht hatte? Berthold, dieser so zuverlässige Bursche, der mit Eifer jede illegale Sache verfolgte! Es war Verrat, den ich nicht verstand.
Sie fragten mich: »Was war mit dem versiegelten Brief?« Ich leugnete, irgend etwas darüber zu wissen. Sie fragten mich, wer denn das sei, »der alles mitmache?« Ich nannte die fingierte Adresse. Sie fragten mich, was Thielemann in der Sache mitgemacht habe. Ich sagte, ich kenne den Mann nicht. Sie fragten weiter: »Wer ist der Ingenieur in den Hille-Werken?« Innerlich erschrak ich, denn Barth war ja in den Hille-Werken beschäftigt. Aber weil ich zufällig einen anderen, harmlosen Menschen dort kannte, nannte ich den. Sie achteten nicht darauf. Später drohten sie mir, dass sie mich zu ihm nach Warnemünde mitnehmen würden. Woher wussten sie, dass Barth jetzt in Warnemünde war? Wollten sie ihn verhaften? Sollte ich dabei als Lockspitzel dienen? Aber ich blieb äußerlich ruhig, und sie gingen nicht weiter darauf ein.
Dann empfing ich einen Brief, den meine Freundin aus der Zelle an mich geschrieben hatte. Sie erinnerte mich daran, wie sie sich früher für mich aufgeopfert, wie sie andere Menschen für mich aufgegeben hätte, und nun wollte ich sie vernichten. Sie halte das nicht mehr aus. Wenn ich nicht spräche, so würde sie Selbstmord verüben, Gelegenheit dazu böte ja ihre Zelle. Ich war betroffen. Ich hatte mich bei den Aufsicht führenden Polizeibeamten genau erkundigt und wusste, wie es meiner Freundin ging.
Sie hatte eine für meine jetzigen Begriffe schöne, sonnige Zelle. Sie konnte jeden Tag an die frische Luft gehen, sie konnte schreiben, Pakete empfangen, sie konnte Lebensmittel kaufen, sie konnte ihre Zivilkleidung tragen, während ich wie ein Hund lebte. Und dann schrieb sie, sie halte das nicht mehr aus! Sie wollte mich dazu bringen, meine Kameraden zu verraten, nur damit sie selbst frei käme. Ekel erfüllte mich. Hatte man mich nicht früher schon einmal vor ihr gewarnt? Warum war ich so blind gewesen?
Was blieb noch übrig? Der Freund, der mich verraten hatte, das Mädchen, das mich zum Verrat erpressen wollte. Dazu die dunkle Zelle und die endlosen Tage. War ich nicht sehr unvorsichtig gewesen, mich solchen Menschen anzuvertrauen? Hätte ich nicht viel mehr prüfen sollen? Gewiss, ich glaubte, geprüft zu haben, aber das war doch alles viel zu kurz und zu oberflächlich gewesen.
Zwei- oder dreimal brachte man mir einen Brief meiner Mutter. Sie war sehr verzweifelt. Sie schrieb von den Schönheiten unserer ländlichen Heimat und von der Hoffnung, mich bald wieder zu sehen. Man erlaubte nicht, dass ich ihr antwortete. Dann blieben die Briefe aus. Offenbar glaubte sie nicht, dass ich die Briefe bekommen hätte. Ich war mir selbst überlassen. Nur die Briefe der Mutter lagen auf dem Holzbrett, das als Tisch diente.
Meine Stimmung begann zu sinken. In der dritten oder vierten Woche nach der Verhaftung war ich auf dem tiefsten Punkt angelangt. Das Schlagen bei den Verhören, der Verrat des Freundes, die erpresserischen Versuche der Freundin, die Verzweiflung der Mutter, die eigene Hilflosigkeit, die schmerzenden Fesseln, die düstere Zelle, das alles drückte mich sehr nieder.
So äußerte ich mich auch einem Wachmann gegenüber, der freundlich zu mir war. Der munterte mich auf, erzählte mir von seinen eigenen Erlebnissen als gefangener Soldat in Afrika, wo er ein halbes Jahr in Ketten unter der Erde geschmachtet habe. Und wirklich, die wenigen freundlichen Worte machten mir wieder Mut. Ich überwand den Tiefpunkt meiner Stimmung. Ich begann, meine morgendlichen Waschungen mit einem gewissen Zeremoniell zu betreiben, es gelang mir sogar, eine alte Illustrierte zu bekommen, in der ich während der Zeit, in der man mir in der dunklen Zelle das Licht kurz eingeschaltet hatte, jedes Wort von vorn bis hinten gründlich las.
Freilich, die Verhöre blieben. Die Drohungen der Gestapo-Beamten, die mir sogar den Tod ankündigten, ließen mich gleichgültig. Meine innere Stärke wuchs. Aber ich war mir klar darüber, dass ich dies alles nur aushalten könnte, wenn ich bis zum letzten entschlossen wäre. Und das war ich. Ich war entschlossen, nichts, aber auch nichts von meinen Geheimnissen preiszugeben, niemanden von meinen Kameraden zu verraten, auch wenn sie mich totschlügen. »Irgendwann vorher wird mich eine wohltätige Ohnmacht umfangen«, sagte ich mir. So trug ich die Schläge und Tritte bei den Verhören, die Qual der Fessel und die übrigen Schikanen. Das Schlimmste war, dass ich nicht wusste, wie lange diese Marter dauern würde. Ich fragte manchmal die Wachleute danach. Sie antworteten immer ausweichend. Einer nannte mir einmal ein viertel bis ein halbes Jahr. Innerlich erschrak ich. Sechs, acht Wochen waren jetzt vorbei. Sechs, acht qualvolle Wochen. Und nun noch länger?
Die Wachleute wurden allmählich freundlicher zu mir. Anscheinend hatten sie Achtung vor mir. Meine Fesseln wurden oft nur lose angelegt, so dass es mir gelang, eine Hand daraus hervorzuziehen. Freilich musste ich das sorgfältig verbergen, denn jeden Moment konnte die Tür aufgehen und ein nicht eingeweihter Wachtmeister eintreten. Unter der Decke, die mir über die Schultern hing, verbarg ich meine Hände. Ab und zu brachte man mir auch eine leichte Lederfessel, die die Hände nur vorn band. Sie war im Vergleich zur »Brezel« auf dem Rücken ein Vergnügen. Auch konnte man gelegentlich eine Hand daraus hervorziehen.
Eines Tages bekam ich einen kleinen Kriminalroman in die Zelle hineingeworfen. Ich war ausgehungert nach Lektüre. Hielt ich das Buch mit der Hand oben an das Fenster, so konnte ich sogar, wenn die Sonne schien, lesen. Manchmal machten mir freundliche Wachtmeister die kleine, vergitterte Deckenlampe an. Ich las den Roman mehrere Male, ich kannte bald jeden Satz darin auswendig. Wie köstlich es war, etwas Gedrucktes vor sich zu haben und für kurze Zeit der Eintönigkeit der eigenen Grübeleien zu entfliehen!
Und doch waren diese Grübeleien heilsam. Nie hatte ich soviel Zeit, mein eigenes Leben betrachten zu können, meine Fehler, meine Beziehungen zu anderen Menschen. Ich wurde hellhörig. Wie ich aus dem weit entfernten Glockenschlag jetzt die Zeit erkannte, so lernte ich in der Stille, aus kleinen, scheinbar nichtssagenden Zeichen, aus wenigen Worten den Charakter eines Menschen besser erkennen und beurteilen, als ich es je vorher gekonnt hatte.
Ich entsann mich winziger Begebenheiten, die ich an meinen Freunden, an Bekannten, an meiner Freundin, meinen Vorgesetzten beobachtet hatte. Warum hatte ich dies alles vorher nicht gesehen? Warum waren meine Sinne erst jetzt so geschärft? Nun sah ich ein, wie außerordentlich heilsam diese Wochen der Einsamkeit für mich waren. War nicht klösterliche Abgeschiedenheit etwas ähnliches? Schöpften nicht die größten Geister immer wieder ihre Kraft aus der Stille und der Einsamkeit? Ja, ich war bereit, jedem Menschen einmal einige Wochen solcher Abgeschiedenheit zu wünschen. Es musste ja nicht mit Fesseln und Torturen verbunden sein. Würden nicht viel Oberflächlichkeit, Heuchelei, viele Verkrampfungen verschwinden, wenn jeder irgendwann einmal eine Zeit stiller Selbstbesinnung hätte?
Als vielleicht acht oder neun Wochen verflossen waren, sagte ein Wachtmeister zu mir: »Nun wird es sich bald zeigen, wer stärker ist, die Behörde oder Sie«. Ich horchte auf, die Wachleute wussten also, worum es ging. Offenbar waren einige der Wachtmeister mir wohlgesonnen, vielleicht sogar auf meiner Seite. Sie wurden zusehends freundlicher, verschafften mir diese oder jene Erleichterung, sei es etwas zu lesen, sei es, dass sie meine Zellentür einmal lange aufließen oder mich für kurze Zeit gar in eine andere Zelle beorderten.
Das waren glückliche Augenblicke, denn die Sonne wollte ich noch einmal sehen, die Sonne. »Noch einmal die Sonne sehen, noch einmal die Sonne sehen«, so klang es in mir. Sie schien mir der Inbegriff aller Schönheit und der Freiheit zu sein nach dem Dunkel, das mich seit Monaten umhüllte. Aber noch war es mir nicht vergönnt, sie wieder zu sehen.
Ab und an wurde ich zum Baden in den Keller hinuntergeführt. Dort hing ein kleiner Spiegel. Ich erschrak, als ich mich sah. Blass, mit wirrem Haar; mein Bart, beinahe drei Zentimeter lang geworden und am Kinn schon grau, ließ mich um ein Dutzend Jahre älter erscheinen. Wie ein Straßenräuber sehe ich aus, dachte ich bei mir. Ein andermal traf ich dort überraschend auf Peschel. Es gelang mir, unbemerkt an seine Seite zu kommen und einige wenige Worte mit ihm zu flüstern. Dann wurden wir getrennt.
An den Abenden hörte ich jetzt über meiner Zelle hin und wieder Gespräche. Ich merkte, dass da politische Gefangene miteinander sprachen. Ich rief am Fenster nach oben und machte mich bemerkbar. Die über mir gehörten zu einer Parallelgruppe, die zum gleichen Zeitpunkt wie ich verhaftet worden waren. Ich erfuhr, dass Redler, jener illegale Flüchtling, dem ich das Quartier bei Peschel beschafft hatte, von der Polizei erschossen worden war.
Während ich noch am Fenster stand und nach oben rief, ging plötzlich die Tür auf, und ein Beamter, der mich durch das kleine Sehloch in der Tür, den »Spion«, beim Sprechen beobachtet hatte, kam herein. Ich war bei einer verbotenen Handlung erwischt worden. Der Beamte drohte mir. Am selben Abend noch wurde ich zum Inspektor gerufen, der mich fragte, was ich da zu sprechen hatte. Ich konnte die Wahrheit natürlich nicht sagen und musste eine Ausflucht gebrauchen. Ich log und sprach von der Uhrzeit, nach der man mich gefragt hatte. Die Sache ging vorbei, aber die Kameraden da oben schienen verlegt worden zu sein. Jedenfalls hörten die abendlichen Unterhaltungen auf.
Aber meine eigenen Fesseln wurden jetzt besonders stramm angezogen, so wie in den ersten Tagen. Das sollte wohl eine Strafe sein. Ingrimmig musste ich lächeln. Wie einen kleinen Jungen behandelten sie mich.
Nach einigen Tagen legte sich das wieder. Die Zügel wurden wieder etwas lockerer. Ich konnte wieder aufatmen, ohne von dauernden Schmerzen gepeinigt zu sein.
Mein Aufzug war jetzt wirklich räubermäßig. Der struppige Bart wucherte mir über den Mund. Da ich keine Schere hatte, musste ich einzelne vorstehende Haare mit den Zähnen abbeißen, so gut es eben ging. Aß ich, so war mir der Bart hinderlich, besonders, wenn ich einen Hering bekam, was ziemlich oft geschah. Mit dem kleinen Holzmesser mühsam die Gräten heraushebelnd, musste ich abbeißen, und der Saft tropfte in meine Barthaare. Trotz allen Waschens war der penetrante Heringsgeruch für Tage nicht wegzubekommen. Aber das waren natürlich Bagatellen!
Ich lernte die früher so selbstverständlichen Dinge der Zivilisation in einem neuen Licht sehen. Und was mir einst nie begehrenswert schien, etwa ein Parfüm oder eine gute Seife, war nun zum Inbegriff einer höheren Kultur geworden. Viele meiner Anschauungen hatten sich gewandelt, was draußen oben war, war hier unten, was draußen gut war, war hier böse, was man draußen tun musste, musste man hier lassen. Es war eine Umwandlung aller Werte, und je länger meine Haft dauerte, desto mehr musste ich umlernen, neue Begriffe formen. Hier war ich außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, außerhalb jeder bürgerlichen Moral. Wie ein Tier musste ich darauf sinnen, meinen Peinigern mit Klugheit ein Schnippchen zu schlagen, sie zu überlisten. Ich gelangte langsam in eine Welt, die sich jenseits der überkommenen Begriffe von Gut und Böse befand. Und allmählich erst, nach Monaten und Jahren, würde ich lernen, dass auch sie ihre ungeschriebenen Regeln und Gesetze hatte. Später erst wurde mir klar, was mir viele Kameraden in der Haft immer wieder sagten: »Niemand kommt hier so heraus, wie er hereingekommen ist.«
Ob ich in den hölzernen Klapptisch ein Schachdiagramm einschnitt und mit Zeitungsfetzen als Figuren mit mir allein Schach spielte, ob ich Kreuzworträtsel selbst fabrizierte, ob ich später irgendwelche Zeitschriften von den Wachleuten erbettelte, ob ich durch Klingeln kurz vor den Essenszeiten versuchte, die Qualen der Fesselung abzukürzen, was mir oft gelang – es war das eigentlich verboten, aber immer war es ein Kampf um diese Kleinigkeiten, die den Geist wachhielten, dem Körper Erleichterung verschafften und das Dasein ein wenig erträglicher gestalten sollten.
Als genau zehn Wochen vergangen waren, wieder an einem Freitag, öffnete sich meine Zellentür. Ein Kommissar und ein Wachmann traten herein.
»Sie haben jetzt wohl keine Selbstmordabsichten?« Ich verneinte auf das Entschiedenste.
»Dann wollen wir Ihnen jetzt die Fesseln abnehmen.« Der Wachmann schloss die »Brezel« auf, nahm sie mir ab, und beide gingen wieder hinaus. Ich war allein. Ich wusste, ich hatte gesiegt, ich hatte meine Kameraden nicht verraten, die Qualen waren nicht umsonst gewesen; und das Gefühl der endlichen, so lange und so sehnlich erwarteten Befreiung von dieser Pein überwältigte mich derart, dass ich – zum ersten mal in meiner Haft – in einen Strom von Tränen ausbrach. Ich schämte mich dessen nicht.
Alle anderen Bedingungen blieben für mich die gleichen, aber meine Hoffnungen auf Besserung meiner Lage wuchsen. Noch zwei Wochen blieb ich in meiner dunklen Zelle, nun waren insgesamt zwölf Wochen vergangen.
Dann endlich holte man mich heraus. Gab mir eine helle Zelle, die einen kleinen Blick auf den blauen Himmel erlaubte, auf den ich mit heller Wonne schaute. Dann kamen all die anderen Dinge, die ich so lange entbehrt hatte. Ich erhielt meine eigene Kleidung wieder, der lange Bart fiel, meine wirren Haare wurden geschnitten, und endlich, endlich durfte ich in dem kleinen Hof wieder einmal die Sonne sehen. Ich schaute sie an, bis die Augen schmerzten: die Sonne, die Sonne! Es war wie ein Wunder! Ich bekam ein Buch, konnte lesen, und gierig verschlangen meine Augen die Zeilen.
Dann schaffte man mich in das Untersuchungsgefängnis derselben Stadt. Ich kam dort mit ein paar Kriminellen in einen Raum. Es war köstlich für mich, seit einem Vierteljahr wieder einmal mit Menschen reden zu dürfen, wieder mehr Bücher zu haben.
Ich lernte nun so mancherlei Dinge, die Kriminelle in den Gefängnissen seit je zu tun pflegen: Feuer mit einem Metallknopf machen, der in der Mitte eines Fadens hing und den sie gegen einen Steinkrug schnurren ließen. Seine Funken setzten geschabtes Zelluloid von einer Zahnbürste oder einem Kamm in Brand. Oder sie wurden mit einer »Lunte« aufgefangen, einem angesengten Stück Stoff, wo sie weiter glimmten, so dass man eine Zigarette daran anzünden konnte. Ich hörte sie von mancherlei Diebstählen sprechen, ich hörte sie sexuelle Perversionen ausmalen, wovon sie ein ganzes Arsenal voll zur Verfügung hatten. Wenn ich später mit politischen Kameraden über die Zeit bei den Kriminellen sprach, so hatten sie alle ziemlich die gleichen Erfahrungen gemacht: Es waren immer die gleichen arbeitsscheuen Elemente, die durch allerhand feine und grobe Gewitztheiten versuchten, sich auf bequeme Art Vorteile zu verschaffen. Klug waren sie nur bis zu einem gewissen Grade, denn ihre Klugheit reichte nie aus, um zu erkennen, dass sie früher oder später doch alle »gingen«, wie ihr Fachausdruck hieß. Sie waren alle geborene Individualisten, wie sie auch fast immer Egoisten waren. Für politische Gespräche waren sie nicht zu haben. Ihrem Individualismus widerstrebte ein politisches, für eine Gemeinschaft getragenes Ziel. Auch fehlte ihnen das Verständnis, für eine Idee zu kämpfen oder gar zu leiden. Sie hielten die Politischen entweder für dumm oder für unbelehrbare Fanatiker oder gar für Berechnende, die in späteren Zeiten auf einen guten Posten rechneten.
Je länger ich mit dieser Art von Menschen zusammen war, desto unangenehmer wurden sie mir. Viele warteten ja nicht auf die Verurteilung ihrer ersten Straftat, sondern es ging um das letzte Glied in einer langen Kette von »einschlägigen« Delikten. Sie blieben meist bei ihrem Fach. Der Betrüger beim Betrug, der Falschspieler beim Falschspiel, der Dieb beim Diebstahl usw.
In dieser Zeit fand auch die gerichtliche Untersuchung meines »Falles« statt. Der Untersuchungsrichter fragte mich korrekt. Schließlich ging es nur um eine Zusammenfassung dessen, was die Gestapo-Beamten notiert hatten.
Ich war froh, als ich das sechsstöckige Haus am Münchner Platz endlich verlassen konnte.
Nun transportierten sie mich in ein Gefängnis für Politische, in die sogenannte »Mathilde«. Glücklicherweise war ich dort auch mit politischen Gefangenen zusammen, deren mehrere hundert die Zellen füllten. Zu zweit in einer kleinen Zelle, den Schikanen der dortigen Wachtmeister nur ab und an ausgesetzt, war es im ganzen erträglich. Was bedeuteten schon ein paar hundert Wanzen in der Zelle? Wir machten uns einen Spaß daraus, sie in den Mauerritzen zu jagen. Wenigstens hatten wir Bücher, und wenn ich in Freiheitstagen wenig Zeit zum Lesen gehabt hatte, so hatte ich nun Gelegenheit, manches zu lesen, wozu ich sonst nie gekommen war.
War ich mit einem einfachen Menschen zusammen, so gehörte es zur Regel, dass wir uns in den ersten ein bis zwei Wochen viel zu erzählen hatten. Dann aber versagte der Gesprächsstoff. Das Thema Familie, Stadt, Politik war allmählich erschöpft, und wir wurden uns langweilig. War es ein guter Kamerad, so war es erträglich, war es ein schlechterer, so wurde es mit der Zeit fast unerträglich in der Zelle. Es begann das, was die Polarforscher die »Polarkrankheit« nennen: Man konnte sich in den engen Polarzelten nicht mehr sehen und explodierte bei der geringsten Gelegenheit. Ähnliches, wenn vielleicht auch nicht so krass, ergab sich mit der Zeit in der Enge der Zelle.
Täglich gingen wir für eine halbe Stunde in dem kleinen Hof herum: Einzeln, je drei Meter Abstand haltend, das Sprechen war streng verboten. Trotzdem war es kein stumpfsinniges Umhertrotten, wir sahen bekannte Gesichter, gute Kameraden, Junge und Alte, wir konnten uns zunicken, und wir lernten es, uns in manchen Momenten trotz der scharfen Aufsicht der Wachtmeister einiges zuzuflüstern. Wir lernten sprechen, ohne dass man die Bewegungen unseres Mundes sah. Mit leicht seitwärts geöffneten Lippen, wenige leise Stichworte, die der andere doch verstand. So trugen wir einander Nachrichten zu. Wir lernten, uns durch Klopfzeichen an die Wände zu verständigen und uns durch die Abortanlagen in den Zellen etwas zuzurufen. Wir hatten eine Art Alphabet ausgearbeitet, wodurch das »Morsen« schneller ging. Wir hatten Klopfzeichen, die für jede unserer Heimatstädte charakteristisch waren, so dass man in den Zellen gleich wusste, aus welcher Stadt der Nebenmann stammte. So wussten alle gut übereinander Bescheid.
Die große Frage für jeden war der Prozess. Hast du schon die Anklage? Wie viel Jahre erwartest du? Wann ist dein Prozess? Wie viel hat der und der bekommen? Das waren die täglichen Fragen, die wir, alle miteinander verbunden, uns nun stellten.
Ich war über die Höhe der Urteile erstaunt. Zu unter zwei Jahren wurde niemand verurteilt, aber die Strafen für die meisten bemaßen sich weit, weit höher. Aber man gewöhnte sich auch daran. Wir wussten nun ungefähr, was jeder von uns zu erwarten hatte, und wir trugen es alle mit dem gleichen guten Mut. Nie hatte ich einen trauern oder weinen gesehen, freilich, lachende Gesichter hatten wir kaum. Die Alten waren schlechter daran als die Jungen, die sich schneller über alles hinwegsetzten und sich an vieles gewöhnten. Die meisten unter uns waren einfache Menschen aus dem Volk. Deren Moral war gut, der Mut ungebrochen, und das, obwohl die meisten Frauen und Kinder hatten, denen jetzt der Ernährer fehlte und die sich oft in verzweifelter Lage befanden. Manche erhielten Briefe, die ihnen von der Exmittierung ihrer Familien aus den Wohnungen Nachricht gaben. Manche Frauen ließen sich sogar unter dem Druck der Wohlfahrtsämter, die das wünschten, oder unter den Einfluss anderer Leute scheiden. Manchem wurden die Rechte über die Kinder entzogen.
So erfüllte viele von ihnen Bitterkeit, nie aber Verzweiflung. Sie erwiesen sich des politischen Kampfes, den sie geführt hatten, würdig. Mochten auch gelegentliche Ausnahmen unter ihnen sein, mochte hie und da ein Verräter auftauchen, dem viele, manchmal sehr viele zum Opfer fielen, im allgemeinen waren die Menschen gut. Politische Köpfe waren dabei, die in harter Schule und Selbstdisziplin für eine spätere Aufgabe heranreiften. Und wir erfuhren voneinander, dass wir fast alle in den ersten Tagen und Wochen von der Gestapo wüst geschlagen worden waren, um Aussagen zu erpressen. Viele waren mehrmals bis zur Besinnungslosigkeit geprügelt worden. Viele waren lange gefesselt gewesen, und alle hatten die ganze Stufenreihe der Schikanen durchmachen müssen.
Von manchen hörte ich auch, die so tapfer gewesen waren, dass sie sich lieber totschlagen ließen, als ihre Kameraden zu verraten. Kasparcyk hieß einer der Heldenmütigen, ein unbekannter Mensch, aber ein leuchtendes Fanal.
Nach vierzehn Monaten Untersuchungshaft war mir endlich eine Anklageschrift ausgehändigt worden. Der Prozess führte mich nun zum ersten mal mit Peschel und vier anderen, die ich früher nicht gekannt hatte, zusammen. Aber aus der Anklageschrift und aus vielerlei kleinen Begegnungen wusste ich um sie.
Es ist müßig, die wenig nützlichen Vorbereitungen des Pflichtverteidigers auf die Verhandlung zu erörtern und den Prozess selbst zu schildern, der drei Tage dauerte. Es genügt zu sagen, dass er – wie alle politischen Prozesse – geheim war und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Dies hatte seinen Grund darin, dass das ganze Gewebe politischer Naziwillkür, aber auch der Kampf der Illegalen der Allgemeinheit nicht bekannt werden sollte. Auch sollte um die Spitzel der Gestapo Stillschweigen verbreitet werden.
So wurde der Prozess hinter verschlossenen Türen geführt. Scheinbar verlief er einigermaßen korrekt. Der formale Prozessverlauf wurde eingehalten, die Zeugenvernehmungen, die Vernehmungen der Angeklagten verliefen im wesentlichen gemäß den Regeln. Die Anklagerede des Staatsanwalts und die letzten Verteidigungsreden der Angeklagten, auch das war im Rahmen des Üblichen.
Gedankenschärfe und Geistesgegenwart waren nötig, denn während des Prozesses ergaben sich fortwährend neue Situationen, neue Vermutungen, neue Anklagen, die es zu entkräften galt. Die Offizialverteidiger, die man uns Angeklagten gegeben hatte, waren so alt und so unbeholfen, dass man sich als juristischer Laie selbst wesentlich geschickter verteidigte, als der Verteidiger es vermochte.