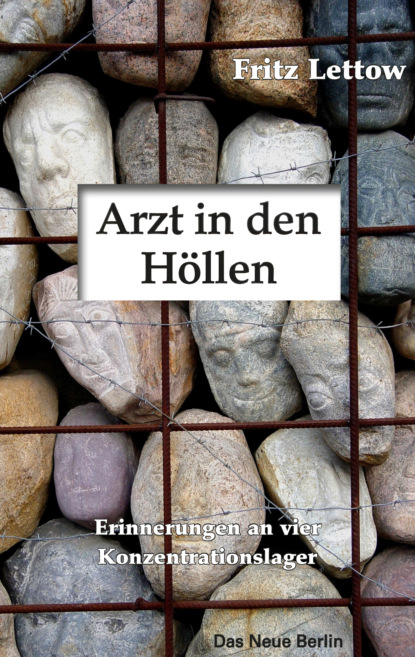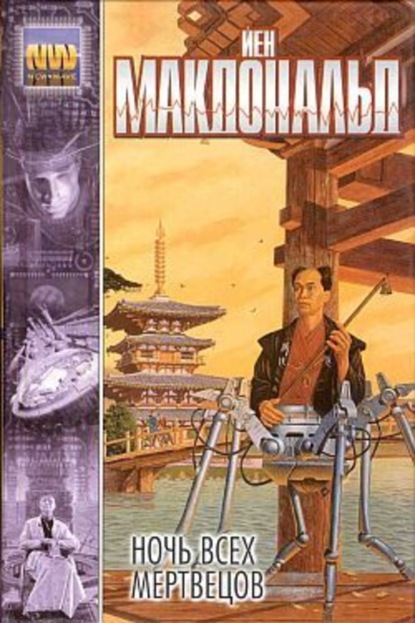- -
- 100%
- +
Immerhin rann es uns Angeklagten doch kalt den Rücken hinunter, als der Staatsanwalt drei bis fünf Jahre Zuchthaus für die meisten beantragte, für mich selbst fünf.
Das Gericht zog sich zu einer kurzen Beratung zurück, und nach einigen Minuten erschien es wieder. Bei der Urteilsverkündung wurde Publikum zugelassen. Stehend mussten wir sechs Angeklagten unser Urteil anhören. Die Urteile lauteten zwischen zwei und vier Jahren Zuchthaus, ich erhielt drei Jahre. Die Untersuchungshaft wurde uns fast ganz angerechnet.
Wir konnten in die Zellen zurückkehren, die Spannung hatte sich gelöst: Wir waren nicht niedergeschmettert, wir beglückwünschten uns sogar, dass es weniger war, als der Staatsanwalt beantragt hatte. Nun hatten wir bis zum Abtransport in die Strafanstalt nur noch wenige Wochen zu warten.
Als wir dort eintrafen, lasen wir hinter dem großen Tor die Tafel mit der Inschrift:
Wer Freiheit nicht zu schätzen weiß,
muss dieses Haus betreten.
Dort lernet er zu jeder Zeit
Für seine Freiheit beten.
Und als wir in das gelbliche hässliche Drillich der Sträflinge eingekleidet waren, standen wir entrechtet, entehrt von einer Gesellschaft, die wir hassten und die wir nie anerkannten.
Weit davon entfernt, diese neuen Beamten etwa als Vorgesetzte anzuerkennen, verglich ich meine Situation stets mit dem Bibelwort: »So fiel ein Mann unter die Räuber, und sie taten mit ihm, was sie wollten«. So kam ich mir vor, und die kleinlichen, schikanösen Subjekte von Bewachern nötigten mir innerlich keinerlei Respekt ab.
Fast zwei Jahre brachte ich in der Anstalt Zwickau zu. Vierzehn Monate davon war ich in Zellenhaft, teils allein, teils mit ein oder zwei anderen zusammen. Dreckige Arbeit, Wolle zupfen, Lumpen zerreißen, teerige Taue entwirren, Staub, Dreck, Lumpen, das füllte meine Tage aus. Der Lohn betrug vier Pfennige am Tage, nach acht Monaten, wenn man bei guter Führung in die »Mittelstufe« kam, stieg der Lohn auf acht Pfennige. Dafür konnte man ein mal in der Woche einige wenige Kärglichkeiten kaufen.
Mitunter, wenn einem primitiven Menschen in der Zelle der Gesprächsstoff ausging, wurde es eintönig und langweilig. Dann hatte ich das Glück, mit Sprachkundigen zusammenzukommen. Während der Dreckarbeit unterhielt ich mich auf englisch mit einem Deutschamerikaner, lernte von einem Brasilianer portugiesisch. Der war ein guter Lehrer, er unterrichtete nach der Methode der Berlitzschulen, bei der im Unterricht kein deutsches Wort fiel. Ich lernte spielend die Anfangsgründe einer klangvollen Sprache. Freilich, Notizen zu machen war während der Wochen Tagesarbeit streng verboten. So mussten wir das heimlich tun. Kleine, zwei Zentimeter lange Bleistiftstückchen hatten wir in unsere Kleidung eingenäht. Einen kleinen Zettel mit Notizen und Vokabeln verbargen wir unter den Haufen von Lumpen, setzten uns mit dem Rücken gegen die Tür, so dass wir durch den Spion von außen nicht beobachtet werden konnten, und lernten. Stundenlang oft. War der Abend gekommen, durften wir zur Lektüre greifen, die uns dosiert und zensuriert zugemessen wurde. Aber es war ein weiter und demütigender Weg, bis es gelang, Lektüre oder Schreibzeug zu erhalten. Beim Morgenaufschließen mussten wir uns einmal in der Woche zum Oberamtmann vormelden. Schloss der Beamte schnell auf und verschwand sofort, war das Vormelden für diese Woche nicht mehr möglich. Dann geruhte der Oberamtmann, bittende Sträflinge einige Tage später zu empfangen. Wir wurden aufgerufen, mussten an dem eisernen Rundgangstieg eine Etage höher mit dem Gesicht zur Wand stillstehen und, je zwei Meter Abstand haltend, schweigend warten, bis die Reihe an uns kam. Auf ein Klingelzeichen betraten wir den Raum des Oberamtmanns, nannten unsere Nummer und Namen und warteten. Dann brachten wir unsere Bitte vor, die er je nach Sachlage und Laune ablehnte oder annahm. Es musste zum Beispiel um die Erlaubnis gebeten werden, sich ein Schreibheft anzulegen. Dieses dicke Heft wurde uns nur am Wochenende ausgehändigt, um für die Arbeitswoche wieder weggeschlossen zu werden. Da konnten wir hineinschreiben, was wir wollten, Auszüge aus Büchern, Übersetzungen, Noten, Lieder, eigene Ideen und sonst noch allerlei. Das war doch etwas Köstliches, sich etwas notieren zu können, seinen Gedanken Ausdruck geben zu können. Aber in gewissen Abständen wurden diese Hefte vom Oberlehrer der Anstalt kontrolliert, ob sich nicht verbotene Dinge darin befänden, und er malte sein Signum mit Datum stets dazu. Mitunter, wenn er glaubte, etwas Verbotenes oder Anrüchiges gefunden zu haben, ließ er von dem Betreffenden eine Abschrift dieser Stelle machen. Es hieß, das könne üble Folgen, etwa für die Entlassung haben.
An das Stehen und Warten, schweigend und im Zweimeterabstand, hatten wir uns allmählich so gewöhnt, dass wir uns gewundert hätten, wäre es plötzlich anders gewesen. Der Stolz und die Selbstachtung wurden allmählich in uns abgetötet. Wir wurden wie dressierte Hunde, die die Befehle ihrer Herren entgegenzunehmen hatten. Aber das war nur äußerlich. Innerlich war unser Geist wach und rege.
Wir taten mit Vorliebe verbotene Sachen: Wir schauten aus den Fenstern, die hoch oben in den Zellen angebracht waren und zu denen man hinaufklettern musste. Wir flüsterten auf den täglichen Rundgängen miteinander, fertigten uns verbotene Bleistifte und Notizzettel an. Aus Lumpen machten wir Decken, um gegen die Kälte geschützt zu sein. Wenn wir auch äußerlich die Dressierten mimten, so taten wir doch alles, um noch etwas Individualität zu pflegen und den Geist wach zu halten.
Viele, besonders die schwerer belasteten Politischen, steckte man in Einzelhaft. Aber auch sie benutzten die Gelegenheit des täglichen Rundganges oder Exerzierens zu Mitteilungen. Sie waren genau so rege. Sie turnten allein in ihren Zellen, sie lasen und beschäftigten sich, so gut sie konnten. Keiner wurde stumpf, und nur von einem unter den vielen Hunderten war bekannt geworden, dass er während der langen Zellenhaft innerlich zusammenbrach und – um seine Leiden abzukürzen – zum Verräter wurde.
Nach der Zellenhaft folgte die Gemeinschaftshaft. Ein riesiger Schlafsaal, ein großer Arbeitsraum für Hunderte schweigende, nur gelegentlich flüsternde Gestalten, die alle mit der gleichen dreckigen Lumpenarbeit beschäftigt waren. Abends, wenn der verhasste Zwang der Wachtmeister im Schlafsaal aufgehört hatte, begann das Raunen und Wispern, das Erzählen und Berichten. Freundschaften wurden geschlossen, und die kargen Minuten des Sich-selbst-überlassen-Seins, fern dem Zwang, waren wie eine neue Welt.
Eines Abends, es war im Juni 1938, las ich den Kameraden im Schlafsaal leise ein Gedicht vor, das mir angesichts der vielen jungen und älteren politischen Gefangenen gekommen war. Nach einem Ausspruch von Liebknecht, der den politischen Kämpfer so charakterisiert hatte, hieß es:
Tote auf Urlaub
Viel blanke Jungen in einer Reih’,
sind auch paar Ältere mit dabei;
blitzen die Augen und weht weich das Haar,
ernster die anderen, träumerisch gar,
lachen die Lippen und sprüht das Leben,
will einer Zukunft Inhalt geben.
Sahst du sie nicht?
Sahst du die Sonne nicht spielen
auf blondem und dunklem Haar?
Doch als die Blätter fielen,
sahst du sie wieder – zwar
waren’s dieselben und waren’s doch nicht:
wächsern die Lippen und still das Gesicht,
lagen sie Reihe an Reihe, verreckt,
dort auf dem Sand,
kugeldurchbohrt und hingestreckt,
wo man sie fand,
lagen nun stumm in der Blüte des Lebens.
War denn ihr Ringen und Kämpfen vergebens?
Blieb denn nicht mehr als die wilde Anklage
und der Schrei bis ans Ende der Tage
und die zermarternde Pein,
Zeuge von der Vernichtung
soviel blühenden Lebens zu sein? –
Das waren die Toten auf Urlaub.
Die in den Betten Liegenden hörten und nickten und dachten nach und verstanden.
Doch bald wurde die Belegschaft aufgelöst, ein Teil von uns wanderte in die »Hofkolonne«. Da gab es tagsüber die großen Fäkalienfässer zu fahren, deren Inhalt uns oft über die Finger spritzte. Es mussten Kohlen geholt werden – menschliche Gespanne wurden gebildet. Dreck gab es viel, aber wir kamen ein wenig herum, gelegentlich sogar in die Stadt, wo unsere Sträflingskleidung schon kein Aufsehen mehr erregte.
Und wieder wanderte ich in eine andere Belegschaft, wo ich meinen Geist mit dem Sortieren von Schweineborsten zu beschäftigen hatte. Die weißen, die schwarzen und die grauen zu trennen, was war das für eine interessante Arbeit! Ich war froh, wenn ich mit anderen zum Kartoffelschälen und Gemüseputzen gerufen wurde. In der Küche saßen wir freier, konnten ungehinderter miteinander sprechen, ohne die hämischen Blicke der aufsichtführenden Wachtmeister unablässig über unseren Köpfen zu fühlen, hatten etwas mehr zu essen als die knappe Kost der anderen, und wenn auch die Arbeit dreckig war, so kam sie mir doch abwechslungsreicher vor als die frühere. Ich war deshalb ganz froh, als ich die Ehre hatte, zu den ständigen Kartoffelschälern ernannt zu werden. Acht Monate lang habe ich diese Arbeit dann getan und darin eine beträchtliche Fertigkeit erlangt, musste ich doch ein tägliches Mindestpensum von sechs Eimern schälen.
Mitunter fragten mich die Kameraden von der Belegschaft, ob wir wohl Natron oder ein anderes, die Triebe »dämpfendes« Mittel dem Essen beimischten. Denn das sexuelle Verlangen sei bei ihnen ja wie abgestorben. Aber wir wussten, es kam nichts in das Essen hinein. Das Ausbleiben aller sexuellen Gefühle hatte andere Ursachen: die magere Kost, der ungeheure seelische Druck, der auf allen lastete, die klösterliche Abgeschiedenheit, das Fernsein von Frauen, auch von Bildern. Es war ein ganz natürlicher Vorgang.
Gelegentlich mussten wir in den riesigen Kellergewölben Kartoffeln sortieren. Dort waren wir ganz unter uns, keine Aufsicht ließ sich blicken und dort summten wir halblaut unsere Lieder, die alten Lieder, die wir so lange nicht mehr gehört hatten. Ich lernte dort das Lied von Tjor Folesohn – heute heißt es »Unsterbliche Opfer« –, das in den Gewölben wie eine zauberhafte Melodie widerhallte.
Wir waren zu dieser Zeit schon recht gut orientiert. Wir hatten nicht nur Tageszeitungen, wir hörten von Zugängen auch manches, was nicht in den Zeitungen stand. Wir wussten genaues über den Bau des Westwalls, was damals noch geheimgehalten wurde. Wir wussten von Truppenverschiebungen von hier nach dort. Ja, ein Besucher berichtete uns einmal von der Explosion eines deutschen Luftschiffes in Brasilien, was im Nu die Runde machte. Und als ein Wachtmeister der Belegschaft nach einigen Stunden von dem Neuesten erzählen wollte, meinten die Sträflinge: »Ach, das mit dem Zeppelin, das ist ja schon uralt«. Der Wachtmeister war platt.
In den letzten drei Monaten der Strafhaft kam ich in die Gärtnerei, zu einer besonders begehrten Arbeit. Gewiss, sie war nicht immer leicht. Aber sie fand im Freien statt; im Gewächshaus standen herrliche Blumen, lang entbehrte Anblicke!
Man hatte dort viel mehr Freiheit, zu gehen und zu reden. Außerdem war die Belegschaft, zu der die Gärtnerei gehörte, eine besonders berühmte. Waren dort doch ausschließlich Politische. Manche Freunde traf ich wieder, viele Jugendliche mit besonders regem Geist und Sinn. Da waren einige aus einfachem Stand unter ihnen, die Gedichte schrieben, gute sogar, die philosophische Werke lasen: Es war eine politische Elite, die dort dem trostlosen Dasein Trotz zu bieten suchte. Und dies war um so mehr nötig, als einige der dort stationierten Beamten besonders kleinlich waren und alle schikanierten. Für des Beim-Sprechen-Ertapptwerden verhängten sie Strafversetzungen an einen anderen Platz, sie machten pedantische und peinliche Kontrollen der Kleidungsstücke. Alles musste genau nach einem Schema gefaltet und platziert sein, sie verlangten ein zackiges Grüßen, eine stramme Haltung, einen äußerlichen, mehr als preußischen Drill – obwohl sie Sachsen waren.
Kleine Unterbrechungen gab es an dem einen oder anderen Sonntag, eine sogenannte »Singestunde«. In der »Kirche«, einem großen holzgetäfelten Saal, spielten die Orgel oder ein Klavier, und Volkslieder wurden gesungen. Wir sangen alle eifrig mit, die verrosteten, des lauten Sprechens entwöhnten Kehlen tauten auf, der Klang der altgewohnten Lieder entlockte vielen wetterharten Gestalten Tränen. Besonders bei den Kriminellen sah man viele weinen. Wohl mit Absicht wählte der Lehrer, der diese Singestunden leitete, solche sentimentalen Lieder wie »Aus der Jugendzeit« oder »In einem kühlen Grunde«. Es war ein billiges Mittel, Rührung zu erzeugen; anscheinend versprach sich die Anstaltsleitung Besserung davon.
Einige Male hielt der »Oberlehrer« der Anstalt einen Lichtbildervortrag. Seine Themen waren »Eine Rheinreise« oder er berichtete von Reisen durch fremde Länder, wozu er Lichtbilder projizierte und dazu sprach. Seine Vortragsweise war so, wie er es gewohnt war, wenn er zu achtjährigen Buben sprach. Viele Gefangene empörten sich innerlich, diese Salbadereien anhören zu müssen. Aber man zwang uns, und schließlich war es eine Unterbrechung des altgewohnten Trottes.
Ein- bis zweimal im Monat war es uns Gefangenen erlaubt, nach Hause zu schreiben oder Briefe zu empfangen. So eintönig die Haft war, in allen lebte der Wille, mit den Angehörigen in Verbindung zu bleiben. Briefe waren das einzige Fenster, durch das wir in die Freiheit schauen konnten. Viele, die früher draußen nie oder selten schrieben, schrieben jetzt gern. Auch ich, dem Schreiben früher nur eine lästige Angelegenheit gewesen war, hätte jetzt mühelos viele Seiten schreiben können, wenn es erlaubt gewesen wäre. An dem Ausmalen der kleinsten Dinge fand ich eine früher ungeahnte Freude.
Schließlich nahte der Tag, an dem ich aus der Strafhaft entlassen werden sollte. An meinem Kalender, den ich mir in einem Heft selbst gemacht hatte, waren die Tage, die noch nicht durchgestrichen waren, weniger und weniger geworden. Zweifel und bange Ungewissheit drückten sich in unserer Stimmung aus, wie ich sie damals beschrieb:
Schlussworte
Dieser langen Jahre
Qual ist nun vorbei,
wie ein Schatten huschte
der Tage Einerlei;
schleppenden Schritten nahte
das Ende dieser Zeit.
Soll sich jetzt alles wenden,
wirst du jetzt befreit?
War denn nun alles sinnlos
und vergeblich, was du littest?
Ist denn nun alles verfallen
und vergessen, wofür du strittest?
Siehst du denn keine Werte,
die die Bitternis in dir hob?
Merkst du nicht die Wandlung,
die sich in dir vollzog?
Bist du nicht anders geworden
in dieser harten Zeit?
Klingt nicht ein neues Lied in dir
trotz aller Bitterkeit?
Vielleicht musst du dir einmal
die Rechenschaft abgeben:
Möchtest die Zeit nicht missen,
du lerntest hier erst leben.
Die rührende Selbsttröstung, die in diesen Versen enthalten ist, kann man erst nach Jahren ganz und gar ermessen.
Am letzten Tag kam ich in die sogenannte »Abgangszelle«. Ich vertauschte das dünne, hässliche Drillich mit meinen Zivilsachen, und ich wartete. Hoffen und Bangen erfüllten mich. War die Freiheit jetzt wirklich nahe?
Stunden um Stunden vergingen, dann rief man mich zum Oberamtmann. Der eröffnete mir, dass ich auf Grund eines Gestapo-Beschlusses nicht in die Freiheit, sondern auf unbestimmte Zeit in ein Konzentrationslager gebracht würde.
So waren nun die Würfel gefallen. Während die Kriminellen mit ihrer Entlassung ohne Ausnahme nach Hause gingen, schwebte über uns Politischen vom Anfang der Haft an das Damoklesschwert des »Was nachher?« Jahrelang schleppten wir diese Ungewissheit mit uns herum, um schließlich wieder hinter die Stacheldrähte verbannt zu werden. Die Qual der Ungewissheit, der unbestimmten Zeit, die diese Haft im Konzentrationslager dauern würde, erlitten wir reichlich. Kein Wunder, dass die Nerven vieler Kameraden dabei in die Brüche gingen. Ein raffiniertes System, den Menschen bis zum letzten Tag seiner Strafhaft darüber im Unklaren zu lassen, ob er die Freiheit wieder sehen würde oder nicht!
Es folgten weitere sechs Wochen in Schutzhaft und im gleichen Zuchthaus: Ich wartete auf den Abtransport. Wieder zwang man uns zur Arbeit mit dreckigen, stinkigen Lumpen, wieder mussten wir für diese Arbeit das hässliche Drillich anziehen. Es war alles genauso, als ob wir noch immer Sträflinge wären.
Dann kam der Abtransport im engen Zellenwagen. Buchenwald sollte der Bestimmungsort heißen. Wie mochte es dort sein? In unserem Wagen war einer, der ein wenig Bescheid wusste. Er zeigte nur seine schwieligen, aufgerissenen Hände. »Mehr will ich euch nicht sagen.« In Halle machten wir Zwischenstation und wurden im dortigen Gefängnis zu dreißig in eine enge Zelle gepfercht, die vielleicht für vier bis fünf Menschen Platz geboten hätte. Es war heiß und stickig. Ein paar Kriminelle erzählten ihre lauten Geschichten von Heiratsschwindeleien und dergleichen. Täglich der monotone, schweigende Rundgang in winzigem Hof, eine halbe Stunde lang.
Weitertransport, diesmal bis Weimar. Dort holte ein großes Polizeiaufgebot uns Gefangene vom Bahnhof ab. Unsere Gruppe war inzwischen bis auf fünfzig Mann angewachsen, alle sollten nach Buchenwald. Wir wurden auf Wagen verladen.
»Bei Fluchtversuch wird jeder erschossen«, rief uns ein Polizist zu.
Es war August 1938.
Buchenwald
Niedrige Gebäude, vor dem Lager eine gut asphaltierte Straße. Viele bunte Blumenbeete vor den Baracken, seltsamer Kontrast zwischen der schreienden SS und den blühenden Blumen! Wir müssen in der Baracke der politischen Abteilung auf dem Korridor in zwei Gliedern antreten, mit dem Gesicht zur Wand, schweigend. Wehe, wenn einer sich muckst! SS-Männer gehen vorbei und sparen nicht mit Ohrfeigen. Personenaufnahme, barsch, von Schimpfworten begleitet. Dann durch ein großes Tor ins Lager.
Am Torgitter stehen die Worte: »Jedem das Seine«.
Innerhalb des Lagers müssen wir fünfzig »Neuen« stehenbleiben. Mit dem Gesicht zum Tor. Wir sehen nicht, was hinter uns vorgeht. Dann schleppt man an unserer Seite ein Holzgestell herbei (später erfuhren wir, dass es der berüchtigte »Bock« war), schnallt dort einen Menschen auf und peitscht ihn aus. Fünfundzwanzig Hiebe zählen wir. Und dann peitscht man den nächsten aus und den dritten. Das wimmernde Geschrei hallt über den Platz, und ein Schauer durchfährt uns. Das ist also die Begrüßung in Buchenwald!
Später erfahren wir, dass man die Auspeitschungen absichtlich an den Tagen vornimmt, an denen »Zugänge« ins Lager kommen, um ihnen gleich den richtigen Eindruck zu vermitteln.
Dann zum Bad. Ein großer Raum mit vielen Duschen. Danach werden wir geschoren. Radikal. Jedes Härchen wird entfernt. Wir müssen unsere Zivilsachen abgeben und empfangen hässliches, blauweiß gestreiftes Zebra-Drillich. Wir erkennen uns gegenseitig nicht mehr wieder. Wie Harlekine sehen wir jetzt aus, in der Zebrakluft und mit unseren geschorenen Köpfen. Aber da es uns alle betrifft, machen wir uns nicht groß Gedanken darüber. Wir empfangen einen kleinen Stoffstreifen, auf dem unsere Nummer gedruckt steht, und ein Stoffdreieck, den sogenannten »Winkel«. Jede Kategorie von Häftlingen hat einen anderen Winkel: rot die Politischen, schwarz die Asozialen, grün die Kriminellen, lila die Bibelforscher, rosa die Homosexuellen usw. Es gibt einen richtigen Kodex, den man lernen musste, um sich zwischen all den Farben, Punkten, Streifen und Sternen zurechtzufinden, die jeder von uns auf der linken Brustseite und rechts am Hosenbein noch einmal tragen muss.
Wir werden in den sogenannten »Zugangsblock« gebracht. Eine Baracke, rechts und links je ein Schlafraum mit dreistöckigen Eisenbetten und ein Tagesraum mit Bänken und Tischen. In der Mitte Waschraum und Abort. Uns Politische setzt man an besondere Tische, auch die Asozialen für sich. Wir halten gute Kameradschaft, hören, dass man des Abends, nach dem »Abpfeifen« die Baracken nicht mehr verlassen darf, sonst wird man erschossen. Das ist zwar nicht wahr, aber Neulinge kann man doch damit schrecken. Wir durchlaufen die verschiedenen Instanzen. Wir werden fotografiert, registriert, untersucht, noch einmal registriert und befragt. Und wir haben die ersten Eindrücke vom KZ.
Eines Abends hat ein »Schwarzer«, ein Asozialer, ein Messer entwendet und will es dem Blockältesten auf dessen Geheiß nicht gleich geben. Da packt dieser einen Knüppel und schlägt wie ein Rasender auf den »Schwarzen« ein, der blutüberströmt zu Boden sinkt. Keuchend lässt der Blockälteste von seinem Opfer ab. »Und so geht es allen, die hier nicht Disziplin halten!« schreit er. Wir sind starr vor Schreck. So geht es hier zu. Faustrecht. Der Knüppel regiert.
Das Wasser ist knapp, zeitweise wird es abgestellt. Handtücher gibt es in den ersten Wochen nicht. Dreißig Mann trocknen sich gemeinsam an einem Laken ab. Aber in den Bassins im Waschraum ist viel Wasser. Ich hole mir – was verboten ist – eine Tasse voll heraus. Hinter mir hat das ein Stubenältester gesehen, ein großer, grober Krimineller. Und schon habe ich zwei klatschende Ohrfeigen erwischt, und der Hüne zieht ab. Wir merken: Wer hier eine Funktion hat, kann die anderen niederknüppeln, kann sie schlagen. Und zwar Häftlinge die Häftlinge, die SS hält sich heraus. Wir sehen die groteskesten Bilder im Lager. Sogenannte »Kapos« – eine Art Vorarbeiter – schlagen auf die Häftlinge ein, die ihre Arbeit nicht bewältigen können, manchmal vielleicht auch nicht recht wollen.
Aber es gibt ja schließlich niemals einen Pfennig Bezahlung. Hatte man im Zuchthaus noch vier bis acht Pfennige am Tage bekommen, hier erhält man überhaupt nichts. Darum also die Antreiberei! Blutende Köpfe, schmerzende Rücken sind besonders in manchen schlechten »Kommandos« an der Tagesordnung. Ja, in dem berüchtigten Steinbruch haust ein Kapo, dem es Vergnügen bereitet, die Leute mit Schlägen über die Postenkette zu jagen oder sie so zu prügeln, dass sie freiwillig über die Postenkette gehen und dann erschossen werden.
Die Kapos sind zumeist Kriminelle, vielfach vorbestrafte, üble Elemente, denen die SS, da sie brutal genug waren, die Rollen von Vorarbeitern gegeben hat – und dazu asoziale Elemente, die froh sind, andere für sich arbeiten lassen zu können. Auch Politische sind unter den schlechten Kapos, frühere Fremdenlegionäre, die die ganze Wildheit und Erbarmungslosigkeit einer exotischen Gegend mitgebracht haben, Abenteurer, Leute, die von der SS den politischen Winkel bekamen und den Ruf wirklicher Kämpfer diskreditieren.
So sehen wir Neuen im Lager sehr bald den Kampf zwischen den verschiedenen Farben, den Machtkampf, besonders zwischen Grün und Rot. In ihrer Brutalität sind die Grünen, die »BVer« (Berufsverbrecher), den Roten überlegen; Intelligenz, Zusammenhalt und moralische Qualität sind die Vorteile der Roten. Und es ist gut, dass wir Politischen unter den Neuen schnell Anschluss an die alten Politischen finden. So wird uns in vielen Dingen geholfen, wir werden beraten, insbesondere bei der Wahl oder Einteilung in die Arbeitskommandos.
Diese Zuordnung geschieht wenige Tage nach unserer Ankunft. Der Lagerführer, SS-Obersturmbannführer Rödl, ein dicker, breiter Bayer, teilt uns zur Arbeit ein. Gleich welchen Beruf man angibt, sei es Bäcker, Fleischer, Kaufmann, Intellektueller, man kommt zumeist in den Steinbruch oder in ein Schachtkommando. Andere Handwerker verrichten allerdings mitunter auch ihre Facharbeit. Da ich als Werkstudent an mehreren Häusern mitgebaut hatte und mich jetzt als Bauarbeiter ausgeben kann, werde ich dem Baukommando für eine neue Ziegelei zugeteilt.
Jeden Morgen um dreiviertel vier stehen wir nun auf. Um fünf Uhr rücken wir zum Appell, eifrig Gleichschritt haltend. Dann steht der ganze Haufen von ungefähr zweihundert Zugängen, dann steht das ganze Lager, damals an die sechstausend Mann, bis sie alle gezählt sind und der Befehl gegeben wird: »Arbeitskommandos antreten«. Und im Nu sind die in schnurgeraden Kolonnen ausgerichteten Häftlinge eine einzige durcheinanderquirlende und sich drängende Masse. Jeder versucht, den Standplatz für sein Arbeitskommando zu erreichen. Nach kurzer Zeit stehen die Kommandos, und der Abmarsch beginnt. Vor dem Tor steht ein glasverdecktes Pult, an dem der Arbeitsdienstführer seinen Posten bezogen hat. Jeder Anführer eines Kommandos, der Kapo, meldet die Stärke seiner Häftlingsgruppe, und in ausgerichteten Fünferkolonnen geht der Marsch durch das Tor. Dröhnend hallen jeden Morgen die Torwände vom Tritt dieser Tausende, und wer etwa am Tor steht und diesen Vorbeimarsch am Morgen miterlebt, dem bietet sich ein unvergessliches Bild dieser zusammengepressten, in Uniformität und Drill gezwungenen und doch mit stolzer Kraft herausmarschierenden Kolonnen.