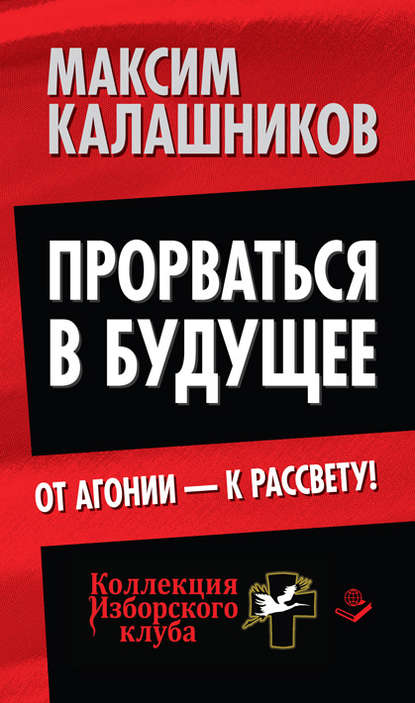- -
- 100%
- +
Alle diese Menschen wohnten dauerhaft in diesem ehrwürdigen Haus.
Im Sommer kamen noch einige Gäste dazu. Die Grosstanten vermieteten Fremdenzimmer an die Kurgäste. Dann mussten wir zusammenrücken. Tante Fanny hatte nicht mehr ihr eigenes Zimmer und ich nicht mehr mein eigenes Bett, sondern schlief im Gräbchen zwischen den beiden Grosstanten. Die Leute, die da aus ganz Europa kamen, waren noch interessanter als die Dauergäste. Da war der Kapellmeister, der mit dem Metermass kam, um das Bett auszumessen, weil er so gross gewachsen war. Grosstante verfügte als Einzige im Dorf über ein Bett, welches ihm passte. Die Fremdenzimmer waren mit Wasserkrug, Waschbecken und einem Nachttopf ausgestattet. Wenn die Gäste enttäuscht nach dem fliessenden Wasser fragten, zeigte Tante Fanny aus dem Fenster auf den See hinaus.
Im Stiegenhaus war eine Toilette für die Gäste. Wir mussten nach draussen gehen. Die Toilettenhäuschen neben dem Haus sahen aus wie kleine Kapellen. Die Kapelle auf der rechten Seite des Hauses war für die Männer bestimmt, die links für die Frauen. Im Männerklo befand sich eine WC-Schüssel aus weissem Porzellan, im Frauenhäuschen waren zwei hölzerne Plumpsklos nebeneinander aufgestellt. Sie waren wohl für Mutter und Kind gedacht, denn der eine hölzerne Thron war bedeutend niedriger als der andere. Ich wollte nie allein dorthin gehen, da ich fürchtete, ins dunkle Loch hinunterzufallen. Immer wieder erkundigten sich Kurgäste, ob sie die kleinen Kapellen besichtigen dürften. Heute zieren diese beiden Kapellen die Gartenanlage und sind denkmalgeschützt. Es weiss wohl niemand mehr, wozu sie früher dienten.
Wenn an den warmen Sommertagen die Fremden in schulterfreien Tops und sehr kurzen Shorts – oder auch sonst viel nackte Haut zur Schau stellend – an dem Hause vorbeiflanierten, fühlten sich beide Grosstanten in ihrer «Schneiderinnenehre» – aber mehr noch in ihren sittlichen Gefühlen – verletzt. «Man sollte sie mit Weiderütchen zwicken», ereiferte sich die Grosse Tante. Wenn es dann mehrere Tage hintereinander regnete, sahen die Grosstanten darin eine himmlische Bestrafung für die unzüchtige Kleidung der fremden Gäste. Sie überzeugten mich davon, dass schlechtes Wetter eine Strafaktion des lieben Gottes war. Ich versuchte, ihn zu besänftigen, indem ich etwas Weihwasser im Garten verspritzte.
Unheimlich war es, wenn nachts ein heftiges Gewitter tobte, der Wind durch den Kamin pfiff und schwarzes Pech aus der Feuertüre des grossen Ofens floss. Dann verbrannte die Grosse Tante Stechpalmen, welche sie zuvor am Palmsonntag in der Kirche hatte segnen lassen, um den Sturm zu besänftigen. Ich hörte einmal sagen, dass in solchen Nächten der Geist einer jungen Frau durch das Haus irre. Die Unglückliche soll sich vor vielen Jahren aus dem Fenster gestürzt haben.
In der Schneiderei
Die meiste Zeit hielt ich mich im Schneideratelier auf, wo die beiden Grosstanten mit ihren Näharbeiten beschäftigt waren. Es war eine Fundgrube an Spielmaterial: alte Stoffresten, leere Fadenspulen, Knöpfe und sonst allerlei, was in einem Schneideratelier als Abfall anfiel. Die Grosstanten liessen mich an ihrem Arbeitstisch spielen. Ich schaute ihnen bei ihrer Arbeit zu und kopierte ihre grossen weissen Stiche für meine Näharbeiten. «Z’fadeschloh» nannten sie dies. Ich wusste nicht, dass diese grossen Stiche nur Heftnähte waren, die man nach Fertigstellung der Naht wieder auftrennen musste. Doch die Grosse Tante spendete mir Lob für meine Arbeit: «Aus dir wird sicher einmal etwas!» Obwohl sie sonst kaum Lob verteilte, war es ihr wichtig, mir das zu sagen. Ihre Patin, bei der sie nach dem Tod der Mutter für einige Zeit wohnen musste, hätte ihr immer gesagt, dass aus ihr nichts werden würde. Als die Grosse Tante dann ihre Ausbildung zur Schneiderin abgeschlossen hatte, war der lapidare Kommentar der Patin: «Ich hätte nie gedacht, dass aus dir einmal etwas wird.»
Ich sang gerne, was offenbar den beiden Tanten gefiel. Einmal während des Arbeitens wurde ich von der Grossen Tante aufgefordert, doch wieder dieses Lied zu singen, welches ich immer wieder vor mich hinträllerte. Voll Inbrunst sang ich Marias Lied vom kleinen Mädchen, welches sich am Grab seiner Mutter über die böse Stiefmutter beklagt. Offenbar hörte mir die Grosse Tante zum ersten Mal richtig zu. Sie wurde plötzlich ärgerlich und verbot mir, dieses Lied je wieder zu singen. Ich war verwirrt. Was hatte ich denn falsch gemacht? Erst später begriff ich: Grossmutter und die Grosse Tante waren ja selbst bei einer Stiefmutter aufgewachsen, ihre eigene Mutter lag eines Morgens tot neben ihnen im Bett. Aus Bemerkungen von Grossmutter und der Grossen Tante musste ich schliessen, dass sie sich von ihrer Stiefmutter sehr stiefmütterlich behandelt fühlten. Die Stiefmutter hatte noch zwei eigene Kinder. Eines davon war Tante Fanny, und Tante Fanny hob immer hervor, wie gut ihre Mutter zu allen Kindern war …
Josefli
Im kleinen Haus über der Strasse wohnte der Kaminfegermeister mit seiner Familie. Zwei Töchter waren schon fast erwachsen, doch die jüngste, die kleine Martha, war nur ein Jahr älter als ich. Ich bewunderte sie, da sie schon so viel wusste. Vor allem jedoch beneidete ich sie um ihre langen blonden Zöpfe. Martha kam oft zu mir herüber, da auch sie niemanden zum Spielen hatte. Auf der langen Holzbank vor dem Haus bauten wir gemeinsam mit Steinen, Blättern und Ästen und allem, was wir sonst noch draussen fanden, ein Haus für unsere kleinen Püppchen. Die Püppchen hatte ich vorher aus dem Abfall des Schneiderateliers zusammengebastelt. Als Gerüst für die Püppchen verwendete ich die Haarnadeln, welche die Grosse Tante nicht brauchen konnte. Mit diesen Püppchen spielten wir nun selbsterfundene Geschichten.
Wenn wir etwas laut wurden, liess mich die Grosse Tante zum Zvieri rufen, und Martha musste nach Hause gehen. Dann war der Nachmittag gelaufen, denn ich wusste, nachher war das Rosenkranzgebet angesagt. Manchmal versuchten Martha und ich, uns wegzuschleichen, oder wir waren so ruhig, dass Grosstante uns vergass. Doch das gelang nur selten. Grosstante fand, es sei besser, wenn ich drinnen mit ihr und Tante Fanny beten würde, als draussen herumzutoben und Lärm zu machen.
Die Grosse Tante betete vor, während sie sich weiter mit ihrer Näharbeit beschäftigte. Tante Fanny und ich sollten jeweils «abnehmen», das bedeutete, mit dem zweiten Teil des «Ave Maria» zu antworten. Weil Grosstante während des Arbeitens keinen Rosenkranz halten und die Perlen zählen konnte, behalf sie sich mit einem besonderen Zählsystem. Mit «erster Chor der Engel, zweiter Chor der Engel» usw. zählte sie sich bis zum zehnten Ave Maria durch, um dann mit dem «ganzen himmlischen Hofe» ins nächste «Gesätzchen» überzuwechseln. Ich musste still dasitzen; was für eine Qual für ein fünfjähriges Kind! So konzentrierte ich mich darauf, ob Grosstante richtig zählte. Wie war ich enttäuscht, wenn sie mehrmals das gleiche «Gesätzchen» wiederholte, ohne es zu merken, und wie freute ich mich, wenn sie einige Ave Marias übersprang. Auf diese Weise gestaltete ich mir das Beten etwas unterhaltsamer und lernte dabei erst noch zählen.
Eines Morgens stand die älteste Schwester von Martha mit verweinten Augen vor der Türe und sagte knapp: «Josefli ist gestorben.» Die Grosse Tante nähte schnell drei schwarze Ärmelschürzen für die Mädchen, welche diese zum Ärger der Grosstante später nur zum Teppichklopfen anzogen. Tante Fanny pflückte mit mir im Garten eine weisse Lilie. Dann gingen wir gemeinsam zum Kaminfegerhaus. Die älteste Schwester führte uns in ein Zimmer. Dort stand mittendrin ein kleiner weisser Sarg. Darin lag ein blasser Junge. Die Augen hatte er geschlossen. Es sah aus, als ob er schlafen würde. Ein Kranz von weissen Rosen lag auf seiner Brust. Ich sollte nun die weisse Lilie dazulegen, doch ich getraute mich nicht, näher zu treten, bis mir die Tante ungeduldig die Blume aus der Hand riss und selbst in den Sarg legte.
Ich hatte noch niemals zuvor einen Toten gesehen, und jetzt lag da ein kleiner Junge vor mir – ein wenig älter als mein Bruder – ohne sich zu regen. Das war Josefli? War das nun dieser Josefli «selig», von dem die Grossmutter immer sprach? Ich wusste damals noch nicht, dass «selig» verstorben hiess.
Niemand sagte mir, was mit diesem Jungen hier los war. Ich wusste bis anhin gar nicht, dass Martha auch einen kleinen Bruder hatte. Sie hatte mir nie von ihm erzählt. Warum war er gestorben? War er auch im Spital gewesen? Ich getraute mich nicht, Fragen zu stellen, und niemand sprach mit mir darüber. Von nun an schlossen wir auch den kleinen Josefli ins Rosenkranzgebet mit ein.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Tod dieses kleinen Jungen in einer Verbindung zu meinem Bruder stand. Wenn mein Bruder auch sterben würde? Täuschte ich mich, spürte ich es, oder wurde es sogar laut ausgesprochen, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn mein Bruder auch sterben könnte? Einmal erzählte meine Grosse Tante von einem jungen Mann, der als Kind auch sehr krank war. Seine Eltern bestürmten den lieben Gott so sehr, dass er ihn wieder gesund mache. Der Junge überlebte, kam jedoch später auf die schiefe Bahn und wurde zum Mörder der eigenen Mutter. Ich war verwirrt. Es hiess doch immer, wir sollten für unseren Bruder beten. War es nun plötzlich falsch, den lieben Gott eindringlich zu bitten, unseren kleinen Bruder wieder gesund zu machen?
Anfang Juni kam der lang ersehnte Bericht vom Kinderspital. Es gehe dem Bruder ausserordentlich gut. Die Tuberkulose sei zwar noch nicht ausgeheilt, der Bruder müsse noch in ein Sanatorium zur Kur. Die Grosse Tante brachte mich wieder zu meiner Familie zurück.
Mein kleiner Bruder war da, aber nur für wenige Tage. Er hatte grosse Freude, mich zu sehen und wollte mich packen und umarmen. Doch ich versuchte, ihm immer wieder zu entwischen. Ich hatte solche Angst, auch so krank zu werden wie er. Papa bemerkte meine Not und versicherte mir, dass mir die Krankheit des Bruders nichts mehr anhaben könne.
Noch eine Schwester
In all dieser Aufregung um meinen Bruder ging es Mama nicht gut, und sie musste wieder ins Spital. Wieder wurden wir aufgefordert, zu beten. Am Abend rief Papa an, um uns mitzuteilen, dass wir ein kleines Schwesterchen gekriegt hätten. Doch die Stimmung schien gedrückt. Später erfuhr ich, dass es eine sehr problematische Geburt war und es an ein Wunder grenzte, dass Mutter und Kind überlebt hatten.
Was war geschehen? Meine Mutter äusserte gegenüber dem Arzt die Befürchtung, dass es sich bei ihr wohl um einen «Plazentavorfall» handeln könnte, da das Kind nicht spontan auf die Welt kommen wollte. Bei ihrer Mutter war das jüngste Kind – ein Bübchen – aus diesem Grund im Mutterleib erstickt. Der Arzt ignorierte die Warnung der Mutter, packte mit der Zange zu und stach direkt in die Plazenta. Blut spritzte im grossen Bogen raus. «Und das ausgerechnet um die Mittagszeit, wenn es sonst schon so viel zu tun gibt,» dies waren die letzten Worte der Krankenschwester, an die sich die Mutter noch erinnern konnte, bevor sie das Bewusstsein verlor. Mutter und Kind waren in Gefahr. Plötzlich musste alles sehr schnell gehen. Der Arzt entschloss sich zu einem Kaiserschnitt. Es wurde sehr kritisch. Die Mutter hatte bereits viel Blut verloren und war sehr schwach. Sie brauchte viele Bluttransfusionen. Unsere ganze Verwandtschaft war an dieser Geburt mitbeteiligt, denn alle Erwachsenen wurden später zum Blutspenden aufgeboten, damit die Klinik ihre Blutkonserven wieder auffüllen konnte.
Von dieser schweren Geburt erholte sich unsere Mutter nie mehr richtig.
Und nun war Maria plötzlich wieder da. Die neue Stelle hatte ihr nicht gefallen. Im Winter musste sie frühmorgens bei jedem Wetter mit dem Fahrrad die Brote verteilen. Der ausbezahlte Lohn war auch nicht so hoch wie versprochen. Maria fühlte sich ausgenutzt und vermisste den «Familienanschluss», den sie bei uns sehr intensiv erlebt hatte. Sie fragte, ob sie wieder bei uns arbeiten dürfe. Maria kam wie gerufen, war sie doch in diesem Moment für die Mutter eine grosse Hilfe.
Ich kam nun in den Kindergarten. Die meisten Kinder waren bereits ein bis zwei Jahre dort, ich jedoch war neu in der Gruppe. Der Kindergarten wurde von Schwester Maria Leo, einer katholischen Nonne, geführt. Sie galt als eine sehr erfahrene Kindergärtnerin. Mehrere Generationen verschiedener Konfession besuchten bei ihr den Kindergarten. Sie konnte sich später noch an alle mit ihrem Namen erinnern. Der Kindergarten war im alten Casino untergebracht – einem ehrwürdigen Gebäude, welches früher einer ortsansässigen Aristokratenfamilie als Winterquartier diente.
Neben dem einfach gehaltenen Kindergartenraum lagen zwei barocke Ballsäle, wo gelegentlich noch gesellschaftliche Anlässe abgehalten wurden. Diese Räume waren für uns tabu. Schwester Maria Leo beheimatete in dem einen Raum den Sankt Nikolaus und im andern das Christkind. So standen wir das ganze Jahr unter himmlischer Beobachtung. Immer wieder hörten wir Flügel rascheln und wetteiferten untereinander, wer wohl schnell einen Blick auf das vorbeihuschende Christkind erhaschen oder die tiefe Stimme von Sankt Nikolaus vernehmen konnte. Während des ganzen Jahres waren wir bemüht, uns viele goldene Einträge und möglichst wenige schwarze Striche in Nikolaus’ grossem Buch zu verschaffen.
Im Advent dann kamen die hehren Gestalten leibhaftig – Sankt Nikolaus, begleitet von einem Tross von Engeln – bei uns zu Besuch, und dann wurde abgerechnet. Sankt Nikolaus mit seinem weissen langen Bart war zwar ein milder Mann, der uns glaubwürdig mit feuchten Augen vorspielen konnte, wie traurig ihn unsere Missetaten stimmten. Er war ein alter Freund meines Grossvaters, wie ich später erfuhr, und er war Sankt Nikolaus aus «Berufung». «Rutscht mir doch alle den Buckel runter», soll er seinen Kollegen einmal zugerufen haben, als sie ihn ärgerten, «in zwei Monaten bin ich wieder der Sankt Nikolaus und der glücklichste Mensch!»
Die Rückkehr
Sanatorium
Der Brief vom Kinderspital mit der Überweisung in die Kinderheilstätte stammt vom 1. Juni 1953. Am 19. Juni wurde unsere kleine Schwester geboren. Einige Tage später, am 27. Juni, war der Eintrittstermin für unseren Bruder ins Sanatorium. Wie haben die Eltern das alles nur geschafft? Ich vermute, dass wieder die Verwandtschaft da war und half.
Die Kinderheilstätte trug den sinnigen Namen «Heimeli». Wenn ich die Fotos von damals anschaue, sehe ich unsern kleinen Bruder in einer Blumenwiese sitzen, umringt von anderen Buben und Mädchen. «Unsere Kinder reden noch immer von ihm», schrieb Schwester Alice später. Ich habe sie nie kennengelernt, da auch hier nur unsere älteste Schwester zu Besuch durfte. Schwester Alice muss damals eine wichtige Bezugsperson für unsern Bruder gewesen sein. Auch später erkundigte sie sich immer wieder nach seinem Wohlbefinden und wie er sich zu Hause wieder eingelebt habe!
Der Bruder hatte während seiner Krankheit das Sprechen verlernt und musste wieder neu gehen lernen. Die ärztlichen Berichte aus der Heilstätte, welche alle drei Monate zu Hause eintrafen, wurden von uns voll Spannung erwartet und die Bemühungen um den kleinen Sohn vom Vater herzlichst verdankt, erfreut über seine guten Fortschritte und in der Hoffnung, dass er bald gesund und munter in die Familie zurückkehren könne.
Sept. 53
Die allgemeine Erholung ist ordentlich. Der Knabe ist ziemlich lebhaft und gut gelaunt. Eine Fortsetzung der Kur für weitere 3 Mt. ist unbedingt angezeigt.
Dez. 53
Die «geistige» Entwicklung ist befriedigend, er beginnt zu sprechen, allerdings noch undeutlich. Aufgrund des Röntgenbefundes und mit Rücksicht auf die durchgemachte Meningitis und die Jahreszeit ist die Fortsetzung der Kur unbedingt angezeigt. Wir haben um eine Kurbewilligung von weiteren 3 Monaten ersucht.
März 54
Der linke Hilus (Lunge) ist noch deutlich verbreitert, partienweise etwas dicht. In seinen «geistigen» Funktionen macht der Knabe befriedigende Fortschritte. Eine weitere Fortsetzung der Kur ist unbedingt angezeigt. Wir ersuchen um Kurbewilligung für weitere 3 Mt. …
Schlussendlich war der Bruder ein ganzes Jahr in der Heilstätte. Mit zweieinhalb Jahren wurde er krank. Mit viereinhalb Jahren kehrte er «körperlich geheilt zurück, dank neuzeitlichen Heilmitteln», wie es im Austrittsbericht heisst.
Ein anderer Bruder
Inzwischen war ich in der ersten Klasse. Ich lernte Lesen und Schreiben und entwickelte eine rege Schreibtätigkeit. Was ich früher zeichnend verarbeitete, tat ich nun schreibend. Ich verlangte bei der Lehrerin nach Papier und blieb freiwillig länger in der Schule, um meine kleinen Aufsätze zu schreiben. Die Lehrerin nannte mich «Blättlischluckerin». Sie korrigierte jeweils meine Texte und strich die Fehler mit roter Tinte an. Als nun fast das ganze Blatt rot angestrichen war, befand sie, ich würde besser etwas abschreiben, als eigene Geschichten voller Fehler zu schreiben. So wurde meiner Schreib- und Fabulierlust ein Ende gesetzt.
Ich war nun bald anderweitig beschäftigt, denn als ich eines Tages von der Schule heimkam, hatte die Mutter Matratze, Decken und Kissen zum Sonnen über die Teppichstange gehängt.
«Wir können am Sonntag den Bruder abholen.»
Die Sonne beschien das Bettzeug, als wollte sie meinem Bruder als Vorschuss etwas Wärme bringen.
«Kommt er nun für immer nach Hause?»
Wir beiden konnten damals nicht ahnen, wie oft der Bruder noch von zu Hause fortgehen musste.
Beim Austrittsgespräch sagte der Arzt meinen Eltern, ihr Sohn würde sehr viel Liebe benötigen. «Wohl wird es kaum einen Studierten aus ihm geben, aber es müssen ja nicht alle studieren.» Das war alles, was meinen Eltern als Aufklärung über die durch die Krankheit hinterlassenen Schäden ihres Sohnes mit auf den Weg gegeben wurde. «Mach’ dass er brav studiert. Belohn damit sein Streben, dass einst berühmt er wird», dieser Geburtswunsch aus der Feder des Wiener Künstlers musste somit schon früh begraben werden.
Ich war voller Freude, dass der Bruder nun wieder bei uns war und ich einen Spielgefährten hatte. Das Schwesterchen war einfach noch zu klein für meine Spiele.
Mein Bruder machte jedoch wenig her als Spielpartner:
Ich hatte die Kiste mit den Bauklötzen auf den Boden geleert und wollte mit meinem Bruder zusammen etwas bauen. Er war jedoch nicht am Bauen interessiert, sondern nahm zwei Holzklötze und schlug sie einfach nur gegeneinander. Er wusste wohl nichts Besseres damit anzufangen. Ich nahm ihm die Klötzchen aus der Hand und wollte ihm zeigen, was man alles damit machen konnte. Sogleich fiel er über mich her. Seine Finger griffen nach meinen Haaren und zerrten so fest, dass ich zu weinen begann. Mama eilte herbei, um mich zu befreien. Das war nicht einfach, denn seine Finger waren so fest in meine Haare verkrallt! Voll Entsetzten sah ich, wie er ganze Haarbüschel in seinen Händen hielt, meine Haare! Ich konnte nicht verstehen, warum er denn so böse wurde. Ich wollte ihm ja nur helfen.
Solche Anfälle traten immer wieder auf. Oft wusste ich kaum, wie ich mich nachts hinlegen sollte, da mich der Kopf so schmerzte, wenn der Bruder sich wieder an meinen Haaren vergriffen hatte.
Auch das kleine Schwesterchen bekam seinen Teil ab. Für den Bruder gehörte es nicht in diese Familie. Er hatte es ja vorher noch nie gesehen. Als er nach Hause zurückkam, hatte die kleine Schwester gerade Gehen gelernt und war noch unsicher auf den Beinen. Immer wieder stupste er sie um, wenn sie in seine Nähe kam. Glücklicherweise hatte sie damals noch fast keine Haare, und so konnte er sie nicht an den Haaren reissen. Später, als ihre Haare gewachsen waren, fielen auch ihre goldblonden Locken den Wutanfällen des Bruders zum Opfer.
Ich hatte mich mächtig auf meinen Bruder gefreut, so wie ich ihn in Erinnerung hatte, bevor er krank wurde. Doch dieser Bruder hier war ein Anderer. Er war unberechenbar in seinen Reaktionen. Er konnte lieb und fröhlich sein, doch urplötzlich begann er zu toben oder über uns herzufallen. Oft war es schwer nachvollziehbar, was ihn derart in Rage versetzte.
Einmal war der Bruder wieder krank. Er war unruhig und weinte die ganze Nacht. Ich musste mit ihm das Zimmer teilen und hatte deswegen kaum ein Auge zugetan. Am andern Tag in der Schule war ich sehr müde. Die Augen wollten mir zufallen. Bereits mehrmals wurde ich von der Lehrerin ermahnt, ich sollte mich anständig hinsetzen und nicht so in der Bank herumhängen. Nun verlor sie die Geduld. Ich musste mich zur Strafe in die Ecke stellen. In diesem Moment trat der Schulinspektor ein. Wie schämte ich mich, hier in der Ecke zu stehen. Wie ungerecht fand ich die Strafe, doch ich konnte nicht erzählen, warum ich so müde war.
Warum denn eigentlich nicht? Die Lehrerin kannte unsere Familie gut. Sie war auch schon bei uns zu Hause, weil meine älteste Schwester bei ihr im Sommerlager war. Warum war denn mein behinderter Bruder nie ein Thema? Heute frage ich mich, warum ich mich nicht erklären konnte, wenn mein Bruder mir das Zeichnungsblatt zerriss oder wenn durch seine Schuld Tintenkleckse mein Heft verunstalteten? Ich kassierte Schelte und musste mich damit abfinden, dass ich einen besonderen Bruder hatte, dass unsere Familie anders war. Deswegen schämte ich mich auch immer wieder.
Erst viel später erfuhr ich, dass einer meiner Mitschüler einen schwerstbehinderten Bruder hatte. Der Mitschüler stammte aus einer alteingesessenen Arztfamilie. Es hätte mir sehr geholfen, wenn ich von diesem Bruder gewusst hätte.
Kur auf der Alp
Es war Spätherbst, und diesmal war ich es, die stark hustete. Die Grosse Tante starb. Ich durfte wegen meines Hustens nicht einmal an ihre Beerdigung gehen. Ich versuchte, den Husten zu unterdrücken und weinte nachts leise in das Kissen. Eigentlich war ich ja nicht besonders gerne bei dieser Grosstante gewesen. Doch meine Mutter sagte mir damals, dass ich es später bereuen würde, wenn ich nicht mehr zu ihr gehen könne. Ich konnte mir das nicht vorstellen, doch nun war ich traurig und mein Gesicht von Tränen nass.
Der Husten wurde stärker und ich musste um Luft ringen. Der Kinderarzt diagnostizierte nun bei mir ebenfalls «Keuchhusten». Wenn ich damals verschont blieb, als unser Bruder daran erkrankte, so hatte es mich diesmal wie aus heiterem Himmel erwischt. Ich weiss nicht, wo ich mich angesteckt hatte. Meine Mutter meinte, es sei im Gedränge der Herbstmesse geschehen. Ich hustete die Nächte durch und durfte nicht zur Schule gehen wegen der Ansteckungsgefahr für die anderen Kinder. Da beschloss die Mutter, mich auch zur Kur auf die Alp zu Sophie und Gusti zu schicken, wie damals den Bruder. Offenbar hatte sie immer noch Vertrauen in die heilende Höhenluft, obwohl dort oben diese heimtückische Krankheit bei meinem Bruder ausbrach.
Es gab aber noch einen ganz praktischen Grund, mich nach Grattigen zu schicken. Der Bruder war bereits dort. Wegen seiner durchgemachten Lungentuberkulose verordnete ihm der Arzt immer wieder Kuraufenthalte. Ich sollte ihm nun auf der Alp Gesellschaft leisten und dabei auch als Kindermädchen die Sophie entlasten.
Es war ein nebliger Novembermorgen und noch stockdunkel, als meine Mutter sich mit mir auf die Reise machte. Nach einer längeren Zugfahrt warteten wir an einem Bahnhof auf das Postauto. Ein kalter Wind pfiff uns um die Ohren. «Hier bin ich geboren», sagte Mama. Ich schaute mich ungläubig um. Es gab kein Gebäude in der Umgebung, welches wie ein Spital aussah, und ich wusste inzwischen, wo die Kinder zur Welt kamen. Doch Mama erzählte mir, dass ihr Vater hier früher einmal Stationsvorstand war. Die Familie logierte deshalb in der Dienstwohnung im Bahnhof, und damals waren Hausgeburten üblich. Von da an prahlte ich vor den anderen Kindern damit, dass meine Mutter in einem Bahnhof geboren wurde. Ich erntete immer ungläubiges Staunen.
Nun fuhren wir mit dem Postauto hinauf ins Bergtal. Die Strasse war sehr eng und kurvenreich. Auf der einen Seite fiel sie steil ab, man konnte unten den See sehen. Auf der anderen Seite erhoben sich hohe Felswände. Vor den Kurven liess der Fahrer jeweils das Posthorn erklingen, um die talwärts fahrenden Fahrzeuge zu warnen. Obwohl Mama diese Strecke schon lange kannte, spürte ich, wie sie immer wieder zusammenzuckte, wenn das Postauto um eine enge Kurve fuhr.