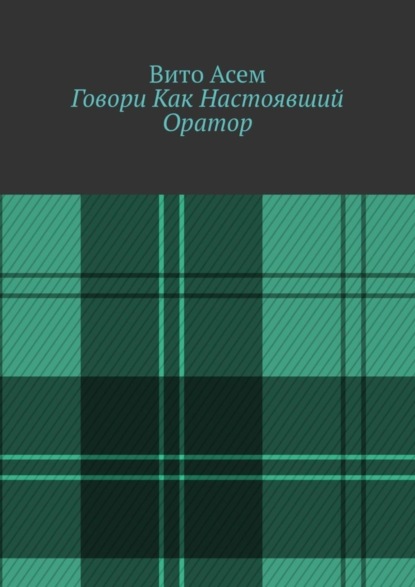Maritime E-Bibliothek: Sammelband Abenteuer und Segeln

- -
- 100%
- +
Nie wieder habe ich eine Krankengeschichte so gern geschrieben wie an diesem Weihnachtsabend 1954.
Über das Können von Medizinmännern etwas auszusagen, ist nicht leicht, da sie vorwiegend mit Suggestivmethoden arbeiten. Überraschend tüchtig waren im allgemeinen die „Knochenärzte“ (Bone doctors); ich habe nie einen Patienten gesehen, der nach einem Unfall von ihnen behandelt worden war und irgendwelche Deformierungen davongetragen hatte.
Afrikaner sind für ihre Heilung von einer Krankheit ebenso dankbar wie Europäer. Als ich einmal einen Häuptling von seinem Leistenbruch befreite, kam er anschließend zu meinem Bungalow und wollte mir seinen Sohn „schenken“. Es dauerte geraume Zeit, bis ich ihn davon überzeugen konnte, daß mich sein „Geschenk“ zwar außerordentlich ehrte, daß ich es aber nicht annehmen konnte, weil ich unmittelbar vor der Abfahrt nach Europa stand.
Das Verschenken von Kindern war zu meiner Zeit nicht ungewöhnlich; es bedeutete eine Ehre für den Beschenkten, aber auch eine Pflicht: man mußte für die Ausbildung des „Geschenkes“ sorgen.
Liberia – ein Land im Werden
Bis zum letzten Krieg haben die Liberianer in ihrer fast hundertjährigen Geschichte auf Grund der vielen Hindernisse, von denen ich sprach, nichts Positives geleistet, es sei denn, man rechnet es ihnen als Verdienst an, daß sie überhaupt überlebten und daß der Name ihres Landes erhalten blieb. Vielleicht wäre dieser Name trotzdem vergessen worden, wenn man ihn nicht dauernd auf den vielen bunten, immer neu auf den Markt geworfenen Briefmarken gelesen hätte, die in fast jedem Briefmarkenladen der Welt auslagen.
Während des Zweiten Weltkrieges strömten Scharen von Amerikanern ins Land, ein moderner Flugplatz wurde angelegt, eine Straße durch den Busch geschlagen. Nach der Wahl William Vacanarat Shadrach Tubmans zum achtzehnten Präsidenten nahm Liberia einen unglaublichen Aufschwung – auf alle Fälle in den Augen der Liberianer.
Die Amerikaner bauten den Hafen von Monrovia und begannen mit der Erschließung der Eisenerzlager. Heute exportiert eine amerikanische Erzfirma jährlich mehr als zwei Millionen Tonnen Eisenerz; im Norden des Landes haben Deutsche ein Riesenobjekt zur Erschließung eines größeren Eisenerzlagers in Angriff genommen, und eine schwedisch-amerikanische Firma will die Deutschen mit einem Projekt im Nimba-Gebiet übertreffen. Italienische Firmen bauen Straßen und Häuser, Israeliten konstruieren Regierungsgebäude, eine große amerikanische Gesellschaft legt neue Gummibaumplantagen an – es geht endlich voran in Liberia!
Als ich vor wenigen Jahren in Liberia arbeitete, gab es in seiner Hauptstadt nicht einmal ein Taxi, heute scheint dort jedes zweite Auto eines zu sein. Die meistbefahrene Straße des Landes, die von Monrovia zur großen Firestone-Plantage führt, ist großzügiger angelegt als viele Hauptstraßen bei uns.
In Monrovia selbst ist eine ganze Reihe neuer Gebäude entstanden, darunter ein von einem deutschen Architekten gebautes Regierungsgebäude, das „Kapitol“, das einem weißgestrichenen Gasbehälter gleicht und so scheußlich aussieht, daß man es am liebsten auch zum Gasbehälter degradieren würde.
Liberia ist nur wenig größer als Island, seine Einwohnerzahl läßt sich nur reichlich ungenau schätzen: sie liegt zwischen einer und zwei Millionen. Monrovia selbst mag heute etwa 40.000 Einwohner haben. Die Beschaffung von Arbeitskräften ist für alle großen ausländischen Firmen das größte Problem, obschon die Regierung versucht, ihnen bei der Lösung zu helfen.
„Dr. Lindemann“ – mein Namensvetter
Nachdem ich bei Bekannten, die einen entzückenden Bungalow in Monrovias bester Gegend auf dem Kap Mesurado bewohnen, ein echt deutsches Weihnachtsfest mit Tannenbaum und Lichterglanz gefeiert hatte, lud mich der Chefarzt der Firestone-Spitäler, Dr. Karl Franz, zu sich ein, mein Freund aus der Zeit meiner Tätigkeit in Liberia. Karl hat schon im letzten Kriege in Liberia gearbeitet und berät heute den Präsidenten in allen Fragen, die das Gesundheitswesen und damit das Wohlergehen und die Leistungsfähigkeit des Landes betreffen.
Stolz zeigte er mir seine und meine frühere Wirkungsstätte, die sich erstaunlich verändert hatte: aus dem „afrikanischen“ Hospital war inzwischen ein riesiges, modernst eingerichtetes „amerikanisches“ Hospital geworden, das allen Ansprüchen gerecht wird und in Liberia nicht seinesgleichen hat. Auch sonst war bei der Firestone Rubber and Tire Company, der größten zusammenhängenden Gummiplantage der Welt, vieles anders geworden: die Gummibäume, die man 1926 und kurz danach gepflanzt hatte, waren inzwischen gefällt und durch neue ersetzt worden, die Straßen hatten sich modernisiert, die Eingeborenenhütten waren durch Häuser abgelöst – und die Gehälter der mehr als 25.000 Liberianer erhöht worden.
Die Firestone-Gesellschaft hat in Liberia schon immer als Schrittmacher gegolten; in ihren Anfangsjahren war sie dort der einzige Steuerzahler von Bedeutung, und noch zu meiner Zeit gab sie für die Gesundheitspflege ihrer Mitarbeiter mehr Gelder aus als die Regierung, deren Musikkapelle noch nach dem Ersten Weltkrieg mehr kostete als ihr Gesundheitsdienst für die gesamte liberianische Bevölkerung!
Überall stieß ich auf Bekannte, auf alte Mitarbeiter und Freunde. In der Küche suchte ich nach dem Koch, der damals sein Neugeborenes „Dr. Lindemann“ getauft hatte.
Die Namensgebung war in Liberia früher ein großes Problem gewesen. Eingeborenen-Namen wie Momo, Flomo oder Panagofe galten als rückständig und unmodern. So hießen denn die Arbeiter unserer Plantage bald Sunday, Monday usw., die ganze Woche hindurch, oder sie trugen stolz den Namen einer Zahl: „Forty-five“. Andere hatten phantasiereiche Namen wie „Poor No Friend“, oder sie nannten sich nach ihrem Arbeitgeber „Firestone“ und nach dem früheren Manager „Wilson“. Und so war der Koch auf die Idee gekommen, seinen Sohn nach mir zu benennen. Ob der Doktortitel als Vorname gelten sollte, weiß ich nicht. Jedenfalls beruhigte es mich zu erfahren, daß der Junge „Dr. Lindemann“ prächtig gedieh.
Eine Frau für eine Kuh
Auch einen meiner früheren Boys traf ich wieder. Er bat mich um eine kleine Beihilfe zum ratenweisen Ankauf einer Frau.
Frauen sind in Liberia je nach Alter, Aussehen und Erhaltungszustand preislich gestaffelt. Statt Geld werden auch Sachwerte in Zahlung genommen. Je reicher der Freier, desto mehr Bräute kann er sich leisten.
Der Frauenkauf ist eines der natürlichsten Dinge in Westafrika. Man kann die Damen überall erwerben: in Städten, Dörfern und im Urwald. Allerdings sprechen die Eltern das entscheidende Wort und nicht die Tochter. Meist erhält der die „Ware“, der am meisten bietet. Daher haben Häuptlinge im Hinterland einen ganzen Harem. Von einem weiß ich, daß er über hundert Frauen besaß.
Die zum Kauf nötige Summe nennt man dowry, Mitgift. Es ist also der Mann, der eine Mitgift besitzen muß. Manche Afrikaner sparen jahrelang, um die durchschnittliche Mitgift von etwa 40 Dollar – das entspricht ungefähr dem Preis einer Kuh – zusammenzubekommen.
Die Christen unter den Afrikanern, die vorwiegend in den Küstengegenden wohnen, besitzen zwar nur eine Frau, haben aber häufig noch Freundinnen, mit denen sie Kinder haben. Ein Senator pflegte seinen Freundinnen einen Zettel zu schreiben, den sie mir wortlos gaben: „Doktor, das ist meine Freundin, behandeln Sie sie recht sorgfältig“! Niemand stört sich daran, der Senator ging eifrig in die Kirche und verstand es, seine Unterhaltung mit den treffendsten Bibelsprüchen zu würzen.
Moral wird in Westafrika mit anderen Maßstäben gemessen als in unseren Breiten. Während bei manchen Stämmen im Hinterland Ehebruch mit mittelalterlich anmutenden Foltern bestraft wird und die Mädchen in streng abgeschlossenen Urwaldschulen auf ihre spätere Aufgabe als Frau und Mutter vorbereitet werden, legt man in Küstenstädten auf Tugenden wie Keuschheit und Jungfräulichkeit keinen besonderen Wert. Kindern, die außerhalb des Ehebettes gezeugt werden, haftet kein Makel an. Prostitution ist kein anrüchiges Gewerbe; sie erweckt auch längst keinen so häßlichen und ausschließlich merkantilen Eindruck wie in Europa. Vielleicht liegt das am heißen, fruchtbaren Klima, der üppigen Pflanzenwelt, in der die natürlichen Triebe besser gedeihen als im Norden. Es gibt Ministerfrauen, die sich vor ihrer Heirat dem gewerblichen Minnedienst verschrieben hatten. Und es gibt sogar Schulmädchen, die mit ganz bestimmten Absichten im Krausköpfchen die Straßen flanieren.
Während meines früheren Aufenthaltes in Liberia kam einmal ein älterer Häuptling, Panagoga, jammernd zu mir gelaufen und beklagte sich, daß er den Freuden der Liebe in letzter Zeit entsagen müsse – seine Frauen hätten sich darob beschwert. Wie viele er denn habe? „Ungefähr zwanzig“ war seine entschuldigende Antwort, und die meisten davon seien jung, zu jung, um die Nächte allein zu verbringen.
Ich verschrieb ihm eine mehrmonatige Kur, an deren Ende er mir eine Buschschildkröte schenkte. Obschon ich mich als Tierliebhaber sehr darüber freute, war ich doch etwas beunruhigt: Schildkröten sind bekanntlich Kaltblütler – sollte dieses Tier eine diskrete Anspielung auf den Erfolg meiner Behandlung sein?
Ich verlor ihn bald aus den Augen, und die Buschschildkröte wurde mir schon in der ersten Woche gestohlen – wahrscheinlich landete sie in der Suppe eines Liebhabers. Als ich aber jetzt wieder in Monrovia war, hörte ich von Pangoga, daß er inzwischen nochmals Vater geworden sei – mit rund achtzig Jahren!
Selbstverständlich können auch Europäer junge Afrikanerinnen kaufen und mit ihnen zusammenleben, und ebenso selbstverständlich können sie sich auch trauen lassen. Ehen zwischen Europäern und schwarzen Frauen sind seltener als zwischen Afrikanern und weißen Frauen, verlaufen aber meist glücklicher, da die Europäer mit dem Lande vertraut waren und die Sitten der Schwarzen kannten, als sie heirateten. Weiße Frauen hingegen machen sich oft völlig falsche Vorstellungen von dem Leben, das sie an der Seite eines Afrikaners erwartet. Von vielen Afrikanern, die im Westen studiert haben, bröckelt die europäische Erziehung in der alten, vertrauten Umgebung wie schlechter Mörtel wieder ab.
Die Verzweiflung einer jungen Europäerin klingt mir noch in den Ohren. Sie war 18 Jahre alt, zart, blond und hübsch und wuchs als Tochter eines höheren Beamten in einer romantischen Universitätsstadt auf, als sie einen schwarzen Medizinstudenten kennenlernte und heiratete. Nach Beendigung seines Studiums ging der Afrikaner mit ihr nach Westafrika zurück. Und dann geschah es: mit einem Schlage rückte die Sippschaft an, Tanten und Basen, Vettern zweiten und dritten Grades, Verwandte, die nicht einmal blutsverwandt waren. Sie nisteten sich im neugegründeten Heim des jungen Ehepaares ein und wollten am Wohlstand und Wohlergehen der beiden teilhaben – nach afrikanischer Sitte. Durch nichts waren sie zu vertreiben. Die junge Frau hatte kaum noch Gelegenheit, mit ihrem Mann, der ihr unter dem Einfluß der Verwandten immer fremder wurde, allein zu sein. Selbst ins Schlafzimmer drang die Verwandtschaft zu Tages- und Nachtzeiten ein.
Während die junge Europäerin, die ihren Mann immer noch liebte, von Tag zu Tag blasser und elender wurde, ging der Ehemann erneut auf „Brautschau“ aus und besuchte schwarze Freundinnen. „Was soll ich tun?“ jammerte sie. Weil ich im tropischen Afrika gearbeitet und die schwarze Oberschicht ganz gut kennengelernt hatte, gab ich ihr den Rat, lieber heute als morgen nach Europa zurückzukehren. Leider nahm sie meinen Rat nicht an, sondern blieb in Afrika. Wenige Jahre später erfuhr ich, daß sie sich das Leben genommen hatte.
Rachsüchtige Büffel und schwarze Mambas
Auf der Plantage wurde indessen ein Sieg gefeiert: ein Pflanzer hatte einen Büffel geschossen, und das ist ein Ereignis, das alle paar Jahre nur einmal vorkommt. Sämtliche Angehörige seiner division, seines Plantagenbezirkes, standen bewundernd um das Tier herum und lobten den Mut des Jägers. Der Pflanzer erzählte, er habe es in seinem Bezirk gestellt. Ein Schuß ging vorbei, das Tier griff an, jedoch der Pflanzer hatte offensichtlich spanisches Blut in den Adern: er sprang geschickt zur Seite, und der Büffel erwischte nur sein Hemd, verwundete aber seinen Boy, der ihn begleitet hatte, am Hals. Der nächste Schuß war ein Blattschuß; der Büffel stürzte tödlich getroffen nieder. Er besaß ein dunkelbraunes Fell und war somit ein älteres Tier, denn junge Büffel sind meist rotbraun.
Erfahrene Großwildjäger behaupten, in ganz Afrika gäbe es für den Fachmann keine wirklich gefährlichen Tiere – die einzige Ausnahme sei der Büffel. Etwas Wahres ist daran: ich habe mehrfach Eingeborene behandelt, die von Büffeln angefallen und zum Teil ganz übel zugerichtet worden waren, aber Verletzungen durch Leoparden oder andere Tiere habe ich nie gesehen. Alle zwei Monate hatten wir auch einen Schlangenbiß zu behandeln, der fast immer geheilt werden konnte.
Büffel greifen erst dann an, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen oder wenn sie verwundet sind. Ein Berufsjäger wurde einmal von einem Büffel aus dem Hinterhalt angefallen, zu Boden geschleudert und zu Tode getrampelt. Er hatte das Tier fünf Tage zuvor angeschossen, es war geflüchtet, hatte einen großen Bogen geschlagen und in der Nähe der Schußstelle auf seinen Feind gewartet. Büffel fühlen instinktiv, daß sie sich an diesem Ort am sichersten verbergen können. Als dann der Jäger fünf Tage später wieder dort vorbeikam, fiel der Büffel so unerwartet über ihn her, daß er sich nicht mehr zur Wehr setzen konnte. Nahm das Tier Rache, oder fühlte es sich erneut bedroht?
Die Hottentotten führen manchmal eine Art Stierkampf auf, bevor sie einen Büffel töten; sie reizen ihn solange, bis er angreift, und sobald er schnaubend den mächtigen Kopf zum Stoß senkt, werfen sie ihm eine Decke über den Kopf, springen zur Seite und jagen ihm ihre Speere in den Leib.
Am nächsten Tag saß ich mit einem Freund, mit dem ich im Hospital zusammengearbeitet hatte, beim Cocktail, als sein Hausboy aufgeregt hineingestürzt kam: „Boss, a black Mamba!“ Wir hatten nichts gegen die schwarze Mamba, sie sicherlich auch nichts gegen uns, aber wir beschlossen trotzdem, ihr den Garaus zu machen. In den Jahren meines Afrikaaufenthaltes hatte ich mich zwar nie durch besonders große Jagdleidenschaft ausgezeichnet, doch Schlangen und Skorpione hatte ich gejagt, wo ich nur konnte, das gehörte sozusagen zu meinem Beruf – als Vorbeugungsmaßnahme.
Ich hatte Glück – beim ersten Steinwurf schon starb die mittelgroße, 1,50 Meter lange Giftschlange.
Es ist keine große Kunst, im Freien eine Schlange zu erledigen, jedoch in engen Räumen oder unterm Haus – in den Tropen sind die Bungalows meist auf Pfeilern erbaut – muß man sich immer einen Rückzugsweg freihalten. Schwarze Mambas können sehr gefährlich sein. Ohm Krüger berichtet von einer, die sich im Burenfeldzug wütend auf eine Patrouille stürzte und drei Männern und zwei Hunden tödliche Bisse versetzte.
Die Yancys und der Sklavenhandel
In einigen westafrikanischen Ländern wuchert die Korruption wie Unkraut. Die Verwechslung von mein und dein ist in manchen Gegenden ein wahrer Nationalsport. Das galt einst auch für Liberia.
Viel Sympathie verlor das Land 1931, als eine internationale Kommission feststellen mußte, daß dort noch immer mit Sklaven gehandelt wurde! Ausgerechnet die Nachkommen von freien Sklaven versklavten ihre Brüder aus dem Hinterland!
Die spanischen Pflanzer auf der Insel Fernando Poo suchten händeringend nach Arbeitskräften. Für jeden Afrikaner bezahlten sie 45 Dollar, darüber hinaus gab es noch Extravergütungen. Das war für den damaligen Vizepräsidenten von Liberia, Allen N. Yaney aus Maryland, dem südlichsten Teil des Landes, ein gutes Geschäft. Er rekrutierte die „Ware“ für die Spanier kostenlos aus dem Busch; konnten die Häuptlinge das „Soll“ nicht erfüllen, setzten Repressalien ein, erst Auspeitschung, dann „Pfändung“ der nächsten Angehörigen der Häuptlinge und schließlich Mord.
Selbst 1935 noch, nach dem Einspruch der internationalen Kommission, ging ein Sklaventransport von Grand Bassa nach Fernando Poo!
Inzwischen ist das alles vergessen. Präsident Tubman versucht wie keiner seiner Amtsvorgänger, die Bewohner des Hinterlandes mit zur Regierung heranzuziehen. Doch wie schwer es ist, unsere westliche Begriffe auf Afrika zu übertragen, zeigt die Fortsetzung der Yancy-Geschichte. Einer der Söhne des ehemaligen Vizepräsidenten, ein Major Yaney, höchster Polizeibeamter im Bezirk Maryland, hatte sich von ein paar Gummizapfern der dortigen Firestone-Zweigstelle längere Zeit hindurch viele Eimer voll Latex an einen verabredeten Ort bringen lassen. Er holte sie später mit seinem Auto ab und verkaufte sie als eigenes Erzeugnis an die – Firestone-Gesellschaft. Natürlich kam der Schwindel bald heraus, die Anwälte von Firestone, meist Liberianer, erhoben Anklage. Es wäre ein Prozeß mit sonnenklarem Ausgang geworden. Doch was geschah? Nichts! Das Urteil fiel unter den Tisch. Und heute ist Yancy – Rechtsberater bei Firestone!
Will man seine Widersacher unschädlich machen, spannt man sie am besten in die eigene Sache ein. Zusätzlich ist Yancy noch immer Major der dortigen Polizeikräfte, besitzt wie alle Americo-Liberianer eine Farm, hat sein eigenes Rechtsanwaltsbüro, ist verantwortlich für den Verkehr im Süden des Landes und leitet ein eigenes Fuhrunternehmen.
Besuch beim Präsidenten
Natürlich stand auch diesmal auf meinem Programm ein Besuch bei Präsident Tubman, den ich von früher her gut kenne. Da ich ihn das letzte Mal wegen der großen Hitze in Hemdsärmeln besucht hatte – das Recht eines Fahrensmannes für mich beanspruchend –, trug ich diesmal meinen besten Anzug –, und er erschien im Schlafrock. Aber nächstes Mal wollen wir beide vorschriftsmäßig gekleidet sein!
Liberia verdankt seinen Aufschwung zum größten Teil der Aufgeschlossenheit seines Präsidenten. Tubman stammt von Americo-Liberianern aus Kap Palmas ab, jedoch ist der Unterschied zwischen dieser Gruppe und den Eingeborenen weniger groß als bei uns oft geglaubt wird. Er wurde liberisch erzogen, und das ist so oder so bescheiden. Aber Tubman ist von Natur aus intelligent, witzig, großzügig, schlagfertig und hilfsbereit. Er hat selbst Weißen geholfen, die von ihren eigenen Landsleuten keine Unterstützung erhielten. Heute ist er mehrfacher Dollarmillionär, jedoch durch eigene – kaufmännische – Verdienste und nicht durch einen Griff in die Staatskasse. Noch heute unterschreibt er persönlich alle entscheidenden Geldausgaben seiner Regierung – denn er kennt seine Landsleute!
Tubman hielt damals nichts vom Panafrikanismus, wie Touré und Nkrumah ihn propagieren, weil er das Beispiel Europas vor Augen hat: Wenn die Europäer sich nicht einmal verständigen und einigen könnten, wie sollte man das von den Afrikanern erwarten, meinte er. Inzwischen scheint er allerdings seine Ansicht geändert zu haben.
Wie in anderen westafrikanischen Ländern gibt es in Liberia ein Einparteiensystem; die anderen Parteien werden nur dem Namen nach geduldet, zum Teil sogar öffentlich bekämpft und ihre Führer eingekerkert oder verbannt. Offensichtlich sind Entwicklungsländer – wie man heute die unterentwickelten Länder nennt – für demokratische Staatsgefüge wenig geeignet, hinzu kommt, daß die große Mehrzahl der Bevölkerung beim Wählen gar nicht erfaßt werden kann.
Bei Landsleuten im Urwald
Liberia hat besonders enge und freundschaftliche Verbindungen mit Hamburg. Man trifft dort mehr Hamburger als in den meisten anderen westafrikanischen Ländern.
Schon wenige Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung Liberias sandte der Hamburger Carl Wörmann den Dreimastschoner „Liberia“ nach Westafrika und errichtete in Liberia 1854 die erste Faktorei südlich der Sahara. Weitere Hamburger Reedereien gründeten dort Niederlassungen und sind zum Teil – wenigstens dem Namen nach – noch heute dort vertreten.
Gerade diese Kaufleute haben sehr viel für das gute Ansehen, das die Deutschen in Liberia genießen, getan. Leider wurde das gute Verhältnis zwischen ihnen und den Liberianern verschiedentlich durch taktlose Reisende gestört.
Auch die Ketsch, die im Hafen von Monrovia neben mir lag, gehörte einem Hamburger, einem ehemaligen Kapitän, der in Monrovia ohne einen Pfennig Geld in der Tasche angekommen war und sich dort seine ersten Cents verdient hatte, indem er auf Fischfang auszog. Das war anfangs kein schlechtes Geschäft, jedoch als sich einige italienische Fischereigesellschaften in Westafrika niederließen, deren Methoden weitaus rationeller waren, ging es weniger gut, und so mußte auch die Frau des Hamburgers die täglichen Brötchen mitverchenen helfen. Sie tat also das, was in Westafrika in der Regel den einheimischen Frauen vorbehalten ist: sie wurde Hökerin und „machte“ mit allem möglichen Kleinkram „Markt“. Anfangs in einer winzigen Hütte, jetzt bereits in einem annehmbaren Laden.
Zwischen Hafen und Stadt Monrovia liegt die Mündung eines kleinen Flusses, an dessen Ufer ich vor fünf Jahren einen Hamburger Tischler kennengelernt hatte, der – wie viele andere Handwerker auch – für die liberianische Regierung arbeitete. Beschattet von gewaltigen Mangobäumen grenzten sein Bungalow und seine große Werkstatt direkt an die Flußmündung. Als ich diesmal gleich nach meiner Ankunft in Monrovia zu ihm fuhr, wohnte er noch immer da; wie vor fünf Jahren war er beim Bau eines Bootes. Zehn Gleitboote hatte er in der Zwischenzeit schon selbst hergestellt, gefahren und wieder verkauft, dazu noch zwei Stufenboote. Motorbootfahren – weniger Segeln – und Jagen sind nun einmal die Hauptsportarten der Europäer in Westafrika.
Dieser Hamburger Bootsbauer war schon einmal in der Brandung vor Monrovias Küsten gekentert und hatte sich schwimmend an Land gerettet. Doch er baut weiter – Wasser und Meer stecken ihm im Blut.
In Monrovia hatte ich mich verschiedentlich nach der deutschen Gesellschaft erkundigt, die im Süden des Landes eine Konzession (240.000 ha) zur Errichtung einer Bananenplantage besitzt. Man konnte mir darüber keine nähere Auskunft geben. Schließlich lernte ich zufällig den Herrn kennen, der die Interessen der Firma in Monrovia vertritt. Aber er verwies mich nur an den Manager, den er von meiner Ankunft unterrichten wollte. So machte ich mich also auf den Weg.
Das Meer war wie immer in dieser Jahrezeit ruhig, so daß ich täglich nicht mehr als 80 – 90 Seemeilen schaffte. Der ganzen Küste sind Felsenriffe vorgelagert, die teils über, teils unter Wasser nur darauf lauern, sich einem nicht genau navigierenden Boot in den Leib rammen zu können.
Auf der Ozeanseite zieht sich der Dampfertrack parallel zur Küste hin, und zwischen beiden suchte sich die LIBERIA IV ihren Weg nach Südosten. Für mich hieß das, in der Nacht scharf zu wachen und am Tage hin und wieder ein Auge zuzudrücken.
An einem Sonntagmorgen traf ich in dem noch nicht ganz fertiggestellten Hafen von Sinoe ein. Da die Dünung längs der Mole hoch vorbeisauste, ankerte ich im Hafenbecken.
Deutsche Stimmen hallten zu mir herüber, man bot mir ein Ruderboot an, und schon stand ich mitten unter Deutschen. Einige Handwerker aus Hamburg waren damit beschäftigt, die Molenoberfläche einzuebnen, ein Lübecker Diplomlandwirt lud mich zum Frühstück in die Eßhalle ein, der ölpalmen und Mangobäume Schatten spenden.
Der Hafen von Sinoe liegt bei dem ein wenig ins Meer vorspringenden Blubarra Point auf der Südseite des Sinoe-Flusses, der für Brandungsboote leicht zu befahren ist. Auf der Nordseite des Flusses erstreckt sich ein müdes Städtchen von einigen tausend Einwohnern, deren Neugierde die Deutschen auf der Südseite wenig anficht.
Der Lübecker machte mich sofort mit dem „Kapitän“ der Plantagenboote bekannt, der uns durch Sekundär- und Regenwald 24 km flußaufwärts zum Landeplatz der Gesellschaft brachte. Vorläufig konnte man nur mit einem Boot dorthin gelangen; eine Straße sollte demnächst fertiggestellt werden.