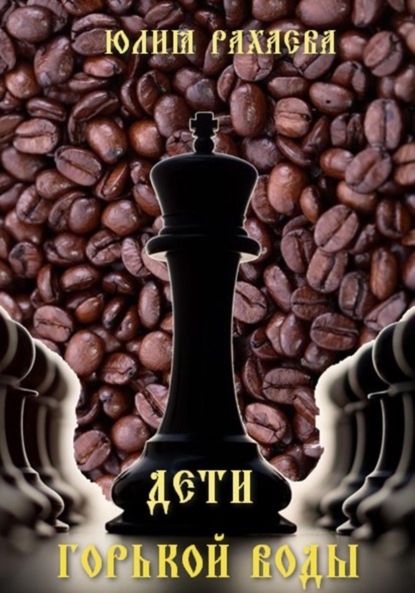Maritime E-Bibliothek: Sammelband Abenteuer und Segeln

- -
- 100%
- +
In Las Palmas traf ich Puchert 1956 auf einer Gesellschaft wieder. Er erschien in Begleitung seiner damals fünfzehnjährigen Tochter Marina, die aus einem Londoner Internat herübergekommen war und ihre Ferien bei ihrem Vater verbrachte. Sie schien intelligenter und vernünftiger zu sein als er und mußte mehrmals vermittelnd eingreifen, wenn er Streit vom Zaun zu brechen versuchte. Puchert tat so, als ob es keinen ehrsameren Beruf als den eines Schmugglers gäbe und wurde böse, als ich diese Ansicht nicht unbedingt teilen wollte. Meinen Plan, den Atlantik in einem Faltboot zu überqueren, hielt er für völlig undurchführbar und wettete um eine Kiste Sekt, daß ich nie ankommen würde.
Die Kiste Sekt habe ich zwar gewonnen, doch nie bekommen. Denn Pucherts gefährliches Spiel, das er allen Warnungen zum Trotz nicht aufgeben wollte, fand bald ein gewaltsames Ende. In Frankfurt explodierte eine Haftladung, als er seinen Wagen anlaufen ließ …
Für die LIBERIA kam allmählich die Zeit der Abfahrt. Herr von Thun von der früheren Wörmann-Linie lud mich ein, auf seine Werft zu kommen, damit er den Ausbau und das Dichten meiner zerschlagenen Tanks überwachen könne. Da er früher selbst ein Boot gehabt, dazu noch vielen Seglern mit Rat und Tat beigestanden hatte, konnte ich mich voll und ganz auf ihn verlassen. Das Cockpit mußte ganz aufgerissen werden, damit man die großen Tanks herausholen und mit Quer- und Längsschotten versehen konnte.
Nach zwei Wochen – die Instandsetzung des Bootes hatte länger gedauert als vorausgesehen – nahm ich endlich Abschied von den Kanarischen Inseln, die der Mythos „Inseln der Glückseligen“ nennt. Wie weit hinter der klangvollen Bezeichnung der alte Menschheitstraum vom Paradies stand – wer vermag das zu sagen? Paradiesisch allein – das hatte ich wieder einmal festgestellt – ist nur noch das Klima.
Mein neues Ziel hieß Kap Bojador. An der Saharaküste wollte ich einen einsamen Leuchtturm besuchen, der vor kurzem von marokkanischen Banditen überfallen worden war. In Las Palmas riet man mir dringend davon ab. Doch mein Entschluß war gefaßt.
1 Eine sehr umstrittene und auch kaum zu beweisende Theorie. Heute vermutet man in den Inseln Landreste von Amerika, die zurückblieben, als die einst zusammenhängenden Landmassen Afrikas und Amerikas sich trennten. Amerika trieb westwärts und geriet im Stillen Ozean auf Grund.
2 Ohne Segel rechtwinklig zum Wind.
3 Mastkorb, Ausguck am Mast.
4 Anderthalbmaster, mit dem kleineren Mast hinten, aber vor dem Ruder.
DRITTES KAPITEL
AUFRUHR IN DER SAHARA
Ich nahm direkten Kurs auf die Spanische Sahara. Nachdem die LIBERIA IV die ruhigen Gewässer des Hafens verlassen hatte, dümpelte sie bei flauen Winden in der hohen Atlantikdünung von einer Seite auf die andere. Wer das schön findet, muß seltsam veranlagt sein. Alle Eingeweide – nicht nur die des Bootes – werden so erbarmungslos durcheinander geschüttelt, daß selbst die härtesten Seeleute ein leises Unbehagen in der Magengegend verspüren.
Der Hafen verschwand in einer Regenboe, als ich heimkehrenden Fischern zuwinkte. Obwohl sie beide Hände voll zu tun hatten, grüßten sie freundlich wieder. Nach einem alten Seemannsglauben bedeutet das für ausgehende Boote Glück und gute Fahrt. Ich brauchte beides. Denn die Küstenfahrt von über 4000 Seemeilen, die mir bevorstand, erforderte mehr als gutes seemännisches Können und starke Nerven.
Nachmittags besuchten mich mehrere erschöpfte Landvögel, die anscheinend ihre Kräfte überschätzt hatten: Rotschwänzchen, Schwalben und ein graugrüner Kanarienvogel, dem gar nicht nach Singen zumute war. Eine Rauchschwalbe übernachtete sogar in meinem Boot; sie war stracks in die Kajüte geflogen und hatte sich auf das Radio gesetzt. Ich brachte sie in die Vorderkajüte, wo ein paar Gnitzen meine Obst- und Gemüsevorräte umschwirrten; hier konnte sie sich als lebender Fliegenfänger die Passage nach der Sahara verdienen.
Am nächsten Tage kamen – vollkommen ermattet – wieder mehrere Vögel an Bord; auch sah ich im Meer unzählige Heuschrecken, Falter und Schmetterlinge flooten, die wohl von der Sahara und der Insel Fuerteventura herübergetrieben worden waren.
Überfall auf einen Leuchtturm
Mein Ziel war der Leuchtturm von Kap Bojador. Aber was wollte ich in dieser öden, verlassenen und trostlosen Gegend?
Als ich 1954 in Liberia als Plantagenarzt gearbeitet hatte, ließ ich mir aus Hamburg Seekarten von der Westküste Afrikas schicken. Auf einer dieser Karten stand – mit Bleistift nachgetragen – zu lesen, daß am Kap Bojador ein „Feuerträger“ im Bau sei. 1955 dann passierte ich mit meinem Einbaum unfreiwillig diesen Feuerträger, der damals bereits ein stattlicher Leuchtturm war. Ob man ihn auch in Betrieb genommen hatte, vermochte ich nicht zu sagen, denn ich segelte am hellen Tage an ihm vorbei. Menschliche Spuren konnte ich nicht entdecken. Später in Deutschland fiel mir eine Zeitungsnotiz in die Hände:
4. Dez. 57 Leuchtturm überfallen
Madrid. Marokkanische Freischärler haben den Leuchtturm auf Kap Bojador, 50 km südwestlich der spanischen Besitzung Sidi Ifni, überfallen. Die beiden Leuchtturmwärter und ihre Familienangehörigen sind spurlos verschwunden. Im Innern des ausgeplünderten Gebäudes wurden Blutspuren gefunden.“ Marokkanische Freischärler waren es sicher nicht, die den Überfall auf dem Kerbholz hatten, sondern wohl gewöhnliche Banditen. Ich kenne Marokko gut. Als ich 1952 in Französisch-Marokko, das damals noch nicht frei war, Araber behandelte, lernte ich nur gemeine, hinterlistige und rücksichtslose Überfälle auf unbewaffnete Freunde verschiedener Nationalität kennen. Heute mag die marokkanische Regierung Herr der Lage sein, wer jedoch will den Nomaden der Sahara gebieten?
Hier leben uralte, nie ganz eingedämmte Traditionen wieder auf! Die Erinnerung an den Namen „Barbareskenküste“ wird wach, an Sklaven, Überfälle, Erpressung und kalt berechneten Mord. Wenn die Friedfertigsten aller Friedfertigen, die Leuchtturmwärter, überfallen werden, dann ist das gemeinste und abscheulichste Barbarei.
In Las Palmas erinnerten sich noch ältere Fischer der Zeiten um 1930, da sie beim Fischen von der Saharaküste aus beschossen wurden. Wie wenig sich an der Lebensweise der Araber jener Gegenden geändert hat, zeigt die Geschichte des Monsieur Saugnier, der mit seinem Schiff „Deux Amis“ dort strandete. Er fiel in die Hände der Nomaden, die ihn als Sklaven mehrfach weiterverkauften, bis ihn schließlich der Sultan von Marokko erwarb und über Tanger nach Europa zurücksandte. Saugnier schrieb über die Nomaden: „Diese Leute sind hundearm, besitzen nichts und leben nur von dem, was sie finden oder stehlen können. Da der Boden sie nicht ernähren kann, greifen sie nach allem, was besser als eine Laus aussieht.“
Während meines früheren Aufenthaltes in der Sahara hatte mir ein alter Scheich beim Tee verraten, daß in seinem Dialekt die Begriffe „frei sein“ und „stehlen“ durch das gleiche Wort wiedergegeben werden …
Wo das Dunkelmeer beginnt
Kap Bojador wurde jahrhundertelang für das Ende der Welt gehalten. Da es mit einer gefährlichen Sandbank ins Meer hinausragt, da die Strömung wie an jedem vorspringenden Punkt auch hier besonders stark läuft und die Küste kaum eine Landemöglichkeit bietet, glaubten früher die Seeleute, man könne das Kap nicht umsegeln. Außerdem hatten die Phönizier in ihrem Bestreben, auf den Kanarischen Inseln eine ungebetene Handelskonkurrenz auszuschalten, absichtlich das Gerücht verbreitet, jenseits des Kaps beginne das „Dunkelmeer“, alle Weißen würden dort schwarz und ihre Schiffe gingen in Flammen auf oder stürzten in einen tiefen Abgrund.
Was sollte man auch von der trostlosen, häufig von dichten Nebeln verschleierten Wüstenküste erwarten? Da gab es nichts zu holen, nichts zu plündern, keine Sklaven zu fangen und kein Gold zu entdecken. Man kann verstehen, warum sich die Umschiffung des Kaps solange hinzog.
Heinrich dem Seefahrer, dem Begründer des Zeitalters der Entdeckungen, einem düsteren, einsamen und unverstandenen portugiesischen Prinzen, gebührt die Ehre, die Erforschung Westafrikas vorangetrieben zu haben. Seine systematischen Forschungen bildeten Grundlage und Voraussetzung für alle Entdeckungen, sei es der Seeweg nach Indien oder die Wiederentdeckung Amerikas.
Nachdem seine Kapitäne ihm zehn Jahre lang gemeldet hatten, Kap Bojador sei nicht zu umsegeln, muß schließlich seine Geduld erschöpft gewesen sein; er befahl seinem Schildknappen Gil Eannes, das Kap zu „nehmen“, koste es, was es wolle. Etwa 1433 führte Eannes den Befehl aus; seine Leistung wurde als „Herkulestat“ gepriesen. Nach ihr folgten sich die Entdeckungen, eine der anderen: Kap Blanc, Kap Verde und endlich das Kap der Guten Hoffnung.
Von Las Palmas bis zum Kap Bojador sind es rund 140 Seemeilen. Ich hoffte, bei Einbruch der Dunkelheit dort Anker werfen zu können, aber die schwachen und zum Teil umlaufenden Winde verzögerten die Ankunft.
Landung in der Sahara
An dem vom Küstenhandbuch vorgeschlagenen Ankerplatz konnte ich zwar ankern, jedoch nicht an Land gehen. Deshalb ankerte ich weiter im Norden. Es war gerade sieben Uhr morgens. Die Sonne fingerte erst seit Sekunden mit ihren goldenen Strahlen über der Sahara. Ich wusch mich, schlug mein Faltboot auf und war um acht Uhr bereit, durch die Brandung zu paddeln. Die Brecher waren um keinen Pfennig schlechter als es das Handbuch vorausgesagt hatte. Hilfesuchend schaute ich nach dem Strand. Auf den Riffs konnte ich ein paar Gestalten ausmachen, die, als sie mich entdeckten, aufgeregt zu gestikulieren begannen und in eine Richtung wiesen, in der ich landen konnte.
Zwei, drei schwere Brecher wartete ich ab – ein tiefer Atemzug, und ich paddelte mit aller Kraft, bis mich eine Brandungswelle in sausender Schußfahrt ans Ufer warf. Zwei Leute griffen eilig nach dem Boot, – ich versuchte auszusteigen, jedoch der Sog riß mich zurück, – wie ein Kieselstein rollte ich wieder dem Meer zu. Salzwasser im Mund, Nase und Augen, schnappte ich nach Luft. Da hob mich eine neue Welle auf und warf mich wie ein Stück Treibgut zu meinem Boot und den Leuten. Das war mein Einzug in die Sahara.
Die drei Menschen am Ufer, die mich wie ein Wundertier anstarrten und dann vor Freude über den unerwarteten Besuch alle auf einmal zu reden und zu lachen begannen, waren spanische Soldaten, jeder nach seinem Geschmack gekleidet. Einer hatte – und das war das einzig Militärische an ihnen – ein Gewehr und ein Koppel mit einem Patronengurt um. Die zwei anderen trugen Säcke voll Miesmuscheln, die zu einer Paella, dem berühmten Reisgericht aus Valencia, verarbeitet werden sollten.
Wir brachten das Faltboot in Sicherheit und zogen zum Leuchtturm, der sich seltsam unwirklich in dieser skurrilen und beinahe mondhaften Landschaft aus Gestein, Sand und verdorrtem Gestrüpp ausnahm. Der Hund, den die drei Spanier mit sich führten, scheuchte zwei Kaninchen auf, im Gesträuch flatterten einige Vögel, die ich nicht bestimmen konnte, und schon waren auch die ersten hartnäckigen Saharafliegen da!
Über Kakteen, bauchhohe Sträucher, Gestein und Sand gelangten wir schließlich auf die Piste, die vom Turm zum Landeplatz für die großen Brandungsboote der Dampfer aus Las Palmas führt. Einmal im Monat geht ein Dampfer hier vor Anker und bringt der kleinen Garnison, die seit dem Überfall den Leuchtturm bewacht, Vorräte und Süßwasser. Zusätzlich liefert ein kleines Kurierflugzeug zweimal wöchentlich Post ab.
Bereitwillig gaben mir meine drei Begleiter Auskunft über alles, was ich wissen wollte. Die verschleppten Leuchtturmwärter sollten sich im Innern des Landes befinden, und das Internationale Rote Kreuz, hörte ich, bemühte sich schon, sie freizubekommen. Die maurischen Banditen, denen sie zum Opfer gefallen waren, nannten sich großzügig Exercito de la Liberación – wen oder was sie befreien wollten, wissen wohl nur sie selbst.
Wie in vielen Teilen der Sahara und besonders am Rande des Atlantiks, ist auch hier das Grundwasser salzhaltig; man benutzt es zum Waschen. Könnte man Wasser aus der Tiefe gewinnen – unter der Sahara verbergen sich gewaltige Wasseradern –, so wäre es möglich, in diesem Teil der Wüste ebenso fruchtbare Plantagen entstehen zu lassen, wie sie die Franzosen innerhalb von knappen vierzig Jahren in Marokko hervorgezaubert haben und wie sie vor viertausend Jahren noch an vielen Stellen der Sahara zu finden waren.
Im gesamten Umkreis des Leuchtturms war kein echtes Grün zu erkennen, lediglich rings um den Auslauf der Kloakengewässer wagte sich spärlich und vorsichtig ein wenig frisches Gras hervor. Dort schwirrte es auch von hungrigen und durstigen Schwalben, Spatzen, Bachstelzen und kleinen weißen Reihern.
Falsche Zähne aus dem Meer
Ein wenig Handel treibt man auch am Kap Bojador. Die Einheimischen, die man Mauren nennt, eine Mischung aus Berbern, Arabern, Semiten und Negern, sammeln bei Ebbe Algen, die, getrocknet und zu Bündeln gepreßt, nach Las Palmas verschifft werden.
Seetang wird an vielen Küsten der Welt geerntet, leider jedoch immer noch nicht in genügender Menge. Die Fabriken könnten ihn bei der Herstellung von unzähligen Produkten nutzbringend verwenden: Zahnpasta, falsche Zähne, Speiseeis, Würstchen, Puddingpulver, Schlankheitspillen und kosmetische Artikel. Aus Flugzeugen ließe sich flüssiger Seetang-Extrakt als Düngemittel absprühen, und der Erde könnten auf diese Weise Stoffe zurückgegeben werden, die der Regen ausgewaschen hat: Kalisalze, Stickstoff verbindungen, Phosphate und andere. Erst in jüngster Zeit haben Textilfabriken mit bestem Erfolg Alginsäure zum Appretieren und Imprägnieren von Geweben und Kleidungsstücken verwandt.
Daß ausgerechnet die Wüstenbewohner Meerestang ernten, überraschte mich. Sie tun es aber auch erst, nachdem sie von den Spaniern dazu angehalten wurden, diese ungeheuren Rohstoffreserven für den Menschen zu nützen. 71 v. H. der Erdoberfläche sind Wasser: welch ungenutzte Möglichkeiten! So wie vor der kalifornischen Küste schon Tangbarken und Tangmäher zur Ernte dieser riesigen Seetangwälder eingesetzt werden, so wird man über kurz oder lang auch systematisch die Tangwälder ausbeuten, die den Küsten anderer Länder vorgelagert sind.
Wichtiger noch als der Tang werden eines Tages die einzelligen Algen für die Ernährung der Menschheit sein. Eines der beinahe 20.000 Mitglieder zählenden Algenfamilie, die Chlorella, ist bereits in Laboratorien untersucht worden. Mit ihr hat man in der Kohlenstoffbiologischen Forschungsstation in Essen Versuche unternommen, bei denen man von der Vorstellung ausging, daß Algen zu den besten Sonnenverwertern gehören: fast zehnmal bessere als der allerbeste Sonnenverwerter unter unseren Kulturpflanzen, die Zuckerrübe.
Bei diesen Versuchen findet sogar der störende Rauch der vielen Fabrikschlote des Ruhrgebietes Verwendung: man leitet die Kohlensäure, die im Rauch enthalten ist, in Algenbecken, und die Süßwasseralgen bauen unter Lichteinwirkung aus Kohlensäure und Wasser Zucker und Stärke aus und können sich bei günstiger Temperatur, etwa bei plus 24 Grad Celsius, auf diese Weise einmal pro Tag vermehren. Das bedeutet, daß jeden Tag einmal geerntet werden kann, indem das Wasser zentrifugiert wird.
Das Sediment sieht wie feinste Spinatpaste aus und besteht aus Proteinen, Fetten, Stärke, Vitaminen und Spurenelementen. Man kann sich sogar aussuchen, was für Algen man erzeugen will, vorwiegend fetthaltige, stärke- oder eiweißhaltige. Die einzellige Chlorella hat kaum Abfallprodukte, da sie kein Stützgerüst wie andere Pflanzen besitzt – ein nicht zu unterschätzender Vorzug für die Nahrungsmittelfabriken.
Theoretisch ließen sich auf einem Hektar Wasseroberfläche jährlich 50 Tonnen Chlorella ernten, das ist 25 mal so viel wie der entsprechende Ertrag Weizen auf der gleichen Landfläche. Und dabei steht man erst am Beginn der Forschungen!
Aber zurück in die Wüste, zum Kap Bojador!
Von den Tangballen, die wie ein Haufen trockener Tabakblätter aussahen, schlenderten wir zum Leuchtturm, der von Stacheldrahtverhauen und Laufgräben umgeben ist, vor denen nachts die Schakale umherschleichen. Sobald wir im weiträumigen Hof des Turmes angekommen waren, klopfte man den Leutnant aus dem Bett. Er erschien im Schlafanzug und rieb sich verwundert ein paarmal die Augen, denn seit dem Bestehen des Leuchtturms war ich der erste Besucher. Freudestrahlend bot er mir eine Dusche an und lud mich zur Paella mit frischem Brot, Wein und Bier ein.
Auch die beiden Leuchtturmwärter waren inzwischen aufgestanden und baten mich flehentlich, doch ein paar Tage zu bleiben, sie kämen um vor Langeweile. Ich hätte es gern getan, jedoch die LIBERIA IV eine Nacht lang unbeaufsichtigt zu lassen, das kam mir nicht in den Sinn.
Beim Mittagessen saßen wir mit Mauren zusammen, und alle verhielten sich so, als hätte es nie Spannungen zwischen Spaniern und Mauren gegeben.
„Können Sie sich denn auf die Mauren verlassen?“ fragte ich später den Leutnant.
Er zuckte die Achseln: „Wir hoffen’s – seit dem Überfall auf diesen Turm haben wir hier nie wieder Ärger gehabt.“
„Und wann werden die entführten Leuchtturmwärter nach Ihrer Meinung wieder von den ‚Muros‘ entlassen?“
„Keine Ahnung! Das kann sich noch Jahre hinziehen!“
Ist ein Kamelhöcker ein Wassertank?
Einer der Mauren lud mich ein, seine Jaima, sein Zelt, zu besuchen. Der Leutnant fuhr mich in seinem Jeep über eine kaum erkennbare Piste und später querfeldein zu dem versteckt liegenden Zelt, in dem noch die letzten Spuren eines frisch geschlachteten Schafes zu sehen und zu riechen waren. Kleine Fleisthstücke dörrten, auf eine Schnur gereiht, in der Sonne. Der Maure zeigte mir mit berechtigtem Stolz seinen Besitz: vier verschleierte Frauen, eine Unmenge von schmutzigen Kindern, 50 Dromedare und ödes Land, soweit das Auge reichte. Zuweilen verkaufte er seine Dromedare als Braten auf die Kanarischen Inseln – zum Preise von rund 270 DM das Stück.
Kamele und Dromedare sind erst in historischer Zeit aus Kleinasien nach Afrika eingewandert, als die Pferde sich in der unfruchtbar gewordenen Sahara nicht mehr halten konnten. Diesen Tieren sagte man früher nach, sie könnten bis zu drei Wochen in der Wüste marschieren, ohne trinken zu müssen; man glaubte, sie besäßen einen Wassertank im Magen oder gar im Höcker.
In Wirklichkeit sind Kamele und Dromedare ebensowenig wie der Mensch in der Lage, Wasser zu tanken; wie er können sie nur ein Flüssigkeitsdefizit auffüllen. Ein Dromedar ist einmal dabei beobachtet worden, wie es in zehn Minuten 120 Liter Wasser trank und sein vorher vollkommen „abgemagerter“, weil eingetrocknet gewesener Körper die Flüssigkeit so schnell aufnahm, daß er zusehends beleibter wurde.
Kamele und Dromedare haben im Gegensatz zum Menschen verschiedene physiologische Eigenschaften, die sie für das Leben in der Wüste besonders geeignet machen: so können sie Harnstoff konzentrierter ausscheiden – vielleicht sogar auch Kochsalz, denn sie fressen mit Wonne Seetang. Während die Temperatur des Menschen auch in der Hitze ungefähr gleich bleibt, wechselt sie bei den Kamelen und Dromedaren ganz erheblich; morgens kann sie plus 34 Grad Celsius betragen und in der Mittagshitze 41 Grad, höher steigt sie allerdings nicht mehr. Der Vorteil liegt auf der Hand: die Wüstenschiffe schwitzen auf diese Weise weniger und sparen Flüssigkeit. Zusätzlich beziehen sie indirekt Wasser aus ihren Höckern, die vorwiegend aus Fett bestehen: beim Abbau des Fettes wird ja Wasser frei. Das gilt für Menschen wie für Tiere; aus 1000 Gramm Fett können beide etwa 1070 Gramm Wasser gewinnen. Ein weiterer Vorteil der Wüstentiere: ihre Haare isolieren besonders gut gegen Hitze. Die Araber und die Nomaden der Wüste wissen das genau und stellen daher ihre Wollkleidung meist aus Kamelhaar her.
Der Mensch hat sich physiologisch der Wüste nicht anpassen können. Verliert er dort mehr als 12 v. H. seines Körpergewichts durch Transpiration – in trockener, heißer Luft kann er theoretisch in 24 Stunden bis zu 28 Liter Körperflüssigkeit abgeben –, so muß er einen dramatischen, qualvollen Tod erleiden: seine innere Hitze steigt, sein Blut wird zähflüssig und klebrig, sein peripherer Kreislauf wird verstopft. In feuchtem, gemäßigtem Klima wird ihm hingegen ein mehr als 15%iger vorübergehender Verlust des Körpergewichtes nicht unbedingt ernstlich schaden.
Bei Dromedar und Kamel ist es anders: selbst wenn sie durch Hunger und Durst bis zu 25 v. H. leichter werden, verdickt sich ihr Blut nicht. Auch Tiere, die sich zum Winterschlaf verkriechen, können ein Drittel ihres Gewichtes durch Wasserverlust einbüßen, ohne dabei richtig krank zu werden.
Die Dromedare, diese Fernlaster der Wüste, wissen genau, wo Wasser zu finden ist. Haben sich die Nomaden in der Wüste verirrt, so überlassen sie ihnen daher vertrauensvoll die Führung und die Suche nach der nächsten Wasserstelle, und die Tiere gehen selbst dann unbeirrt ihren Weg, wenn eine trügerische Fata Morgana sie auf falsche Fährte locken will.
Stehen Dromedaren gute Weideplätze zur Verfügung, so brauchen sie nicht zu trinken: im Gras ist genügend Wasser enthalten. In heißester Wüste müssen auch sie alle drei bis vier Tage etwas zu trinken bekommen.
Wahre Durstkünstler sind die amerikanischen Beutelmäuse und die Känguruhratten der Wüste, deren Urin sofort nach Verlassen des Körpers „erstarrt“ – so salzhaltig ist er. Ähnlicher Vorzüge erfreuen sich andere Wüstentiere: Sandschlangen, Erdhörnchen oder Gazellen, die weniger Schweißdrüsen als andere Tiere besitzen und zum anderen Wasser gewinnen, indem ihr Körper das Futter oxydiert.
Aber der Mensch ist weder ein Kamel noch eine Känguruhratte, die sich zudem während der heißen Tagesstunden in ihrem Erdloch verkriecht; er kann nicht von ihnen lernen, wie man am besten mit wenig Wasser haushält.
Blühende Sahara
Das Zelt des Mauren stand mitten in ausgedörrtem, kahlem Strauchwerk auf trockenem, kiesigem Boden. Ich fragte, wann es zum letzten Mal geregnet hatte.
„Das weiß ich gar nicht mehr, fast ein Jahr muß es wohl her sein“, sagte mein Gastgeber. „Aber wenn es hier regnet, ist alles grün, dann sind wir von einer blühenden Sahara umgeben.“
„Spüren Sie im voraus, daß es Regen gibt?“
„Meistens ja, die Luft wird anders, die Sonne, die Dromedare – und wir Menschen auch.“
Die Samenkörner der Wüstenpflanzen können viele Jahre im Sand schlummern, aber wenn es dann nach fünf oder zehn Jahren wieder regnet, erwacht die Wüste zu einem kurzen Leben, blüht und streut neue Samenkörner aus.
Tamariskensträucher, die ich verschiedentlich sah, senden ihre Wurzeln bis zu 30 Meter in die Tiefe, der mexikanische Riesenkaktus streckt Seitenwurzeln bis in einen Umkreis von 30 Meter aus, der Säulenkaktus wiederum speichert Hunderte von Litern Wasser in seinem Stamm – und dennoch sind Menschen in seinem Schatten verdurstet, weil sie von diesem pflanzlichen Wassertank in der Wüste nichts wußten. Andere Wüstenpflanzen absorbieren Feuchtigkeit aus der Luft. Die Natur ist einfallsreich, sie findet immer einen Weg, um sich Trockenheit, Kälte oder Hitze anzupassen. Je schwieriger die Umweltbedingungen für Pflanzen oder Tiere, desto unbezähmbarer ihr Lebenswille.
In der Umgebung von Kap Bojador gab es keine Sanddüne, der Boden war leicht gewellt, kiesig hart, zum Teil sogar aus Stein. Nur etwa ein Sechstel der Sahara besteht aus Sand, im Innern stößt man auf Steinwüsten und nackte Gebirge.
Sollte es jemals zu einem wahren Weltfrieden kommen, und sollten Rüstungsgelder dann nutzbringender verwandt werden, so wäre die Wasserversorgung der Sahara keine unmögliche Aufgabe. Wie in früheren Zeiten Mesopotamien und sogar Lybien weitaus besser mit Wasser versorgt waren als heute – sei es durch Kanäle, sei es durch Zisternen –, so könnten auch weite Gebiete der Sahara bewässert und wieder fruchtbares Land werden.