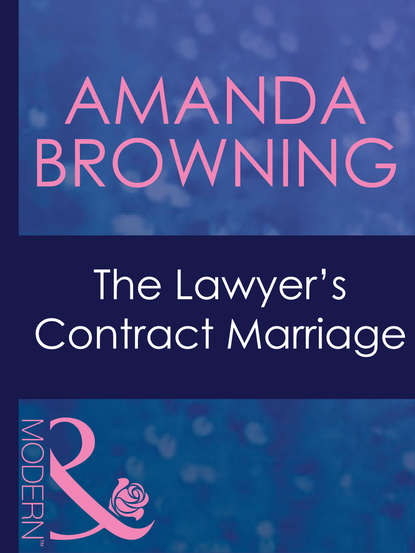Maritime E-Bibliothek: Sammelband Abenteuer und Segeln

- -
- 100%
- +
Die riesigen unterirdischen Wasseradern der Sahara sind erst an wenigen Stellen angezapft worden. Bei Zelfana, im Nordwesten der Sahara, ist eine Oase entstanden, deren Wasser aus 1200 Meter Tiefe stammt. In Ägypten hat ein Finanzmann eine unterirdische Quelle angebohrt und aus einer Sandwüste eine blühende Farm geschaffen, auf der Obst, Getreide und Gemüse gedeihen und fettes Zuchtvieh grast. Man braucht viel Geld, sehr viel Geld, um eine Wüste zu fruchtbarem Land zu machen, aber im Vergleich zu dem, was in die Rüstung gesteckt wird, ist es wenig.
Inwieweit man Atomenergie verwenden will, um Seewasser in Süßwasser zu verwandeln und Wüsten fruchtbar zu machen, ist eine Frage des Bedarfs: das technische Verfahren an sich ist nicht mit großen Schwierigkeiten verbunden. Bei zunehmender Industrialisierung werden einige Länder sich sowieso bald damit befassen müssen.
Noch ein Viertel der Erde ist heute von Wüsten bedeckt; es liegt am guten Willen der Menschen, das zu ändern.
Geisterwald über dem Meer
Unter den üblichen Zeremonien bereitete unser Gastgeber persönlich den Tee zu, während die Frauen, die mit einem nachthemdartigen blauen Burnus bekleidet waren, in einer Ecke des Zeltes hockten und verstohlen ihren blonden Gast musterten. Drei Gläser Tee mußte jeder trinken, dann erst durften wir uns umsehen, auf den Dromedaren reiten und das Innere des Zeltes begutachten. Für mich aber hieß es bald, an die Abfahrt zu denken, denn die Schatten wurden länger und länger.
Vom Jeep aufgescheucht, sprangen Gazellen durchs Gebüsch, und plötzlich stieß mich der Leutnant an, zeigte aufs Meer und rief aufgeregt: „Espejismo!“ Eine Fata Morgana! Ich hätte sie wohl nicht entdeckt, sie sah wie eine Gruppe von Bäumen über dem Wasser aus.
Nicht nur in der Wüste oder auf tropischen Asphaltstraßen stößt man auf eine Fata Morgana, auch auf dem Meer oder in der Arktis kann man sie sehen. Verbürgt ist beispielsweise ein Bericht über eine Luftspiegelung, die die Engländer in der Nähe von Hastings drei Stunden lang beobachten konnten: dort tauchte in allen Einzelheiten die 80 km entfernte französische Küste auf. Und erst vor kurzem geschah es, daß die Bewohner von Sanday, einer der Orkney-Inseln im Nordosten Schottlands, über dem Meer ein weißes Geisterdorf liegen sahen.
Soldaten und Leuchtturmwärter brachten mich zum Strand, ein letztes Händeschütteln, und dann ging es durch die Brandung. Während ich die Segel setzte und den Anker lichtete, umkreiste schon der Lichtfinger den Faro de Cabo Bojador de Don Enrique El Navegante, wie die Spanier den Turm stolz und umständlich nennen.
Ich hielt aufs offene Meer zu und dachte an die Fata Morgana und an Phantomschiffe, die möglicherweise zur gleichen Gattung der Naturphänomene gehören und nicht unbedingt Seemannsgarn sein müssen.
Der König sah ein Phantomschiff
Briten, Holländer, Norweger und andere Völker kennen Sagen von unseligen Kapitänen, die sich erdreisteten, bei Gegenwinden ein sturmumtostes Kap zu umsegeln und dafür mit dem Fluch bestraft wurden, bis zum Jüngsten Tag vergeblich gegen die rohrenden Seen ankämpfen zu müssen.
Der Kapitän Cornelius van der Decken segelt – der Sage nach – mit dem „Fliegenden Holländer“ immer noch gegen die starken Winde am Kap der Guten Hoffnung, und es gibt noch andere bedauernswerte Kapitäne, denen dieses Schicksal zuteil wurde. Wer sie trifft, hat diese Begegnung als ein böses Omen zu betrachten.
Aus dem Logbuch des britischen Dampfers H.M.S. „Bacchante“ stammt die folgende, ungewöhnliche Eintragung vom 11. Juli 1881, vier Uhr morgens:
‚Der fliegende Holländer hat unseren Kurs gekreuzt. Ein seltsames rotes Licht, wie von einem glühenden Phantomschiff mit Masten, Spieren und Segeln einer Brigg1, hob sich in 200 Meter Entfernung deutlich gegen den Himmel ab. 13 Menschen haben es gesehen, jedoch ob es Van Dieman oder der Fliegende Holländer war, konnte nicht erkannt werden. Die „Tourmaline“ und „Kleopatra“ (Begleitschiffe), die sich an der Steuerbordseite befanden, fragten durch Lichtsignale, ob wir das merkwürdige Licht auch gesehen hätten.‘
An Bord der „Bacchante“, die unter dem Kommando des Kapitäns Lord Charles Scott stand, waren Georg V., damals noch ein junger Prinz, und sein Bruder, der Herzog von Clarence.
Einige Stunden nach dem Vorfall stürzte der Matrose, der das Phänomen zuerst gesehen hatte, aus dem Krähennest und brach sich das Genick. Im nächsten Hafen kam der Admiral ums Leben.
Ein ähnlicher, merkwürdiger Bericht stammt aus Island: im April des Jahres 1927 sah ein Hafenbeamter einen isländischen Trawler2 in den Hafen von Reykjavik einlaufen. Neben diesem Fischerboot segelte ein Fischkutter aus Faroe, der neben fünf anderen Kuttern vor Anker ging. Der Beamte kletterte an Bord des Trawlers und entzifferte zusammen mit der Besatzung den Namen des Fischkutters aus Faroe: „Fugleford“.
Da alle neu eingelaufenen Boote vom Hafenarzt, den Zoll- und Immigrationsbehörden untersucht werden müssen, rief Kristjan Jonasson das Polizeiboot herbei, das 15 Minuten später auftauchte, jedoch vergebens nach dem Fischkutter suchte: er war spurlos verschwunden! Da mehrere ehrsame und rechtschaffene Beamte den Kutter zuvor gesehen hatten, wagte niemand, ihre Aussagen zu bezweifeln. Der Kutter, der sich so schnell in Luft aufgelöst hatte, wurde einstimmig zu einem Phantomschiff erklärt.
über Erscheinungen von geheimnisvollen Phantomschiffen gibt es mehr Berichte als selbst ein Seemann, der zu tief in die Flasche geguckt hat, glauben würde. In allen Gegenden der Welt, in Neuseeland wie in China oder Südchile, sind die Schiffe beobachtet worden – mit Grausen, denn überall glaubt man daran, daß sie Unglück bedeuten …
Falscher Feueralarm
Bei vorwiegend achterlichen Winden ging es südwärts nach Villa Cisneros, dem Hauptort der Provinz Rio de Oro, die mit der Provinz EI Hamra Spanisch Sahara bildet, ein Land, das größer als Italien ist und nur 20.000 bis 100.000 Einwohner hat – je nachdem, wieviel Nomaden es gerade durchstreifen.
Das einzige wirtschaftliche Ausfuhrprodukt der Spanischen Sahara stammt nicht aus der Sahara, es stammt aus dem Meer. Vor der marokkanischen und mauretanischen Küste herrscht eine kalte Auftriebsströmung, die ungewöhnlich viele Fische anzieht. Als ich aus Las Palmas abgefahren war, hatte das Wasserthermometer eine Temperatur von plus 23 Grad Celsius gezeigt, am Kap Bojador hingegen maß ich jetzt nur 17,1 Grad. In der Hauptsache sind es kanarische Fischer, die hier meist unter primitiven Bedingungen auf Fischfang gehen; sie trocknen die Fische oder pökeln sie ein und tragen sie auf den Kanaren zu Markte.
Die Saharaküste mit ihrem gleichförmigen, durch keine Schutzhäfen unterbrochenen Steilufer, ist nicht ganz ungefährlich, davon zeugen mehrere Wracks. Im Wasser flooteten unzählige rotbraune Heuschrecken; über der Sahara lag ein schwerer orangefarbener Dunst. Aus allen Richtungen des Kompasses jagten überraschend brennendheiße Böen über mein Boot, so daß ich das Gefühl hatte, es stünde in Flammen. War an Bord ein Feuer ausgebrochen!? Mit einem gehörigen Schreck in den Gliedern stürzte ich in die Kajüte, konnte aber nichts Außergewöhnliches entdecken. Erstaunlicherweise zeigte der Barograph bei diesem Überfall keinen Ausschlag. Da die heißen Böen mit Sturmesstärke über die LIBERIA herfielen, barg ich eilends das Großsegel.
Jetzt konnte ich mir erklären, warum die Kapitäne Heinrich des Seefahrers geglaubt hatten, die Planken ihrer Schiffe müßten im Süden von Kap Bojador in Flammen aufgehen!
Einige Stunden später war der Spuk verschwunden, tödliche Flaute machte sich breit.
Wenn der Wind in dieser Gegend aus einer anderen Richtung als aus Nordost kommt, und besonders, wenn er aus dem Süden weht, darf man immer mit einer Überraschung rechnen: Regen, einem Zyklon oder gar einem Heuschreckenschwarm.
Der „Admiral von Montmartre“ geht auf Weltreise
Als ich nach zweieinhalb Tagen den südlichsten Punkt der langen Landnase, die Villa Cisneros trägt, umrundete, sah ich inmitten einiger Fischerboote eine entmastete Yacht, die mir sofort bekannt vorkam. Am Spiegel konnte ich schließlich den Namen „Morwak“ ausmachen. Mir wurde flau: die Yacht gehörte einem französischen Ehepaar, das ich in Las Palmas kennengelernt hatte! Was machte sie hier?
Sie sah trostlos aus: über und über mit leeren Ölfässern bedeckt und von Ketten und Tauwerk umschlungen! Das Ruder gebrochen! Zerkratzt und zerschunden die weiße, frisch gestrichene Außenhaut! Das schmucke Boot mit der blauen Künstlermarkise, das um die Welt segeln wollte, hatte also hier Schiffbruch erlitten!
Mit leisem Unbehagen kreuzte ich durch die vielen Sandbänke der langausgezogenen Bucht. Die steigende Tide half mir vorwärtszukommen. Während der ganzen Fahrt bis Villa Cisneros beschäftigte mich das Schicksal der „Morwak“. Ich war häufiger bei Monsieur und Madame Bretonnère zu Gast gewesen. Fred war Kunstmaler, auf dem Montmartre, versteht sich, und besaß dort auch ein Restaurant. Seine Künstlerfreunde hatten ihn mit Vorschußlorbeeren bedacht: sie ernannten ihn, den Sportsegler, zum „Admiral von Montmartre“. Madame war während des Krieges Fallschirmspringerin gewesen und fühlte sich offensichtlich an Bord wohler als Fred und seine Menagerie von Pudeln, siamesischen Katzen und Kanarienvögeln.
Sobald ich im Osten der Mole geankert hatte, kam sofort der Hafenkapitän an Bord. Meine erste Frage galt der „Morwak“. Ja, die Besatzung lebe und befände sich hier an Land. Ich kletterte ins Faltboot und paddelte auf die Mole zu; bei sechs Windstärken aus dem Norden konnte ich nur unter Aufbietung aller Muskelkräfte dorthin gelangen.
Madame winkte schon von weitem, und um ihre Füße tänzelten die Pudel. Von der Mole schrie sie mir zu, ihre Segel seien in einer Bö zerrissen worden, der Motor habe nicht anspringen wollen und bevor sie ein anderes Segel hätten setzen können, habe die Strömung sie an Land getrieben – mitten in der dunkelsten Nacht! Eine gewaltige Welle habe das Boot dann plötzlich auf den Strand geworfen. An der 200 Seemeilen langen unbewohnten Felsenküste von Kap Bojador bis Rio de Oro gibt es nur einige hundert Meter Sandstrand – ausgerechnet dort mußten sie stranden, überdies in der Nähe einer Siedlung!
„Quelle chance, Madame!“
Sechs Tage, so rief sie weiter, hätten sie am Strandungsplatz gelegen, und sechs Nächte lang hätten sie geglaubt, in der Wüste umkommen zu müssen. Eingeborene fanden sie schließlich und benachrichtigten den Marinekommandanten im nahen Villa Cisneros. Und damit waren sie gerettet, voilà.
So endete der Traum einer Weltumsegelung!
Für den Kommandanten und seine Leute war die Rettungsaktion der „Morwak“ eine feine Übung; mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, bekamen sie die Yacht wieder flott. Madame lobte die Hilfsbereitschaft der Spanier, alle seien „sehr schick“ zu ihnen. Dem aber konnte ich nicht ganz zustimmen, denn die Spanische Sahara zu besuchen, das ist heute fast schwieriger als auf den Mond zu gelangen. Man braucht – und das wissen die wenigsten, die dort landen – eine Sondergenehmigung aus Madrid, die sehr schwer zu bekommen ist. 1955 hatte ich hier auf meiner Einbaumfahrt drei Wochen als halber Gefangener verbringen müssen, jetzt bahnte sich etwas Ähnliches an. Zum Glück traf ich später den Kommandanten, der mich von einem Vortrag her kannte, den ich in Las Palmas gehalten hatte. Welch ein Zufall! Er setzte sich dafür ein, daß ich mich wenigstens solange frei im Orte bewegen durfte, wie ein Spanier mich begleitete. Aus der beabsichtigten Karawanentour ins Innere wurde nichts.
So gastfreundlich, so hilfsbereit und zuvorkommend alle einfachen Spanier sind, so verletzend und voller Willkür können die Subgobernadores in Villa Cisneros sein. Das ist die Meinung vieler Segler, die hier unfreiwillig oder freiwillig Station gemacht haben.
In den letzten vier Jahren hatte sich in Villa Cisneros, das während des Zweiten Weltkrieges von Amerikanern besetzt war, wenig verändert; die Mole sollte jetzt ausgebaut werden, aber das sollte sie auch schon damals. Der Ort war mit Soldaten überfüllt, die in Zelten untergebracht waren. Villa Cisneros ist so arm, daß selbst ein Schakal sich nicht die Mühe machen würde. dort nach Beute zu suchen. Interessant sind lediglich die moderne Kirche und das Fort, das jedoch mehr nach einem Zuckerhausguß aussieht als nach dem berüchtigten Zwangslager für politische Gefangene.
Der „Kaiser“ wird ausgeschlachtet
Schon am folgenden Tage verließ ich das ungastliche Villa Cisneros. Der Passat fegte wie immer unangenehm über die Bucht von Rio de Oro.
Man weiß nicht genau, warum die Portugiesen der Bucht diesen Namen gegeben haben – ob sie hier bei den Eingeborenen Goldstaub einhandelten, oder ob die Bucht sie an ihren Rio Douro, den größten Fluß im Norden Portugals erinnerte? Auf alle Fälle: Gold bringt in diesen Gewässern heute nur der Fischfang ein.
Vor dem Eingang in die Bucht liegt „Kaiser Wilhelm der Große“ begraben. Der „Kaiser“, wie ihn jedes Kind in Villa Cisneros nennt, war kurz vor der Jahrhundertwende das größte deutsche Passagierschiff, das sogar das „Blaue Band“ des Nordatlantiks eroberte. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurde der Luxusdampfer binnen 36 Stunden in einen Hilfskreuzer umgebaut, dem jedoch nur eine kurze Lebensdauer beschieden war: wie es in einem anstänchgen Kriege üblich ist, beschoß ihn ein englischer Kreuzer gegen alle internationalen Seegesetze, als der „Kaiser“ in den spanischen Gewässern vor der Sahara Kohlen bunkerte. Da die kleinen Kanonen des „Kaisers“ den Feind nicht einmal erreichen konnten und dem deutschen Kapitän das schlechte Schießen der Engländer auf die Nerven fiel, beging das stolze Schiff Selbstmord und versperrt seitdem die Einfahrt in die Bucht. Heute ist eine spanische Bergungsgesellschaft dabei, aus dem „Kaiser“ die besten Brodten auszuschlachten.
Das kam mir reichlich „spanisch“ vor
Im gebührenden Abstand von der Küste segelte ich südwärts und hielt bald darauf meinen Einzug in die Tropen. Unter der Küste entdedtte ich den ersten Langustenfischer, der im Besan3 die Trikolore gesetzt hatte. Als ich das wie eine Yacht ausschauende Boot schon passiert hatte, ließen die Fischer ein Beiboot zu Wasser und kamen mir nachgebraust. Sie luden mich freundlich zum Langustenessen ein – tut mir leid, Messieurs, ich muß leider weiter! Denn in aller Frühe wollte ich im südlichsten Ort der Spanischen Sahara sein, in Güera.
Dort landete ich mit meinem Faltboot in der Nähe des alten Leuchtturmes. Ein Maure eilte mit mir durch den hohen Sand zum Ort, der ganz mit Stacheldrahtverhau eingezäumt war und aus nichts als weißen Häusern in gelbem Sand bestand. Vor einem dieser kahlen Häuser, in deren Innenhöfe ein spärliches Grün aus Blumentöpfen sich tapfer die Wände emporzuranken versuchte, stellte ich mich einer Gruppe von Einwohnern vor, die jedoch meinen Namen bereits durch die Funkstation in Villa Cisneros kannten. Der Ortskommandant war unter ihnen – im Schlafanzug, dem einzig richtigen Kleidungsstück für diese Gegend, und er rief ins Haus hinein: „José, venga!“
Heraus trat ein alter Segelkamerad aus Las Palmas, José Miranda, der in diesem trostlosen Ort seine Ferien mit Angeln und Jagen verbrachte. Nach einer stürmischen Begrüßung setzte José mir auseinander, daß auf Grund der Unruhen im Innern des Landes in Rio de Oro alles durcheinander gehe; die Behörden mißtrauten selbst ihren eigenen Leuten. Am besten sei es, ich führe nach Port Etienne weiter, der Nachbarstadt in Mauretanien; dort würde er mich dann besuchen. In Güera gäbe es sowieso nichts zu sehen …
Ich hatte genug von Rio de Oro.
Südlich von Kap Blanc, das dem weißen Kalkfelsen von Dover ähnelt, lagen mehrere Langustenboote vor Anker. Wieder kam ein Beiboot und lud mich zum Mittagessen an Bord ein. Diesmal hatte ich Zeit und nahm mit Freuden an.
Die Besatzung der „Avel Dro“, die aus der Bretagne stammte, war für die willkommene Abwechslung so dankbar wie ich. Sie erklärte mir, daß sie sich auf zwei Arten von Langusten spezialisiert habe: die grüne Languste, die sich in unmittelbarer Nähe der Küsten in flachen Gewässern aufhält, und die rote Languste, die in Tiefen von 40 bis 300 Metern zu finden ist. Die Tiere – sie werden mit Netzen gefangen – kommen lebend auf den Markt, das bedeutet, daß sie in riesigen Behältern, durch die dauernd Meerwasser strömt, aufbewahrt werden müssen. Das etwa 100 Tonnen große Boot ist praktisch um diese Frischwasserbehälter herum gebaut worden. Vier Monate lang sind die Fischer von ihrer „Waterkant“ in Frankreich getrennt, selten kommen sie einmal mit anderen Menschen in Berührung.
Vom Kap Blanc bis nach Port Etienne sind es nur wenige Meilen, für die ich bei den herrschenden Gegenwinden mit nur zwei Stunden Fahrzeit zu rechnen brauchte. Da fiel plötzlich vom Steilufer eine stürmische Fallboe über die LIBERIA her, und während ich alle Hände voll zu tun hatte, um das Großsegel zu bergen, lief das Faltboot voll Wasser, kenterte und brach in der Mitte durch. Ich konnte noch froh sein, daß die LIBERIA ohne Schaden davon kam. Das Segelschulschiff „Niobe“ war in einer ähnlichen Fallboe gekentert.
Erst in der Nacht rasselte mein Anker in Port Etienne in die Tiefe!
Was wird aus Mauretanien?
Als ich morgens aufwachte, glaubte ich meinen Augen nicht trauen zu dürfen: um ein winziges Meeresbecken, das von unzähligen Fischerbooten fast gesprengt zu werden drohte, türmten sich regelrechte Sanddünen auf – der Sand der Sahara fiel hier buchstäblich ins Meer! Hafenanlagen gab es nicht; hinter dem Rücken der Dünen lugten lediglith ein paar weiße Häuser hervor.
Aber in Port Etienne waren damals die Franzosen und damit Großzügigkeit, Aufgeschlossenheit und Kontaktfreudigkeit. Schon mittags stand ich dem Commandant du Cercle gegenüber, der ohne zu zögern auf jede Frage Auskunft gab.
Er drückte seine Verwunderung über die eigenartige Politik der Spanier in ihrer Sahara aus: erst hatten sie die marokkanischen Banditen, die ihnen Aufruhr und Unruhe ins Land brachten, jahrelang unbehelligt gelassen, und dann, als die Unruhen auf das benachbarte Mauretanien übergriffen, waren sie plötzlich gemeinsam mit den Franzosen gegen sie vorgegangen. Französische Einheiten – so erzählte er mit Genugtuung – hätten selbst in der Spanischen Sahara Ordnung geschaffen und die Streitkräfte der Banditen zerschlagen; seitdem habe Mauretanien Ruhe.
„Mir ist aufgefallen, daß hier jeder zweite spanisch spricht. Warum arbeiten denn so viele Spanier in Port Etienne?“
„Sie haben sich von all unseren Arbeitern am besten bewährt. Unsere Mauren sind flink, gewandt, sehr ausdauernd und zäh bei Arbeiten in der Wüste, doch wenn sie längere Zeit an einem Ort arbeiten müssen, meldet sich ihr Nomadengeist. Die Neger hier leisten zwar gute manuelle Arbeit, aber die genügsamen Spanier sind ihnen überlegen. Ihre Domäne ist ausschließlich der Fischfang.“
„Wie wird sich das freie Mauretanien wirtschaftlich entwickeln können?“
„Außer den reichen Fischgründen direkt vor unserer Tür hat man im Innern des Landes Eisen und Kupfer gefunden; die Ausbeutung ist nur vom Bau einer Bahn abhängig. Kapital aus den verschiedenen Ländern, darunter auch aus Deutschland, steht hinreichend zur Verfügung.“
Ich erinnerte mich daran, gerade in einem Saharabuch gelesen zu haben, daß die riesigen Eisenvorkommen in Mauretanien, das „Eisengebirge“ bei Fort Gouraud, schon um das Jahr 1000 von den Arabern ausgebeutet worden sind. Da Frankreich selbst keine Kupferbergwerke besitzt, wird es auch an der Kupfergewinnung größtes Interesse haben. „Und was halten Sie von der politischen Zukunft Ihrer eben erst aus der Taufe gehobenen Republik? Wird sich Mauretanien Marokko anschließen? Oder dem Senegal?“
„Uns weißen Afrikanern geht die politische Entwicklung in diesem Lande ein wenig zu schnell. Es gibt hier kaum Abiturienten, nur wenige Akademiker und Facharbeiter – man wird noch lange die Hilfe Frankreichs brauchen. Heute sieht es so aus, als ob sich Mauretanien mehr dem südlichen Nachbarland Senegal anschließen wird als Marokko, selbst wenn hier einige Emire mit dem Sultan von Marokko liebäugeln.“
Mauretanien ist gut doppelt so groß wie Frankreich und hat dennoch nur so viele Einwohner wie die Hafenstadt Marseille. Die Mauren – sie setzen sich aus den gleichen Stämmen wie die spanischen Muros zusammen und haben zusätzlich starke Blutsbande zu den Tuaregs und den Toubous – sind vorwiegend noch immer Nomaden, die auf der Suche nach Wasser unbekümmert um Grenzen durch das Land ziehen. „Regengäste“ nennt man sie auch, weil sie ihre Herden stets dorthin treiben, wo es gerade geregnet hat.
Im Süden von Port Etienne ist inzwischen aus einem winzigen und verlassenen Hüttendorf eine Hauptstadt entstanden, an der noch viele Jahre lang weiter gebaut werden wird. Nouakchott heißt diese Metropole der jungen Republik, die noch weit davon entfernt ist, eine wahre Republik zu sein, denn noch immer regieren dort zum großen Leidwesen der jungen Revolutionäre die Stammeshäuptlinge.
Die Zeit verging mir im „langweiligen“ Port Etienne überraschend schnell. Meine spanischen Bekannten aus Güera statteten mir tatsächlich einen Besuch ab und bestanden darauf, daß ich ihn erwiderte. Mit Tonio, einem spanischen Brunnenfachmann, brach ich daher erneut nach Güera auf – diesmal in umgekehrter Richtung und auf dem Landweg.
Güera wird genau wie Port Etienne von Sanddünen bedroht. In beiden Orten steht Militär bereit, um nötigenfalls mit Spezialmaschinen der gefährlichen Invasion der Dünen Einhalt zu gebieten.
Zwischen Güera und Port Etienne zieht sich irgendwo zwischen Sand und Steinen – die Halbinsel wird der Länge nach von einem felsigen Grat durchschnitten – die Grenze zwischen Spanisch Sahara und Mauretanien hin. Tonio, der jeden Stein auf unserem Weg kannte, fand sogar ein unscheinbares Grenzzeichen. Kontrollen gibt es hier nicht; sobald man einen der Orte erreicht hat, meldet man sich, und damit ist dann meist schon alles erlechgt. Nur selten geschieht es, daß eingeborene Zöllner den Wagen genau untersuchen.
Die beiden Ortschaften sind nur fünf Meilen voneinander entfernt, der Ausflug in die Sahara ist also wirklich nicht sehr weit – und trotzdem ist er nicht ungefährlich. Ich stellte es erstaunt fest, als wir einen Jepp mit vier französischen Soldaten trafen, die sich auf dieser unübersichtlichen Strecke verirrt hatten und fluchend nach einer Orientierungsmöglichkeit suchten. Jede Autofahrt in die Sahara kann ein Fiasko werden, wenn man keine ausreichenden Vorräte an Wasser, Lebensmitteln, Brennstoff etc. mitnimmt.
Die Sahara ist eigentlich erst erobert worden, als Kamele und Dromedare aus dem Osten dort ihren Einzug hielten. Kamelkarawanen waren es auch, die später aus dem heutigen Marokko südwärts, nach Mauretanien und in den Sudan, zogen und das Gebiet südlich der Sahara, das „Schwarze Afrika“, durchdrangen. Kurz vor dem Jahre 1600 ritten die Mannen des Sultans von Marokko hoch zu Kamel ins Songhai-Reich ein und zerstörten es – auf jene Zeit gehen die heute verschiedentlich vorgebrachten Ansprüche Marokkos auf Mauretanien zurück!
Tonio wohnte am Rande von Port Etienne, sein von ihm selbst gebautes Haus wurde fast von Sanddünen erdrückt. Auch seiner „Fabrik“, einem großen leeren Schuppen, in dem Jeeps repariert und gleich daneben Fische getrocknet wurden, erging es nicht anders. Sand, wohin man blickte.
Tonio ist ein politischer Flüchtling des Francoregimes, aber in der Spanischen Sahara macht ihm kein Mensch Schwierigkeiten, wenn er dort besuchshalber auftaucht.
Am Hafenbecken von Port Etienne stinkt es wie auf dem Altonaer Fischmarkt; man fällt über unzählige Gestelle, auf denen in der prallen Wüstensonne Fische getrocknet werden. Ganz Westafrika bezieht seinen Trockenfisch aus Port Etienne; in Dakar ist er genauso willkommen wie in Lambarene. Die Fanggründe – die besten, die sich ein Fischer wünschen kann – liegen direkt vor der Haustür.