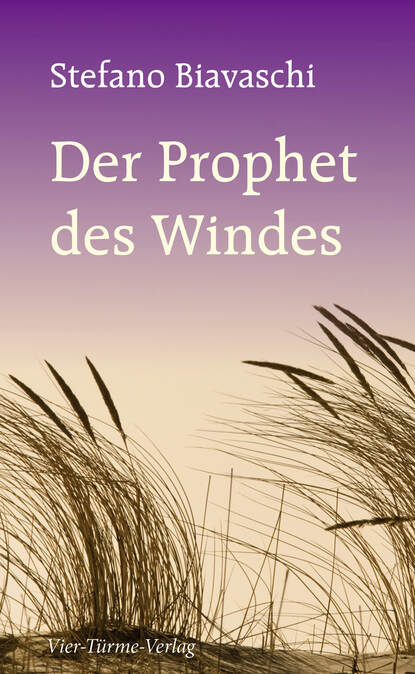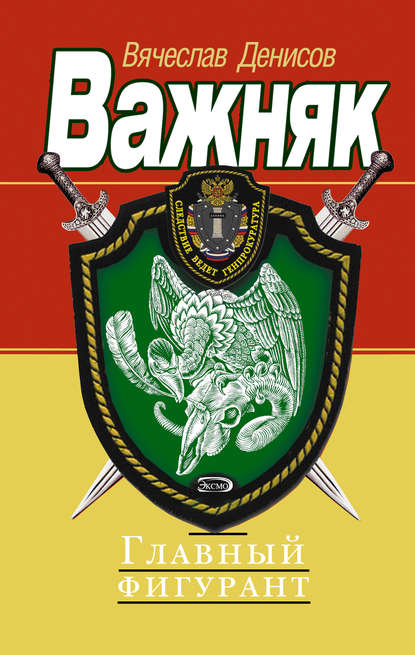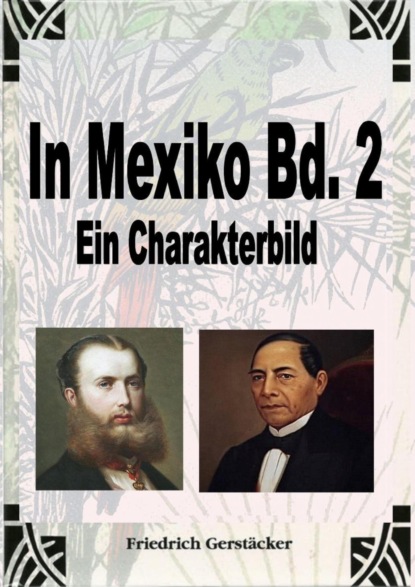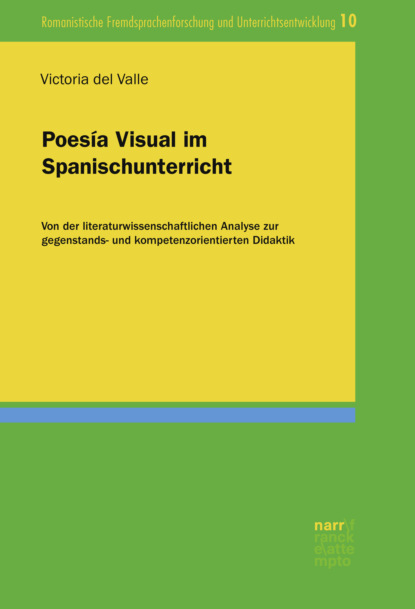Maritime E-Bibliothek: Sammelband Abenteuer und Segeln

- -
- 100%
- +
Geburtswehen in Conakry
Ohne böse Überraschungen gelangte ich nach einer 260 Seemeilen langen Fahrt an einem Sonntagabend nach Conakry, der Hauptstadt des früheren Französisch-Guinea, das sich, als ich dort ankam, gerade von Frankreich losgesagt hatte und zur jungen Republik Guinea geworden war.
Am Hafen setzte eine üble Strömung vorbei, die in der Dunkelheit den Landfall unnütz dramatisierte. Schließlich legte ich an einem Bauxitschiff an. Kaum hatte ich festgemacht, als ein afrikanischer Polizist erschien und die Personalien aufnahm. Ein anderer Polizist lud mich zum Duschen ein, und als ich davon zurückkam, stieß ich auf eine dritte Amtsperson, den frisch gebackenen Hafenkommandanten, einen Mulatten, der sehr verärgert war, weil er die Gelegenheit verpaßt hatte, als erster seines neu erworbenen Amtes zu walten. Später freundeten wir uns an, und er fuhr mich auch zum Präsidenten Sekou Touré.
Conakry war ein Hexenkessel, voller Aufruhr und Empörung; Gerüchte und Klatsch hielten die Stadt in Atem, und über Menschen und Dingen lag eine Spannung, die sich jeden Augenblick zu entladen drohte. Die Franzosen waren ehrlich empört, daß Guinea sich von ihnen gelöst hatte; sie transportierten alles ab, was ihnen wertvoll erschien; von schweren Straßenbaumaschinen bis zum Bleistift, von Aktenbergen bis zum letzten Revolver. Auch die Afrikaner waren empört: „Erst stellt man uns frei, uns von Frankreich zu lösen, und dann, als wir uns dafür entschieden, werden wir einfach isoliert!“
Kaum hatte es sich herumgesprochen, daß eine deutsche Yacht im Hafen eingetroffen war, da erhielt ich Besuche und freundliche Worte. Zwei Zollbeamte brachten mir sogar ein Bündel Bananen aufs Boot. Man hatte soeben einen Handelsvertrag mit der DDR geschlossen, und – Deutsche sind doch Deutsche! Geteiltes Deutschland? Nie davon gehört!
Ich ging an Land und genoß den kühlen Schatten eines gewaltigen Kapokbaumes, der am Hafeneingang wie ein Riesenwächter schützend seine Zweige breitet. Unter dem Baum hockten Marktfrauen und boten den Hafenarbeitern selbstgebackenes Brot und Obst an. Conakry verschwindet in einem Meer von Grün; riesige Affenbrotbäume, Kapok- und Mangobäume wölbten über den Straßen ihre Kronen. Nirgends in Westafrika habe ich so schattige Alleen gesehen wie hier!
Auf dem Wege zur Stadt passierte ich ein Kriegerdenkmal, das die Franzosen einst errichtet hatten. Heute trägt es eine neue Inschrift: „Die Republik von Guinea den Märtyrern des Kolonialismus.“ Zweifellos beziehen sich diese Worte nicht auf die Kolonisierung Guineas durch Frankreich, sondern auf den nicht gerechtfertigten Einsatz von Afrikanern in zwei Weltkriegen; mit dem Glauben, die Afrikaner seien für ihr Vaterland gefallen, hat der junge Ministerpräsident gründlich aufgeräumt.
In dem ein wenig vernachlässigten Regierungsgebäude traf ich den Ministerpräsidenten. Die Schlagzeilen der Weltpresse hatten den jungen Sekou Touré einen Rebellen, einen Sozialisten, einen Kommunisten, einen Marxisten und vieles andere mehr genannt. Lachend kam er mir entgegen, während der ganzen Unterhaltung blieb sein Gesicht entspannt. Er sieht gut aus, trägt ein stolzes Gebaren zur Schau und antwortet schnell und gewandt. Was will Sekou Touré?
Sein erstes Ziel ist Guineas Größe – unter welchen Bedingungen und mit welchen Mitteln er es erreicht, das ist ihm gleichgültig. Sein zweites Ziel ist ein geeintes, freies Afrika. Guinea ziehe Armut und Freiheit dem Reichtum und der Unfreiheit vor; an Verbrüderung sei ihm mehr gelegen als an Almosen, und es brauche technische Unterstützung – keine moralische.
Sekou Touré entstammt altem afrikanischem Adel; er soll ein Nachkomme der Keita-Dynastie sein, die das afrikanische Mali-Reich begründen half. Er ist Mohammedaner. Die Minister seines Kabinetts sind, wie er, sehr jung, doch sie hoffen, ihre Aufgabe lösen zu können, denn ihr Land ist reich an Bananen, Eisen, Diamanten, Bauxit, das in unmittelbarer Nähe von Conakry lagert. Große Wasserkräfte sind bisher ungenutzt.
Nomen ist nicht Omen
Für mich kam die Zeit, zur Abfahrt zu rüsten. Bojen, Strömung – das übliche Spiel. Bald war ich wieder auf dem Meer und allein. Am frühen Morgen stand ich vor Freetown in Sierra Leone, das jedoch nicht auszumachen war, weil es sich hinter einer dunklen Regenwand verbarg. Zehn Meilen vor mir im Osten mußte das „Löwengebirge“, wie die Portugiesen es nannten, liegen. Der Funkpeiler bestätigte meine Vermutung. Zum Segeln fehlte der Wind. Der Motor lief zwar, jedoch die Umsteueranlage machte nicht mehr mit.
Die Stunden verrannen, der Mittag verstrich, erst am Abend kam eine schwache Seebrise auf, und spät, sehr spät, konnte ich in Freetown vor den Marinearsenal ankern.
Ein schwarzer Händler fuhr am nächsten Morgen mit seinem Einbaum bei mir vor und wollte mir Waren andrehen, die er bei den Passagieren eines Frachters nicht losgeworden war. Da seine Preise nicht zu hoch lagen, beschloß ich, einen Speer zu kaufen. Erst das Geld, dann die Ware, forderte der Mann. Er hielt den Speer in der Hand – ich das Geld. Nach kurzem Zögern gab ich nach und ließ es in seine ausgestreckte Hand gleiten. Und da geschah, was ich vorausgesehen hatte: er nahm Reißaus. Sicher hatte er längst mit einem Blick erfaßt, daß mir kein fahrbereites Beiboot zur Verfügung stand.
„Na, warte!“ dachte ich. „So schnell legst du mich nicht herein!“
In aller Ruhe arbeitete ich weiter am Boot, verfolgte aber aus den Augenwinkeln heraus genau seinen Weg. Später nahm ich das Fernglas zur Hilfe, und als ich ihn aus dem Blickfeld verlor, schlug ich schnell das Schlauchboot auf, verstaute darauf mein Klapprad und pullte, mit einem Fernglas bewaffnet, zum Ufer.
Dann setzte die Verfolgungsjagd ein. Ich hatte mir die Richtung genau gemerkt, in der er verschwunden war, und entdeckte sein Boot schon nach wenigen Minuten in einer kleiner Bucht hinter der Regierungsmole. Der Händler machte sich eilends aus dem Staube, als er mich kommen sah. Etwa zwanzig Afrikaner lungerten um sein Boot herum und schnitten mir den Weg ab. Der Händler gehöre nicht zu ihnen, sie kennten ihn nicht, sagten sie mit drohendem Unterton in der Stimme. Ich sollte gefälligst machen, daß ich weiterkäme.
Gerade das aber hatte ich keineswegs im Sinn – jedenfalls nicht ohne Speer. Ich versuchte, meiner Wut Herr zu werden. Mal sehen, ob sich die Halunken nicht bei der Ehre packen ließen.
„Hört mal, Gentlemen, ich bin in einem kleinen Boot aus Europa gekommen, um Freetwon zu besuchen. Was aber tun Sie! Sie dulden, daß ein Gast Ihres Landes bestohlen wird! Bitte, wenn Sie das für richtig halten, werde ich gehen!“
Die Männer hatten mir aufmerksam zugehört. Sie besprachen sich leise, und dann griff einer nach dem Speer und überreichte ihn mir stillschweigend. Ich kam ungeschoren wieder zu meinem Boot zurück, und der Speer hängt heute über meinem Schreibtisch.
Freetown war einmal führend in der afrikanischen Freiheitsbewegung das gehört der Vergangenheit an. In Freetown gab es für viele Jahre die einzige westafrikanische Bildungsstätte von Bedeutung – heute haben die Nachbarländer sie überflügelt. Das angenehmste an der Stadt waren für mich ihre schöne Lage und der Gouverneur, der ein Gentleman der alten Schule war, und das nicht nur, weil er – segelte.
Ob die von England und aus den USA herübergesandten freien Afrikaner und die entlaufenen Negersklaven aus Jamaika, die hierher transportiert wurden, wohl geglaubt hätten, daß ihre Nachfahren 160 Jahre später immer noch nicht ganz frei sein würden? Freetown – freie Stadt – erwies sich als ein leerer Name. Jedoch bemühten sich die einsichtigen Briten, auch dieses Gebiet Schritt für Schritt auf den Weg zur Unabhängigkeit zu führen. Entwicklungen dieser Art brauchen Zeit. Wenn dieses Buch erscheint, wird Sierra Leone bereits unabhängig sein.
Sierra Leone ist so groß wie Irland, jedoch so reich wie irgendwer: Diamanten hinten und vorn – legal und illegal –, etwas Gold, Eisen, Chromit, Columbit, Titanium, Palmkerne, Ingwer und Kolanüsse für ganz Westafrika und die Sahara.
Als ich mich vor Jahren in Freetown nach London einschiffte, luden wir Hunderte von Säcken mit Kolanüssen, und darauf lagen dann die Deckpassagiere und kauten – Kolanüsse. In Bathurst stiegen sie wieder aus, die Säcke und die Kolanuß kauenden Passagiere. Von dort aus wurden sie den Gambiafluß 350 km aufwärts verschifft, um dann schließlich auf dem Rücken von Kamelen in den Sudan, in die entlegensten Dörfer der Wüste, verfrachtet zu werden.
Kolanüsse ersetzen in vielen Orten Westafrikas Kaffee, Kaugummi und Zigaretten, und bei einigen Stämmen ersetzt eine weiße Kolanuß sogar einen mündlichen Heiratsantrag, ganz davon zu schweigen, daß sie in der Mitgift nicht fehlen darf.
Als ich seinerzeit einem Häuptling in Liberia einen Baumstamm abkaufen wollte, um die LIBERIA I zu bauen, mußte ich ihn erst meiner Freundschaft versichern, indem ich ein Stück Kolanuß verzehrte. Ich habe mich nie an den bitteren Geschmack der Frucht gewöhnen können; und doch gibt es im Sudan Liebhaber der walnußgroßen Nuß, die ihre Lieblingssklavin für sie gegeben haben.
Die chemischen Stoffe der Nuß, vor allem das Coffein, vertreiben den Schlaf und erhöhen die Leistungsfähigkeit von Mensch und Tier.
Welcher Beliebtheit die Nüsse sich erfreuen, kann man aus der Tatsache ersehen, daß es in Dakar an jeder Straßenecke mindestens einen Kolanußhändler gibt, der am Tage etwa 20 bis 40 Stück verkauft und davon leben kann. Getränke, die Kolanußextrakt enthalten, dringen heute schon in den tiefsten Busch und in den abgelegensten Kral ein – ein Zeichen des Fortschritts?
Nachdem ich zwischen den Tiden mein Boot zum zweitenmal auf dieser Fahrt mit einer Patentfarbe gegen Algenwuchs und Wurmbefall gestrichen hatte, lichtete ich eines Abends den Anker für Liberia. In der Luftlinie sind es keine 200 Seemeilen nach Monrovia, jedoch liegen im Süden von Freetown gefährliche Bänke, die einen weiten Umweg erfordern. Die Hafenbeamten baten mich, „das Seemannsgrab nicht zu vergrößern“.
Aber sollte die LIBERIA IV wegen ein paar Riffs nicht Liberia anlaufen können, das Heimatland des Einbaumes, der den Atlantik überquert hatte?
1 Überkämmende See.
2 Das kreuzweise Herumlegen eines T aues um einen Poller.
3 Anderthalbmaster, mit dem kleinen, dem Besanmast, hinten, aber vor dem Ruder.
4 1 Knoten = 1 Seemeile = 1852 m/h.
FÜNFTES KAPITEL
LIBERIA: KÖNNEN AFRIKANER KOLONISIEREN?
Die Navigation an Bord der LIBERIA IV stimmte genau; ich lief die Boje am Rande der gefährlichen Sandbänke weit draußen im Meer an und konnte beruhigt Kurs auf die liberianische Küste nehmen.
Wie es beinahe schon zur Regel auf meiner Fahrt geworden war, traf ich erst nachts im Hafen von Monrovia, der Hauptstadt von Liberia, ein. Von der Pier her leuchteten die Lichter mehrerer Dampfer, außerdem lagen noch einige Schiffe draußen auf Reede – ein Zeichen, daß die älteste Negerrepublik Afrikas regen Handel treibt.
Mit raumem Wind1 war ich bald vor dem Kai. Am Steuerbord machte ich eine Ketsch aus. Ich hielt auf sie zu und warf neben ihr Anker. Kaum lag das Boot still, als sein Rumpf von allen Seiten überfallen wurde, es knackte und knirschte, knisterte und krispelte, daß man glauben konnte, eine Armee von Bohrwürmern hätte zum Großangriff geblasen. Aber Bohrwürmer, die gefürchteten Teredos, arbeiten lautlos und in aller Heimlichkeit. Was sich hier an meinem Boot zu schaffen machte und sich ungebeten an seinem Rumpf festsetzte, war harmloseres, „krebsiges“ Getier.
Der historische Einbaum verbrennt
Als ich morgens mit meinem Schlauchboot an Land pullte, traf ich wenig später den obersten Richter des Landes, dessen Frau ich früher häufiger behandelt hatte. Meine erste Frage galt meinem Einbaum, mit dem ich nach Haïti, der Schwesterrepublik Liberias, gesegelt war und den Präsident Tubman für das neue Museum in Monrovia erworben hatte.
„Ja, das ist so eine Sache – den haben wir gerade vor zwei Tagen verbrennen müssen!“
Mir stockte der Atem. „Verbrennen? Um Himmelswillen, warum denn das?“
„Er war zu schwer für den Transport ins Museum; da fragte man im ‚Mansion‘, dem Sitz des Präsidenten, an, was man tun sollte und erhielt die Order, das Boot zu verbrennen.“
Ich war entsetzt. Als ich Liberia vor einigen Jahren verlassen hatte, war es dem Krankenpfleger unseres Hospitals ein leichtes gewesen, meinen Einbaum zu transportieren. Wie einfach hätten die Liberianer ihn jetzt mit dem Kran zu Wasser bringen und direkt zum Museum paddeln können! Doch regte ich mich nicht weiter über diese Angelegenheit auf, denn ich kannte Afrika zu gut, um nicht zu wissen, daß man mit solchen Kurzschlüssen immer wieder rechnen muß.
Malaria schwingt ihre Geißel
Liberia ist eines der umstrittensten Länder der Welt. Hier hatten die Afrikaner die Gelegenheit zu zeigen, was in ihnen steckte. Und was schufen sie? Ein „verratenes Negerparaches“? Einen „Schandfleck Afrikas“, wie man es genannt hat?
Bevor man diese Fragen beantwortet, muß man die weitere Frage stellen, wie es kam, daß Liberia bis zum Zweiten Weltkrieg das zurückgebliebenste Land Afrikas war. Lag es an den Eingeborenen? An den eingewanderten „Americo-Liberianern“? Oder an dem „schlechten Klima“?
Nicht nur, weil ich Arzt bin, möchte ich sagen, daß Westafrika und insbesondere Liberia hauptsächlich durch die vielen dort herrschenden Krankheiten afrikanisch oder unterentwickelt geblieben ist. Nur wer diesen Jammer selbst beobachtet hat, kann sich vorstellen, wie tief durchseucht von Krankheiten die letzte Hütte war und zum Teil heute noch ist.
Westafrika galt Jahrhunderte hindurch als das „Grab des Weißen Mannes“, aber man vergaß, daß es auch das Grab des Afrikaners war; schon die Säuglinge wurden von Mückenschwärmen überfallen, Krankheitserreger drangen in ihr Blut, in ihre Organe ein, und am Ende stand eine traurige Statistik: über die Hälfte aller Säuglinge starben, bevor sie das erste Lebensjahr erreicht hatten. Die am Leben blieben, waren für den Rest ihres Lebens infiziert; eine Art Waffenstillstand bildete sich aus: der Mensch mußte die Krankheitserreger mit sich herumschleppen, sie forderten einen täglichen Zoll von seiner Lebenskraft und Energie. Sobald jedoch ein Afrikaner von einer Krankheit erfaßt wurde, wie sie auch in unseren Breiten auftritt, – einer Erkältung, einer Lungenentzündung, einer Diarrhöe oder auch dem Alkoholrausch –, erwachten plötzlich die Krankheitserreger und versuchten, ihren Wirt heimtückisch umzubringen.
So schwingt die Malaria ihre Geißel! Seit Jahrzehnten. Seit Jahrhunderten. Der ausgemergelte Säugling wie die fette Mammie werden vom Sumpffieber befallen – die einen akut, die andern latent. Noch heute leiden Millionen von Menschen auf der Welt an Malaria, und noch heute ist der Ausgang der Krankheit bei mehr als einer Million jährlich tödlich.
Krankheiten haben die Geschichte von Kontinenten diktiert – besonders die Malaria. Aber zu diesen Krankheiten gehören auch viele andere von Mücken und Fliegen übertragene Leiden; man denke nur an das Gelbfieber, an die verschiedenen Filarienkrankheiten und an die Schlafkrankheit! Einige Filarienkrankheiten werden in der Nacht von tropischen Hausmücken übertragen, die Malaria in der Dämmerung von der Anopheles-Mücke und die Schlafkrankheit, deren Überträger die Tsetsefliege ist, vorwiegend am Tage.
Bis in die jüngste Zeit wurde das tropische Afrika von Insekten beherrscht wie das Meer vom Wind. Wer in Afrika auf dem Feld arbeitet oder auf Jagd geht, setzt sich den Moskitos besonders aus: hier werden Fleiß und Aktivität von der Natur bestraft!
Weiße wie neu eingewanderte Schwarze, Europäer wie die befreiten Sklaven, die aus den USA gekommen waren, um Liberia, das „freie Land“, begründen zu helfen, wurden von den Krankheiten hingerafft. Wie ungeheuer hoch die Zahl der Todesfälle war, zeigt ein erschütterndes Beispiel aus den Gründerjahren der jungen Republik: Von der Besatzung des britischen Raddampfers „Albert“ starben vor der Küste Westafrikas 42 von insgesamt 145 Mann. Und dieses Massensterben auf der „Albert“ war beileibe kein Ausnahmefall!
Bei diesen Krankheiten allein aber bleibt es nicht einmal – es gibt in Westafrika noch genügend andere Leiden, die jedes für sich besondere Probleme schaffen: die Frambösie, Schistosomiasis, Darmerkrankungen, Lepra, Tuberkulose, Hautflechten und Wurmverseuchungen. Ich habe Patienten gesehen, die vier oder fünf verschiedene solcher Leiden hatten und dennoch nur wegen eines Leistenbruches zu mir kamen.
Wer sich gegen die Krankheiten behaupten konnte, hatte immer noch gegen die Tücken des Wetters und der Natur zu kämpfen. Schlangen raubten den Eingeborenen die Hühner, Leoparden rissen ihre Schafe, Elefanten zertrampelten die kleinen Plantagen, Tornados knickten die Bananenstauden und Papayastämme, ja, ganze Armeen zogen gegen sie zu Felde: furchtlose, gehorsame, blinde Treiberameisen, die gleich automatischen Heersäulen durch das Land streifen und vor nichts haltmachen.
Weiter: wie sollten die Eingeborenen ihre Lebensmittel aufbewahren? Nach zwei Tagen schon sind sie verschimmelt, ranzig und verfault. Und wenn den Afrikanern auch Kokosnüsse oder Bananen quasi in den Mund wachsen, so müssen sie schon für ihren Bedarf an Reis doppelt soviel arbeiten wie bei uns die Bauern für den Weizen. Jeglicher Fortschritt, jede persönliche Initiative, wurde zudem bereits im Keim durch Urwaldreligion, den Animismus, erstickt, den die Alten sorgsam hüteten. Wer gegen ihn verstieß, mußte nicht selten mit dem Leben dafür bezahlen.
Erst mit dem Chinin und später mit der Entwicklung anderer wirksamer Präparate gegen die Tropenkrankheiten begann die eigentliche Durchdringung des schwarzen Afrikas durch Weiße und Schwarze – das gilt auch für Liberia. „Die Medizin ist die einzige Entschuldigung für den Kolonialismus“, hat Frankreichs Kolonialpionier, Marschall Lyautey, einmal gesagt.
Nun zum feuchtheißen Klima, das oft als weiterer Grund für die Rückständigkeit des Landes genannt wird. Es setzt gesunden Menschen weit weniger zu, als man allgemein annimmt. Zu Kaisers Zeiten waren die Tropen mit Recht als gefährlich verschrien, aber eben wegen der Krankheiten, die man dort bekommen konnte – und wegen des vielen Whiskys, mit dem man den Durst löschen und die Krankheiten ausbrennen wollte. Heute ist das anders. Gegen die Krankheiten kann man sich mit Hilfe vieler vorbeugender und heilender Mittel schützen, das Klima selbst ist nach wie vor weder gesund noch ungesund. Auf alle Fälle lebt es sich in zivilisierten Gegenden gefährlicher als im Regenwald.
Viele Europäer sind auch der Meinung, daß man des Klimas wegen in den Tropen weniger arbeiten könne als bei uns. Ich habe das nie einsehen können. Wenn die Europäer allerdings, wie es leider meist geschieht, in ihren für gemäßigte Klimagegenden, nicht aber für die Tropen geeigneten Kleidern arbeiten, dann kann man schon verstehen, warum sie schnell ermüden. Zwischen Haut und Kleidung sammelt sich Schweiß an, der nicht verdunsten und den Körper abkühlen kann. Die Folge ist schnelle Ermüdung.
Als ich während meines früheren Aufenthaltes in Liberia nach den Dienststunden im Krankenhaus bis spät in die Nacht hinein noch an meinem Einbaum arbeitete, hatte ich nur kurze Hosen an, kein Hemd – also ganz wie die Afrikaner. Wenn sich jetzt aber die jungen Staaten Afrikas nach der europäischen Mode kleiden, dann brauchen sie täglich mehrere Stunden, um sich vom Tragen dieser unzweckmäßigen Kleidung zu erholen.
In Liberia hatte ich damals an mehreren Gesellschaften teilgenommen, auf denen es vorgeschrieben war, einen Frack zu tragen. Was für eine Qual in diesem feuchten Treibhausklima! Wie häufig haben sich die Gäste die Stirn trocknen müssen! Und wie häufig sind Schweißtropfen ins Essen gefallen! Noch schlimmer wurde es, wenn der Tanz begann! Und Liberianer tanzen ebenso leidenschaftlich wie sie „palavern“, allen voran der Präsident, den ich nicht nur einmal Arme und Beine durcheinanderwirbeln sah. Bei seinem Anblick hätte ein Fremder meinen können, die Exzellenz sei früher Boogy-Woogy-Lehrer gewesen und nicht Rechtsanwalt.
Zwischen Medizin und Magie
Der angesehenste Missionar und Arzt Liberias ist zweifellos der Amerikaner Dr. George W. Harley, der zusammen mit seiner Frau seit den zwanziger Jahren im Hinterland, in Ganta, nahe der Grenze zur Republik Guinea, ein großes Hospital unterhält. Dort operiert er, versorgt seine Leprastation und bildet Afrikaner zu Krankenpflegern aus.
Viele seiner Forschungsarbeiten gelten den Stämmen seiner Umgebung. Dr. Harley glaubt, daß die ungeheure Luftfeuchtigkeit sich nicht gerade fördernd auf die Zivilisierung auswirke; er betrachtet auch die Abgeschlossenheit, in der die afrikanischen Stämme bis vor kurzem noch lebten, als einen entscheidenden Grund für die Verzögerung des Fortschritts.
In Liberia gibt es 30 verschiedene Sprachen, selbst Nachbarstämme können sich gegenseitig nicht verstehen und keine Ideen austauschen. Zudem wurden die Stämme bis vor kurzem von Zauberern und Geheimbünden beherrscht, die jeden erbarmungslos entfernten, der neue Auffassungen und Vorstellungen in die Gemeinschaft zu bringen suchte.
Auf den Eingeborenen stürzt heute mit einem Mal eine neue Welt ein, die Welt der Weißen. Innerhalb von wenigen Jahren soll er sich mit dieser Welt auseinandersetzen, soll er verstehen und nachahmen können, was ihm unverständlich ist. Normalerweise sind für einen solchen Entwicklungsprozeß Generationen nötig. Wer will es da dem Schwarzen übelnehmen, wenn er zwischen seinem Animismus und der christlichen Religion, zwischen Zauberer und Arzt unentschlossen und verwirrt hin- und herschwankt.
Wie häufig haben wir Eingeborene in unser Hospital aufgenommen, die von den Medizinmännern halb zu Tode traktiert worden waren, bevor sie in letzter Stunde zu uns europäischen Ärzten kamen. Ich habe noch eine junge Frau in Erinnerung, die mit Hilfe von Hebammen aus dem Hinterland hatte gebären sollen. Eine Hebamme hatte auf der Brust der Armen gesessen und gepreßt, eine andere ihr ins Gesicht geschlagen. Als ihre Angehörigen sie endlich zu uns brachten, waren ihre Kinnladen und Augen geschwollen, ihre Lippen aufgesprungen und blutig, an ihren Handgelenken zeigten sich Hautabschürfungen, als ob sie gefesselt gewesen war.
Gegen diese barbarischen Methoden hatte sich auch schon eine mir bekannte Liberianerin gewandt. Ellen Moore war erst durch besondere Fürsprache eines Bischofs von einer New-Yorker Hebammenausbildungsstätte aufgenommen worden – ihre Schulbildung schien gar zu kümmerlich. Aber nach kurzer Zeit schon war sie die Beste ihrer Klasse und bestand die Abschlußprüfung mit Auszeichnung. Heute arbeitet sie in einem von ihr gegründeten Entbindungsheim in Kakata und versucht, ihren Landsleuten zu helfen.
Ein Erlebnis, das typisch für die Unwissenheit und Hilflosigkeit der Afrikaner in medizinischen Fragen ist, hatte ich an einem Weihnachtsabend im Süden Liberias. Als ich von unserem Club nach dem Hospital fuhr, zeichnete sich plötzlich mitten auf der Straße, die von Pleebo zu unserer Plantage führte, eine dunkle Gruppe von Menschen ab.
Ich stieg aus dem Wagen; die Schatten wichen ehrerbietig zur Seite und gaben eine dunkle Gestalt frei, die sich auf dem Boden wand und leise stöhnte. Bei ihr lag ein Knäuel, das sich nicht rührte. Erst jetzt erkannte ich, daß es sich um eine Sturzgeburt handelte; die Frau war auf dem Wege zu unserem Spital gewesen.
Das Neugeborene fühlte sich schon kalt an. Und keiner der Umstehenden kam auf den Gedanken, ihm und der Frau zu helfen! Untätig, gaffend standen die Afrikaner da. Ich unterband und zerriß die Nabelschnur, gab dem Baby ein paar Klapse und versuchte es mit künstlicher Atmung. Tatsächlich ließen sich nach einer Weile die ersten schwachen Laute vernehmen; unter ständiger Anwendung von künstlicher Atmung brachten wir Mutter und Kind in unser Krankenhaus, wo das Kleine sich nach einigen Minuten Sauerstoffatmung endgültig fürs Leben entschied. Die Mutter wurde schon nach zwei Tagen glückstrahlend entlassen.