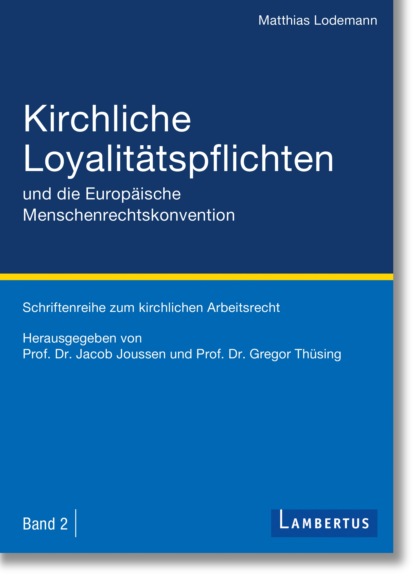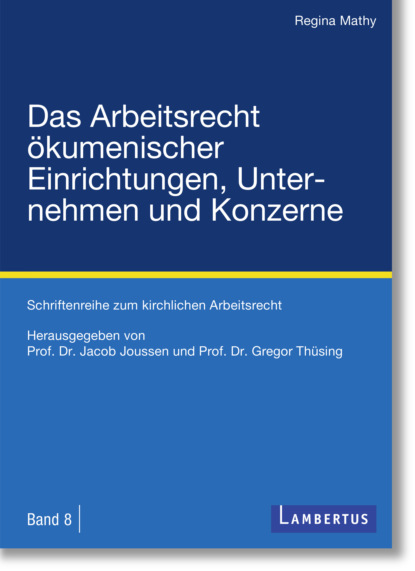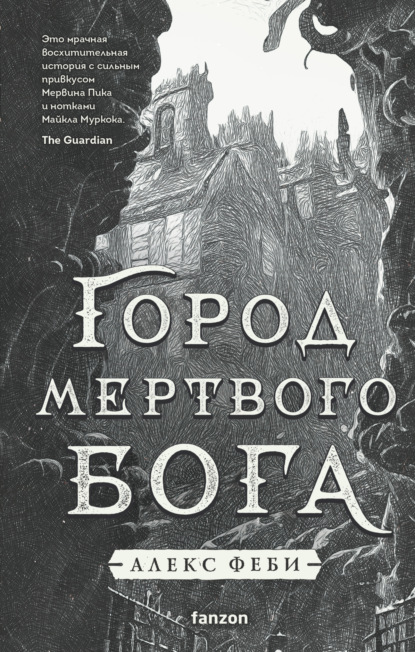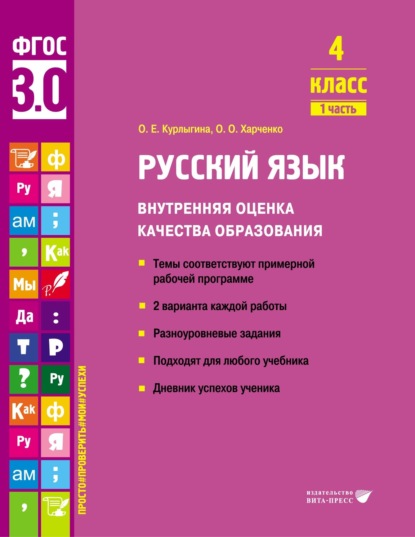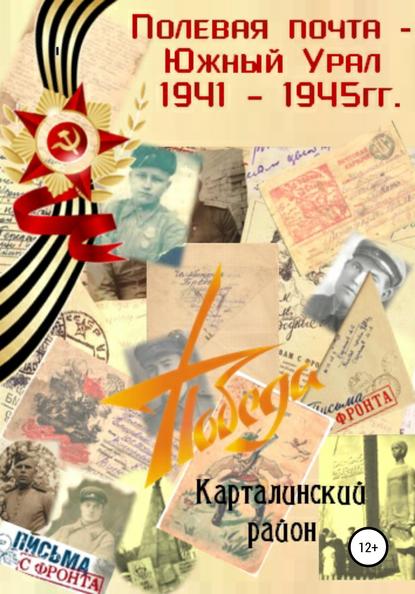Die Behandlung Schwerbehinderter im kirchlichen Arbeitsrecht der katholischen Kirche
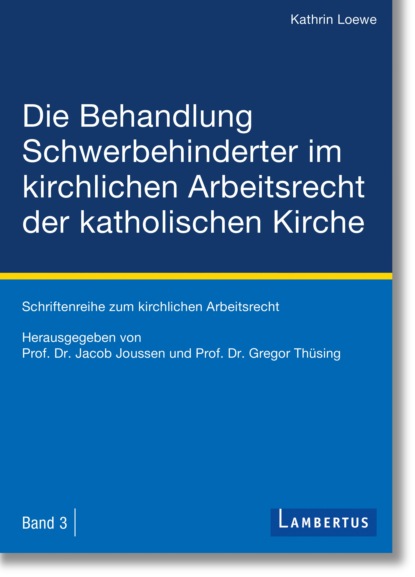
- -
- 100%
- +

Schriftenreihe zum kirchlichen Arbeitsrecht
Herausgegeben von
Prof. Dr. Jacob Joussen und
Prof. Dr. Gregor Thüsing
Band 3

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Zugl.: Dissertation, Ruhr-Universität Bochum, 2013
Alle Rechte vorbehalten
© 2014 Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau
www.lambertus.de
Umschlaggestaltung: Nathalie Kupfermann, Bollschweil
ISBN 978-3-7841-2491-9
ebook ISBN 978-3-7841-3451-2
Meinen Eltern
Vorwort
Die Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum als Dissertation angenommen. Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur sind bis März 2013 berücksichtigt. Die mündliche Prüfung fand am 26. September 2013 statt.
Bedanken möchte ich mich vor allem bei Herrn Prof. Dr. Jacob Joussen für die Betreuung dieser Arbeit und seine umfassende Unterstützung sowie die Aufnahme in seine Schriftenreihe. Darüber hinaus gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. Stefan Huster für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens.
Zu Dank verpflichtet bin ich auch dem Erzbischöflichen Ordinariat München, vor allem dem Ordinariatsrat Martin Floß, Frau Sonja Büttner und Frau Carola Bielmeier, die mich alle drei mit Gesprächen und der Bereitstellung von Unterlagen tatkräftig bei der Erstellung der Arbeit unterstützt haben. Bedanken möchte ich mich zudem bei Herrn Dr. Martin Fuhrmann, Leiter der Geschäftsstelle des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofs, der mir ebenfalls die Einsichtnahme in diverse Unterlagen ermöglicht hat.
Meiner Freundin Dr. Gesche Goldhammer danke ich für ihren juristischen Beistand in zahlreichen Telefonaten. Von Herzen möchte ich besonders meinem Mann, Patrick Loewe, danken, der mir immer zur Seite steht und mir bei allem so geduldig geholfen hat.
Mein ganz besonderer Dank gilt meinen Eltern, Christine und Jürgen Müller, denen ich die Arbeit widme. Sie haben mich bei all meinen Vorhaben, insbesondere während meines gesamten Studiums und der Promotionszeit, stets uneingeschränkt und aufopferungsvoll unterstützt und mit vielen persönlichen Gesprächen und Ratschlägen in meinem Tun bestärkt. Ohne sie wäre die Arbeit nicht möglich gewesen. Euer Rückhalt ist für mich immer von ganz besonderer Bedeutung.
München, im Dezember 2013
Kathrin Loewe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
Teil IVerhältnis des kirchlichen Arbeitsrechts zum staatlichen Schwerbehindertenarbeitsrecht
KAPITEL IVERHÄLTNIS DES KIRCHLICHEN SELBST-BESTIMMUNGSRECHTS ZUM ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN ARBEITSSCHUTZRECHT
A.Kirchliches Selbstbestimmungsrecht
I.Inkorporation der Weimarer Kirchenartikel
II.Inhalt des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts
1.„Ordnen und Verwalten“
2.„Eigene Angelegenheiten“
a.Allgemeines
b.Kirchliches Dienst- und Arbeitsrecht als „eigene Angelegenheit“
III.Schranken des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts
1.Ansatz von Johannes Heckel
2.Bereichslehre und „Jedermann-Formel“
3.Wechselwirkungs- und Abwägungslehre
B.Staatliches Arbeitsschutzrecht
I.Arbeitsschutzrecht
1.Geschichtliche Entwicklung und Gegenstand des Arbeitsschutzrechts
2.Rechtliche Gliederung des Arbeitsschutzrechts
a.Verfassungsrechtliche Grundlagen
b.Dualer Aufbau
c.Ergänzende betriebliche Ebene
II.SGB IX als Arbeitsschutzrecht
1.Entstehung des SGB IX
2.Verfassungsrechtliche Verankerung
a.Sozialstaatsgebot nach Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 GG
b.Benachteiligungsverbot nach Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG
C.Öffentlich-rechtliches Arbeitsschutzrecht als Schranke des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts
I.Geltung des staatlichen Arbeitsrechts im kirchlichen Bereich
1.Entwicklung in Literatur und Rechtsprechung
2.Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 04.06.1985
3.Kirchliche Dienstgemeinschaft und Offenhalten eines eigenen Weges
II.Kein Verfassungsrang des Arbeitsschutzrechts
III.Bindung an öffentlich-rechtliche Arbeitsschutz-Vorschriften
1.Staatliche Regelungen als Grenzen der Privatautonomie
2.Bindung im kirchlichen Bereich
IV.Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen im Rahmen der Durchführung von Arbeitsschutz-Vorschriften
1.Staatliche Mitbestimmungsregelungen im Allgemeinen
a.Diskrepanz der Interessen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber
b.Staatliche Regelung der betrieblichen Mitbestimmung aufgrund staatlicher Wertentscheidung
2.Mitbestimmungsrechtliche Regelungen in staatlichen Arbeitsschutz-Vorschriften
3.Veranschaulichung des Verhältnisses mitbestimmungsrechtlicher staatlicher Regelungen zum kirchlichen Selbstbestimmungsrecht anhand des BetrVG
a.Geschichtliche Entwicklung
b.Freistellung der Religionsgemeinschaften von der Anwendbarkeit des BetrVG nach § 118 Abs. 2 BetrVG
c.Gerechtfertigte Ungleichbehandlung im kirchlichen Bereich
d.Eigenständige Regelung der Kirche
e.Fazit
V.Fazit
KAPITEL II VERHÄLTNIS DES KIRCHLICHEN SELBSTBESTIMMUNGSRECHTS ZUM SGB IX
A.Geltung des SGB IX im kirchlichen Bereich
B.Anwendbarkeit mitbestimmungsrechtlicher Regelungen des SGB IX im kirchlichen Bereich
I.Eigenständiges kirchliches Mitbestimmungsrecht
1.Frühere Ansicht: Kirchliches Mitbestimmungsrecht aufgrund vom Staat verliehener Autonomie
2.Kirchliches Mitbestimmungsrecht beruht auf Selbstbestimmungsrecht
II.Freistellung von der Anwendbarkeit der mitbestimmungsrechtlichen SGB IX-Vorschriften
1.Keine abschließende Aufzählung in § 93 SGB IX
2.Beruhen auf dem Selbstbestimmungsrecht gem. Art. 137 Abs. 3 WRV i.V.m. Art. 140 GG
3.Urteil des Arbeitsgerichts München vom 07.07.2009
4.Berücksichtigung des § 1 Abs. 4 ArbSchG
a.Keine direkte funktionale Vergleichbarkeit der Regelungen
b.Kein rechtswidriger Eingriff in das kirchliche Selbstbestimmungsrecht durch § 1 Abs. 4 ArbSchG
c.Regelung des staatlichen Gesetzgebers aufgrund Gemeinschaftsrecht
d.Fazit
5.Fazit
III.Reichweite der Freistellung von der Anwendbarkeit des BetrVG
1.Parallele zur Freistellungsvorschrift des § 118 Abs. 2 BetrVG
2.Problem bei fehlenden Regelungen in der Rahmen-MAVO
a.Vollständige Freistellung
b.Partielle Freistellung
3.Anwendbarkeit der Vorschriften zur Schwerbehindertenvertretung im SGB IX
4.Fazit
IV.Fazit
Teil IIDie Behandlung Schwer-behinderter im kirchlichen Arbeitsrecht der katholischen Kirche
KAPITEL IARBEITGEBERPFLICHTEN NACH DEM SGB IX IM KIRCHLICHEN BEREICH
A.Pflichten der Arbeitgeber nach dem SGB IX im Zusammenhang mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
I.Rechtliche Ausgangslage für die Kirche
II.Pflichten nach §§ 80 und 81 Abs. 1 SGB IX
1.Verzeichnis- und Prüfpflicht des Arbeitgebers nach dem SGB IX
2.Anwendbarkeit im kirchlichen Bereich
III.Benachteiligungsverbot bei der Einstellung nach § 81 Abs. 2 SGB IX
1.Regelungen im SGB IX und AGG
2.Anwendbarkeit im kirchlichen Bereich
IV.Beschäftigungspflicht nach § 71 ff. SGB IX
1.Regelung des SGB IX
2.Anwendbarkeit im kirchlichen Bereich
V.Fazit
B.Besonderer Kündigungsschutz nach dem SGB IX
I.Allgemeiner Kündigungsschutz im kirchlichen Bereich
1.Kirchlicher Maßstab für die Beurteilung eines Kündigungsgrundes
a.BVerfG vom 04.06.1985
b.Katholische Grundordnung
2.Rechtsprechung des EGMR
3.Auswirkungen auf das kirchliche Arbeitsrecht in Deutschland
4.Neuere staatliche Rechtsprechung
II.Besonderer Kündigungsschutz des §§ 85ff. SGB IX im kirchlichen Bereich
1.Verfahren im staatlichen Recht
a.Ordentliche Kündigung
b.Außerordentliche Kündigung
c.Ausnahmen vom besonderen Kündigungsschutz nach § 90 SGB IX
2.Anwendbarkeit im kirchlichen Bereich
a.Zustimmungsvorbehalt des Integrationsamts
b.Stellungnahme der Interessenvertretungen
KAPITEL II KOLLEKTIVE INTERESSENVERTRETUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER BEHANDLUNG VON SCHWERBEHINDERTEN MITARBEITERN
A.Mitarbeitervertretung
I.Aufgaben
1.Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit
2.Grundsätze für die Behandlung der Mitarbeiter
3.Allgemeine Aufgaben und Aufgaben im Zusammenhang mit der Behandlung schwerbehinderter Menschen
a.§ 26 Abs. 3 Nr. 3 Rahmen-MAVO
b.§ 26 Abs. 3 Nr. 5 Rahmen-MAVO
c.§ 28a Abs. 1 Rahmen-MAVO
II.Rechte gegenüber dem Dienstgeber
1.Informationsrechte der Mitarbeitervertretung
2.Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretung
a.Mitwirkungsrechte
b.Mitbestimmungsrechte
III.Dienstvereinbarungen
B.Schwerbehindertenvertretung
I.Anwendbarkeit der SGB IX-Vorschriften zur Schwerbehindertenvertretung
1.Entwicklungen der Rechtsprechung
2.Rahmen-MAVO Novellierung vom 22.11.2010
3.Fazit
II.Bildung der Schwerbehindertenvertretung
1.Schwerbehindertenvertretung als Betriebsverfassungsorgan
2.Pflicht zur Bildung
3.Wahl der Schwerbehindertenvertretung
4.Örtliche Zusammenfassung gem. § 94 Abs. 1 S. 4 SGB IX
5.Gemeinsame Schwerbehindertenvertretung
III.Persönliche Rechtsstellung der Schwerbehindertenvertretung
1.Ehrenamt
2.Verbot der Behinderung, Begünstigung oder Benachteiligung
a.Behinderungsverbot
b.Benachteiligungsverbot
c.Begünstigungsverbot
3.Kündigungsschutz
4.Versetzungsschutz
5.Freistellung und Befreiung
a.Freistellung wegen Amtsaufgaben
b.Freistellung wegen Schulungsveranstaltungen
6.Geheimhaltungspflicht
7.Fazit
IV.Aufgaben und Rechte der Schwerbehindertenvertretung
1.Aufgaben und Rechte gegenüber der Mitarbeitervertretung nach § 52 Rahmen-MAVO
a.Teilnahme- und Stimmrecht
b.Aussetzungsrecht
2.Aufgaben und Rechte gegenüber dem Dienstgeber
a.Unterrichtungspflicht des Dienstgebers und Aussetzungsrecht
b.Informationspflicht des Dienstgebers
c.Beteiligungsrechte nach § 28a Rahmen-MAVO
3.Sonstige Rechte gem. § 52 Abs. 3 und 4 Rahmen-MAVO
4.Fazit
KAPITEL III BETEILIGUNGSRECHTE DER KOLLEKTIVEN INTERESSENVERTRETUNGEN
A.Untersuchungsansatz
B.Beteiligung bei Einstellung und Versetzung
I.Unterrichtungsansprüche der Interessenvertretungen entsprechend § 80 Abs. 2 SGB IX
1.§ 27 Abs. 2, 6. Spiegelstrich Rahmen-MAVO
2.§ 34 Abs. 3 S. 2 Rahmen-MAVO
3.§ 52 Abs. 2 S. 1 Rahmen-MAVO
II.Beteiligungsanspruch entsprechend § 81 Abs. 1 SGB IX und § 95 Abs. 2 S. 3 SGB IX
1.Schwerbehindertenvertretung
2.Mitarbeitervertretung
a.Unterrichtungsanspruch entsprechend § 81 Abs. 1 S. 4 SGB IX
b.Erörterungsanspruch entsprechend § 81 Abs. 1 S. 7 SGB IX
c.Anhörungsanspruch entsprechend § 81 Abs. 1 S. 6 SGB IX
III.Zustimmungsverweigerungsrecht der Mitarbeitervertretung bei Einstellung
1.Allgemeines zur Regelung in der Rahmen-MAVO
2.§ 34 Abs. 2 Nr. 1 Rahmen-MAVO
IV.Zustimmungsverweigerungsrecht der Mitarbeitervertretung bei Versetzung
1.Rechtsansicht des Hessischen Landesarbeitsgerichts
2.Beschluss des BAG vom 17.06.2008
V.Fazit
C.Beteiligung bei Kündigung
I.Beteiligung der Interessenvertretungen bei Kündigungen
1.Beteiligung der Mitarbeitervertretung
2.Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung
II.Fazit
D.Beteiligung bei Integrationsvereinbarungen
I.Allgemeines zu Integrationsvereinbarungen nach dem SGB IX
1.Wesensmerkmale und Rechtsnatur
2.Abschlusszwang des Arbeitgebers
3.Regelungsinhalte
II.Integrationsvereinbarungen nach § 28a Abs. 2 Rahmen-MAVO
1.Eigenständige kirchliche Regelung
2.Voraussetzungen nach § 28a Abs. 2 Rahmen-MAVO
3.Vergleichbarkeit des § 28a Abs. 2 Rahmen-MAVO mit der staatlichen Regelung
4.Beispiele für Integrationsvereinbarungen in der Praxis
III.Fazit
E.Beteiligung bei der Prävention entsprechend § 84 Abs. 1 SGB IX
I.Allgemeines zur Prävention gem. § 84 Abs. 1 SGB IX
1.Ziel der Vorschrift
2.Auslöser des Verfahrens
3.Einleitung des Verfahrens
4.Beteiligung der Interessenvertretungen
5.Rechtsfolge bei Unterlassung
II.Prävention gem. § 28a Abs. 3 Rahmen-MAVO
1.Eigenständige kirchliche Regelung
2.Voraussetzungen nach § 28a Abs. 3 Rahmen-MAVO
3.Beispiel einer Dienstvereinbarung
III.Fazit
F.Beteiligung beim Betrieblichen Eingliederungsmanagement
I.Allgemeines zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs. 2 SGB IX
1.Entstehungsgeschichte nach staatlichem Recht
2.Wesensmerkmale und Rechtsfragen
a.Zielsetzung und Anforderungen
b.Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich
c.Zustimmung des betroffenen Arbeitnehmers
d.Beteiligung der Interessenvertretungen
e.Rechtsfolgen bei unzureichendem oder fehlendem Betrieblichem Eingliederungsmanagement
II.Betriebliches Eingliederungsmanagement in der Rahmen-MAVO
1.Keine dem § 84 Abs. 2 SGB IX entsprechende Regelung
2.Anwendbarkeit auf Betriebe ohne bestehende Interessenvertretung bzw. ohne nach § 93 SGB IX bestehende Interessenvertretungen
3.Beteiligung der Interessenvertretungen nach allgemeineren Rahmen-MAVO-Vorschriften
a.§ 28a Abs. 3 und ggf. § 26 Abs. 3a Rahmen-MAVO
b.Beteiligung der Mitarbeitervertretung nach § 26 Abs. 3 Nr. 3 und 7 Rahmen-MAVO
c.Beteiligung über Mitbestimmungsrecht entsprechend § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
d.Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung gem. § 52 SGB IX
e.Fazit
f.Andere Ansicht: Von Rahmen-MAVO nicht umfasst
III.Beispiel zur Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements im kirchlichen Bereich
IV.Fazit
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Anhang:Dienstvereinbarung zur Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) im Zuständigkeitsbereich der Mitarbeitervertretung Erzbischöfliches Ordinariat München
EINLEITUNG
Am 31.12.2009 lebten in Deutschland insgesamt 7,1 Millionen schwerbehinderte Menschen.1 Als grundrechtlich garantierter Sozialstaat strebt Deutschland in seinem Handeln stets soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit an, um die Teilnahme aller an den gesellschaftlichen Entwicklungen zu gewährleisten. Schon aus dieser Staatszielbestimmung sowie aus dem in Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG verankerten Benachteiligungsverbot behinderter Menschen ergibt sich für den Staat die Aufgabe, die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe Schwerbehinderter am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Schwerbehinderte Menschen unterliegen deshalb vor allem im Arbeitsleben, einem sehr wichtigen Baustein unseres gesellschaftlichen Lebens, einem speziellen Schutz. Dieser Schutz ist im 9. Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB IX) verankert und ist Teil des sozialen Arbeitsschutzrechts. Darin sind beispielsweise spezielle Pflichten für die Arbeitgeber festgelegt, wie etwa die angemessene Beschäftigung und Förderung von schwerbehinderten Arbeitnehmern zur optimalen Weiterentwicklung ihrer Kenntnisse, gem.§ 81 Abs. 4 S.1 Nr. 1 SGB IX.2 Auch eine eigene Interessenvertretung, die Schwerbehindertenvertretung sowie verschiedene kollektive Mechanismen, die die innerbetriebliche Mitbestimmung betreffen, sind vorgesehen. Insgesamt haben schwerbehinderte Menschen somit in arbeitsrechtlicher Hinsicht eine gewisse „Sonderrolle“ inne.
Einer der größten Arbeitgeber Deutschlands ist die verfasste Kirche und ihre Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie. Bereits 2005 wurde die Zahl der in der Kirche und ihren Einrichtungen Beschäftigten auf insgesamt 1,83 Millionen geschätzt – Tendenz steigend.3 Aufgrund ihres verfassungsrechtlich gewährleisteten Selbstbestimmungsrechts spielt auch die Kirche selbst in rechtlicher Hinsicht eine gewisse „Sonderrolle“.4 Dieses Recht findet seine Grundlage in Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung (WRV), der durch Art. 140 GG in das Grundgesetz inkorporiert ist und dadurch bis heute seine Gültigkeit behalten hat.
Danach kann die Kirche ihre „eigenen Angelegenheiten“ selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes regeln. Sie hat deshalb auch das Recht, eigene Regelungen in Bezug auf das Arbeitsrecht zu setzen.5 Man spricht dabei auch von einer arbeitsrechtlichen Regelungs-autonomie.6 Anhand dieser Besonderheiten wird die religiöse Intention der Kirche im Sinne ihres Selbstverständnisses sichergestellt.7
Im kollektivarbeitsrechtlichen Bereich hat die Kirche auf der Basis des Selbstbestimmungsrechts gem. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV großteils eigene Regelungen geschaffen, wie etwa im Rahmen der innerbetrieblichen Mitbestimmung die Rahmen-MAVO. Das staatliche Betriebsverfassungsgesetz ist nach § 118 Abs. 2 BetrVG auf Religions-gemeinschaften nicht anwendbar.8 Hat sich die Kirche auf individualrechtlicher Ebene bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses der Privatautonomie bedient, so gelten auch für sie die Bestimmungen des weltlichen Arbeitsrechts. Allerdings sind diese für die Kirche im Lichte des Selbstbestimmungsrechts auszulegen. Den Kirchen ist also im Bereich des Arbeitsrechts ein eigener Weg zur Gestaltung des kirchlichen Dienstes und seiner arbeitsrechtlichen Ordnung in der von ihrem Selbstverständnis gebotenen Form offenzuhalten.9 Sie sind dabei aber an die Schranken des für alle geltenden Gesetzes i.S.v. Art. 137 Abs. 3 WRV gebunden, die sich in den Grundprinzipien der Rechtsordnung, dem Willkürverbot, den guten Sitten, dem „ordre public“ sowie eben den Arbeitsschutzgesetzen konkretisieren.10
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie in der Kirche, als bedeutendem Arbeitgeber in Deutschland der Schutz und die gleichberechtigte Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gewährleistet werden. Welche Regelungen sind anwendbar, vor allem im kollektivarbeitsrechtlichen Bereich, wenn beide rechtlichen „Sonderrollen“ in der Arbeitswelt aufeinander treffen, also schwerbehinderte Menschen als Arbeitnehmer und die Kirche als Arbeitgeber? Kann es sein, dass hier eine Geltung des SGB IX als öffentlich-rechtliches Arbeitsschutzrecht in allen Bereichen des kirchlichen Arbeitsrechts – auch im kollektivarbeitsrechtlichen Bereich – erfolgen muss und aus Sicht der jeweiligen Interessenvertretungen sogar vorteilhaft wäre? Oder kann die Kirche hier eigene Regelungen setzen? Sind entsprechende kirchliche Bestimmungen – vor allem im kollektivrechtlichen Bereich – auch ausreichend vorhanden oder überwiegen diese die staatlichen Regelungen gar in ihrer Reichweite? Es gilt also in dieser Arbeit zu klären, ob das SGB IX als staatliches Arbeitsschutzrecht auch im kirchlichen Bereich umfassend Anwendung findet und somit insgesamt ein für alle geltendes Gesetz im Sinne des Art. 137 Abs. 3 WRV ist, oder ob die Kirche von der Anwendbarkeit insbesondere hinsichtlich kollektivrechtlicher Regelungen freigestellt ist bzw. inwieweit das SGB IX Auswirkungen auf den kirchlichen Bereich hat. Im Zuge dessen ist darzulegen, ob der kirchliche Gesetzgeber eigene kollektivrechtliche Regelungen in Bezug auf die Behandlung Schwerbehinderter geschaffen hat und wenn ja, wie diese ausgestaltet sind und inwiefern sie dieselben Tatbestände wie staatliche Regelungen abdecken. Gegebenenfalls können an manchen Stellen Rechtslücken im kirchlichen Bereich festgestellt und infolgedessen Anregungen für weitere Regelungen gegeben werden.
Die Arbeit gliedert sich insgesamt in zwei Teile:
In Teil I wird das Verhältnis des kirchlichen Arbeitsrechts zum staatlichen Schwerbehindertenarbeitsrecht als Teil des öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzes beleuchtet. Dazu wird zuerst die Geltung des öffentlichrechtlichen Arbeitsschutzrechts im kirchlichen Bereich und die Freistellung der Kirche von der Anwendbarkeit des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) mit seinen mitbestimmungs-rechtlichen Regelungen analysiert. Anschließend wird die Anwendbarkeit des SGB IX als Teil des sozialen Arbeitsschutzrechts im kirchlichen Bereich untersucht. Insbesondere wird geprüft, ob die mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften des SGB IX im kirchlichen Bereich grundsätzlich Anwendung finden oder ob auch in Bezug auf diese Regelungen eine Freistellung anzunehmen ist - entsprechend der Freistellung im BetrVG.