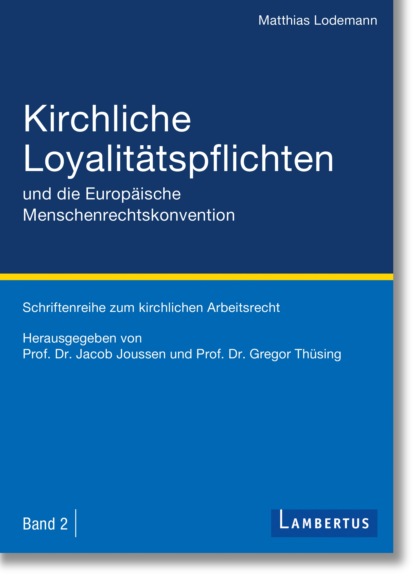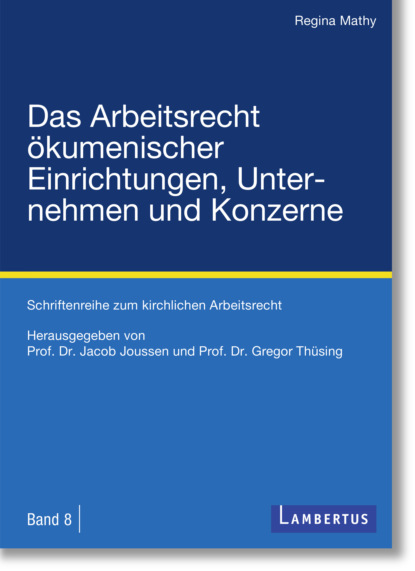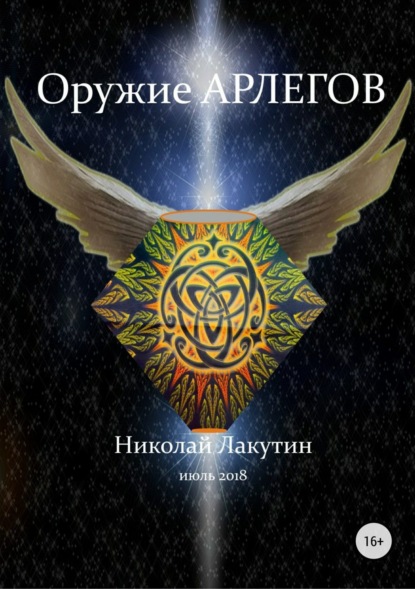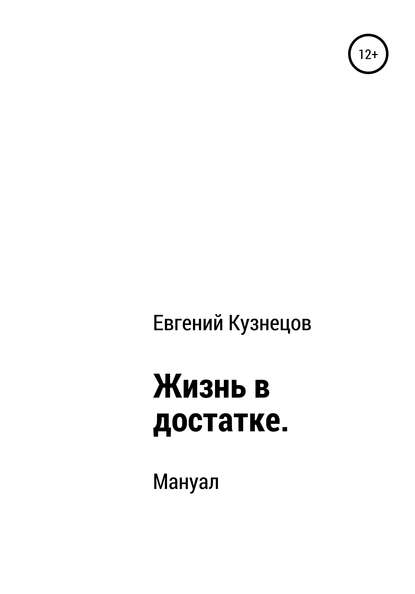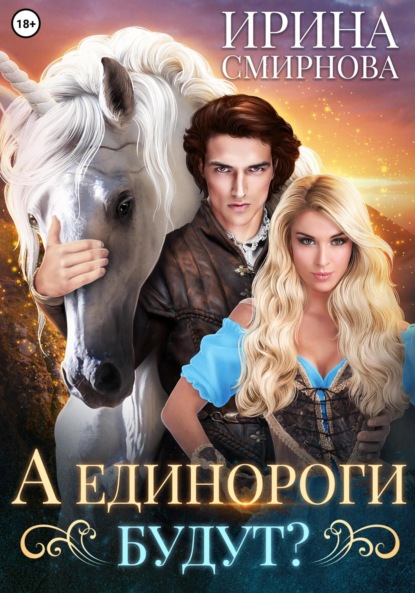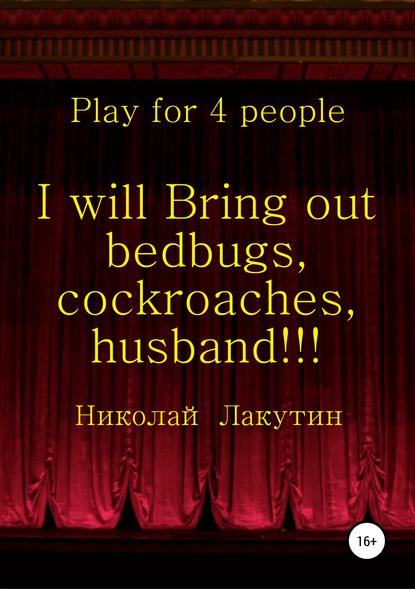Die Behandlung Schwerbehinderter im kirchlichen Arbeitsrecht der katholischen Kirche
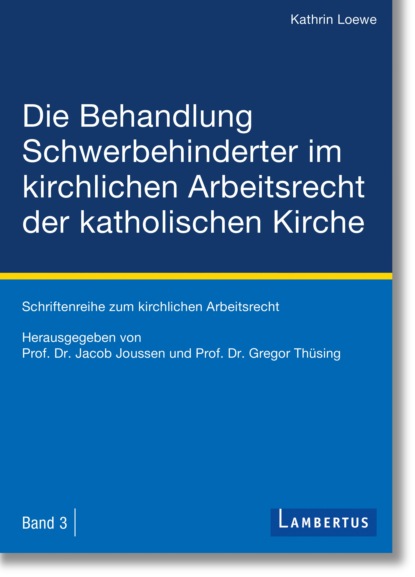
- -
- 100%
- +
In Teil II der Arbeit wird dann die konkrete Behandlung schwerbehinderter Menschen im kirchlichen Bereich dargestellt. Zunächst werden individualarbeitsrechtliche Vorschriften des SGB IX und ihre Besonderheiten im kirchlichen Bereich herausgestellt. Anschließend wird geprüft, welche kollektivrechtlichen Institutionen und Mechanismen in der Kirche auf Grundlage welcher Vorschriften vorgesehen sind und inwieweit die Rechtslage insgesamt derjenigen im staatlichen Bereich entspricht bzw. inwieweit eine Freistellung von der Anwendbarkeit bestimmter SGB IX-Vorschriften anzunehmen ist. Dazu werden die einzelnen Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen im Hinblick auf die Behandlung Schwerbehinderter analysiert und damit ihre Umsetzung und Reichweite im kirchlichen Bereich veranschaulicht. Gegebenenfalls bestehende Rechtslücken im Vergleich zum staatlichen Recht werden identifiziert und es gilt, den Umgang mit solchen, möglicherweise bestehenden Lücken zu klären. Es ist ferner zu überlegen, ob und inwieweit Anregungen gegeben werden können, welche Regelungen im kirchlichen Bereich eingefügt werden sollten.
Insgesamt beschränkt sich die Arbeit auf die Erörterung der Thematik für die katholische Kirche.
1Vgl. Statistik des Statistischen Bundesamts im Statistischen Jahrbuch 2011, S. 235.
2Besgen, Schwerbehindertenrecht, Rn. 52.
3Frerk; Publik Sonderausgabe Arbeitsplatz Kirche, abgerufen unter http://gesundheitsoziales.bawue.verdi.de/tarifinfos/kirchen/data/2005-12_Sonderausg_publik.pdf, vom 16.12.2005, am 20.7.2009.
4Richardi: Arbeitsrecht in der Kirche, § 1 Rn. 16.
5BVerfG, NJW 1976, 2123.
6a. A. Hammer, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 172: dieser lehnt eine arbeitsrechtliche Regelungsautonomie der Kirche von Grund auf ab. Seiner Ansicht nach haben Religionsgemeinschaften keinen verfassungsrechtlichen Anspruch auf die Überlassung staatlichen Arbeitsrechts zur eigenen Regelung, sondern sie können Arbeitsrecht nur setzen, wenn ihnen der staatliche Gesetzgeber das aus eigenem Ermessen zur Regelung überlassen hat.
7Fischermeier, Festschrift für Richardi zum 70. Geburtstag, S. 877, 878.
8Thüsing, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 27.
9Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 2 Rn. 44.
10v. Campenhausen/de Wall, Staatskirchenrecht, S. 182.
TEIL IVERHÄLTNIS DES KIRCHLICHEN ARBEITSRECHTS ZUM STAATLICHEN SCHWERBEHINDERTENARBEITSRECHT
In diesem ersten Teil der Arbeit gilt es, das Verhältnis des kirchlichen Arbeitsrechts der katholischen Kirche zum staatlichen Schwerbehindertenarbeitsrecht des SGB IX und somit das Zusammentreffen beider „Sonderrollen“ im deutschen Recht zu untersuchen. Es ist also zu klären, ob die Normen des SGB IX insgesamt im kirchlichen Bereich grundsätzlich Anwendung finden oder ob hier kirchliche Besonderheiten zu beachten sind, die zu Abweichungen zum staatlichen Recht führen. Dazu wird zunächst in Kapitel I das Verhältnis des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts zum öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutz im Allgemeinen betrachtet und insbesondere das Verhältnis des kirchlichen Selbstverständnisses zum BetrVG mit seinen mitbestimmungsrechtlichen Regelungen veranschaulicht und geprüft. Denn auch das SGB IX ist Teil des sozialen Arbeitsschutzrechts und beinhaltet mitbestimmungsrechtliche Normen, die die Interessenvertretungen eines Betriebes in die Durchführung der Schutznormen mit einbeziehen. Welche Besonderheiten bei der Anwendbarkeit der SGB IX-Regelungen im kirchlichen Bereich bestehen – insbesondere bei mitbestimmungsrechtlichen Regelungen – bzw. ob und warum der Kirche in diesem Bereich eigene Wege offenzuhalten sind, gilt es deshalb im Anschluss in Kapitel II zu klären. Dazu können aus der in Kapitel I enthaltenen Veranschaulichung des Verhältnisses mitbestimmungs-rechtlicher Regelungen des BetrVG zum kirchlichen Selbstbestimmungsrecht Rückschlüsse auf die Anwendung mitbestimmungsrechtlicher SGB IX-Regelungen im kirchlichen Bereich gezogen werden.
Kapitel IVERHÄLTNIS DES KIRCHLICHEN SELBSTBESTIMMUNGSRECHTS ZUM ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN ARBEITSSCHUTZRECHT
Wenn die Kirchen als Arbeitgeber auftreten, müssen sie sich grundsätzlich auch an die Vorschriften des staatlichen Arbeitsrechts halten, solange sie sich bei der Begründung des jeweiligen Dienstverhältnisses der staatlichen Privatautonomie bedienen.11 Wie es zu dieser allgemeinen Geltung des staatlichen Arbeitsrechts kommt, bzw. ob und warum unter diesen Grundsatz auch die Vorschriften des öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzes fallen und diese somit auch im kirchlichen Bereich Anwendung finden, ist in diesem Kapitel zu klären. Dazu werden zunächst der historische Ursprung sowie die Grundlagen und Schranken des verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften in Gliederungspunkt A dargestellt. Danach gilt es, die Entstehung und verfassungsrechtlichen Grundlagen des staatlichen Arbeitsschutzrechts im Allgemeinen sowie des SGB IX als Teil des sozialen Arbeitsschutzrechts vorzustellen. Unter Gliederungspunkt C wird dann das Verhältnis beider vorangestellten Bereiche zueinander untersucht, also des öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzrechts zum kirchlichen Selbstbestimmungsrecht. Dabei wird ein besonderer Fokus auf mitbestimmungsrechtliche, staatliche Regelungen und ihre Anwendbarkeit im kirchlichen Bereich gelegt, was anhand der Anwendbarkeit des BetrVG ausführlich behandelt wird.
A.Kirchliches Selbstbestimmungsrecht
Der Staat hat sein Verhältnis zu den Kirchen durch die Rezeption der Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung in Art. 140 GG bestimmt.12 Als Selbstbestimmungsrecht wird danach das Recht der Religionsgesellschaften bezeichnet, ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten gem. Art. 137 Abs. 3 WRV. Träger dieses Selbstbestimmungsrechts sind alle Religionsgesellschaften ohne Rücksicht darauf, ob sie die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts genießen, privatrechtliche Vereine sind oder der Rechtsfähigkeit überhaupt entbehren.13 In der in Art. 137 Abs. 3 WRV verankerten Gewährleistung des Staates, die Kirche dürfe ihre eigenen Angelegenheiten selbständig regeln, steckt im Kern die Zusage des staatlichen Gesetzgebers, dass er die Regelungszuständigkeit der Gesetzgeber der Religionsgemeinschaften für diese Bereiche anerkennt. Diese Anerkennung der Eigenständigkeit bedeutet im Umkehrschluss die Einsicht, dass der staatliche Gesetzgeber selbst in diesem Zusammenhang auf die Regelung weltlicher Bereiche beschränkt ist.14 Religionsgemeinschaften sind deshalb Institutionen, die vom Staat unabhängig sind und „ihre Gewalt nicht von ihm herleiten“.15
Bezieht sich die Kirche in ihrer Eigenschaft als Religionsgemeinschaft auf Art. 137 Abs. 3 WRV, so unterfallen auch ihre rechtlich selbständigen Untergliederungen dem Selbstbestimmungsrecht. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts umfasst es insgesamt „alle der Kirche in bestimmter Weise zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, […] wenn sie nach kirchlichem Selbstverständnis ihrem Zweck oder ihrer Aufgabe entsprechend berufen sind, ein Stück des Auftrags der Kirche in dieser Welt wahrzunehmen und zu erfüllen.“16 Somit sind vom Schutzbereich des Selbstbestimmungsrechts der evangelischen und katholischen Kirchen auch die Diakonie und die Caritas umfasst.
Im Folgenden soll die historische Entwicklung des heutigen, verfassungsrechtlichen Selbstbestimmungsrecht der Kirchen veranschaulicht werden und auf seine Inhalte und Schranken eingegangen werden.
I.Inkorporation der Weimarer Kirchenartikel
Wichtige Grundlage des heutigen Staatskirchenrechts ist die Inkorporation der Weimarer Kirchenartikel in das Grundgesetz. Diese hatten zu Zeiten der Weimarer Reichsverfassung zu einer entscheidenden Wendung im Staat-Kirche-Verhältnis geführt.
Obwohl der Trennungsgedanke zwischen dem „Geistlichen“ und dem „Weltlichen“ schon immer zum Kernbestand christlichen Gedankenguts gehörte und das Christentum in Deutschland seit etwa der Spätantike dominierte17, herrschte in Deutschland jahrhundertelang eine enge Verbindung von Staat und Kirche. Die Existenz des Kirchenstaates und des Verwobenseins der Kirche in das politische Ordnungs- und Herrschaftssystem des Staates, wie zu Zeiten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, blieb in mal mehr und mal weniger ausgeprägter Form weitgehend erhalten.18 Erst im 19. Jahrhundert begann ein Prozess der zunehmenden Lockerung dieses Verhältnisses - „trotz mancher heftiger Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche nicht in der Tendenz feindschaftlicher Trennung, sondern wechselseitiger Zugewandtheit und Kooperation“.19 Eine in der Paulskirchenverfassung von 1849 in § 147 verankerte Kirchenautonomie, ihre Angelegenheiten selbständig zu ordnen und zu verwalten, legte den Grundstein für das heute gültige staatskirchenrechtliche System, wurde aber zu damaliger Zeit nicht in Kraft gesetzt.20 Nach Ende des Kulturkampfes fand zumindest die Garantie der Gleichberechtigung der Konfessionen in der Bismarckschen Reichsverfassung von 1871 ihren Niederschlag. Mit dem Untergang der Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg wurden grundsätzliche Neuerungen geschaffen. Die Weimarer Verfassung von 1919 verankerte in Art. 136, 137, 138, 139 und 141 WRV die auch noch heute Geltung findenden Kirchenartikel und gab der Kirche damit vor allem Freiheit der Bewegung und des Wirkens. Smend beschreibt die Ordnung zwischen Staat und Kirche in der Weimarer Verfassung als eine Ordnung „der inneren Fremdheit, der Berührung nur noch an der beiderseitigen Peripherie, ohne Beteiligung des Wesenskerns des einen oder des anderen Partners“.21 Allerdings wird das durch die Weimarer Verfassung geschaffene Kirchensystem auch als hinkendes Trennungssystem bezeichnet22, weil es zwar einerseits die Trennung von Staat und Kirche und die Autonomie zur eigenen Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes festsetzt, andererseits den Kirchen aber weiterhin den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gibt. Daran wird letztlich erkennbar, dass die entsprechenden Artikel der Weimarer Verfassung schon damals das Ergebnis eines Kompromisses der Regierungskoaltion waren.23
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die genannten Kirchenartikel dann durch Art. 140 GG in das neue Grundgesetz vom 23.05.194924 inkorporiert. Durch die Inkorporation in Art. 140 GG sind die Weimarer Kirchenartikel Bestandteil des Grundgesetzes geworden und bilden mit ihm ein organisches Ganzes.25 Auch wenn sich die kirchenpolitischen Verhältnisse in der Nachkriegszeit grundlegend von den Verhältnissen zu Zeiten der Weimarer Nationalversammlung unterschieden, besann man sich auf die in der Weimarer Verfassung grundsätzlich bewährten Regelungen zurück – dies war teilweise wiederum einem Kompromiss der Abgeordneten geschuldet.26 In der Zeit nach 1945 konzentriert sich die Kirche verstärkt auf ihre Eigenständigkeit. Zugleich beschränkt sich der Staat auf die Ordnung des "Weltlichen“ und entlässt damit die Kirchen prinzipiell aus seiner Aufsicht und erkennt die besondere Bedeutung der Kirchen für das Leben in Staat und Gesellschaft an. Das Verhältnis von Kirche und Staat soll nun als Partnerschaft charakterisiert werden.27
II. Inhalt des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts
Das verfassungsrechtlich garantierte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen erstreckt sich gem. Art. 137 Abs. 3 WRV auf das selbständige „Ordnen“ und „Verwalten“ der „eigenen Angelegenheiten“.
1.„Ordnen und Verwalten“
Mit der Gewährleistung einer selbständigen Ordnung ist dem Staat die Einflussnahme auf die kirchliche Rechtsetzung versagt und das Inkrafttreten kirchlicher Bestimmungen ist von keiner staatlichen Genehmigung abhängig, sofern durch sie lediglich eigene Angelegenheiten der Religionsgesellschaft geregelt werden sollen.28
Dieses Recht zur selbständigen Verwaltung ist weit auszulegen und umfasst die freie Betätigung der Organe der Religionsgemeinschaften zur Verwirklichung der jeweiligen Aufgaben einschließlich des Verfahrensrechts und der Berechtigung zur eigenen Rechtsprechung. Mit einbezogen ist dabei insbesondere auch die freie Ämterbesetzung, die in Art. 137 Abs. 3 S. 2 WRV explizit erwähnt wird.29
2.„Eigene Angelegenheiten“
a.Allgemeines
Der unbestimmte Rechtsbegriff der „eigenen Angelegenheiten“ in Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV war lange Zeit umstritten.
Zu Zeiten der Weimarer Republik wurde die Ansicht vertreten, dass der Staat durch die Reichsverfassung selbst normiere, was eigene Angelegenheiten der Kirche seien bzw. die staatlichen Gerichte durch Auslegung der Reichsverfassung eine verbindliche Feststellung treffen könnten. Allerdings widerspricht diese Ansicht der in Art. 137 WRV garantierten Eigenständigkeit der Kirchen und Religionsgemeinschaften und ist deshalb abzulehnen. Die Neutralität des Staates gegenüber Kirchen und Religionsgemeinschaften wäre durch eine solche staatliche Normierung gerade nicht mehr gegeben, so dass das Grundgesetz in sich widersprüchlich ausgelegt würde.30
Nach anderer Lehrmeinung, der auch die frühere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gefolgt ist31, wurde vertreten, dass die Reichweite des Selbstbestimmungsrechts gerade nicht durch die Verfassung selbst normiert, sondern vorausgesetzt und in diesem vorausgesetzten Umfang gewährleistet werde. Eine Abgrenzung müsse nach objektiven Gesichtspunkten erfolgen. Als „eigene Angelegenheiten“ seien deshalb solche Angelegenheiten zu qualifizieren, die materiell, der Natur der Sache oder der Zweckbestimmung nach „eigene“ sind.32 Auch diese Auslegung des Begriffs der „eigenen Angelegenheiten“ erschien jedoch sehr weit gesteckt und bedurfte der weiteren Konkretisierung, nämlich wie die Natur der Sache oder Zweckbestimmung festzulegen sei.
Mittlerweile vertritt das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass maßgebend für die Qualifizierung einer Angelegenheit als „eigene“ im Sinne des Art. 137 Abs. 3 WRV Auftrag und Selbstverständnis der Kirchen und Religionsgemeinschaften sind.33 Es obliegt also den Religionsgemeinschaften darzulegen, dass eine Angelegenheit durch den kirchlichen Auftrag umschrieben ist und auf der Grundlage des kirchlichen Selbstverständnisses rechtlich gestaltet werden sollte. Die Angelegenheiten müssen einen Bezug zum Schutzbereich des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG aufweisen, da nur solche Angelegenheiten als eigene verstanden werden können, die in Verbindung zum religiösen Bekenntnis stehen und dazu dienen, die religiöse Überzeugung zu äußern. Grundsätzlich dulden staatliche Instanzen keinen Staat im Staate, denn in allen Bereichen der Gesellschaft gilt primär die staatliche Ordnung. Nur wenn Angelegenheiten betroffen sind, die als nichtstaatliche, religiöse Angelegenheiten zu qualifizieren sind und also ein Bezug zum Schutzbereich des Art. 4 GG gegeben ist, ist die Zuordnung zu den Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften auch plausibel.34 Nur durch diesen, den kirchlichen Auftrag betonenden Ansatz wird die in Art. 4 und Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV konstituierte religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates gewahrt.35 Insgesamt werden daher als eigene Angelegenheiten Lehre und Kultus, Kirchenverfassung und Organisation, Ausbildung der Geistlichen, Rechte und Pflichten der Mitglieder, Kirchenmitgliedschaft, Vermögensverwaltung, und karitative Tätigkeit verstanden.36
b.Kirchliches Dienst- und Arbeitsrecht als „eigene Angelegenheit“
Das kirchliche Dienst- und Arbeitsverhältnis gehört ebenfalls zu den eigenen Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften, denn theologische Grundlage des kirchlichen Dienstes ist der Sendungsauftrag der Kirche. Es ist kirchliche Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass zwischen kirchlicher Ordnung und dem Tun der kirchlich Bediensteten kein Zwiespalt besteht. Die Ausgestaltung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse in einer Form, in der sie mit dem kirchlichen Auftrag und den kirchlichen Besonderheiten in Einklang stehen, weist einen Bezug zum Schutzbereich des Art. 4 GG auf und ist eine eigene Angelegenheit der Kirche i.S.v. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV.37 Die Kirchen können gem. Art. 137 Abs. 3 WRV ihr Ämterwesen eigenständig regeln und zudem aufgrund des verfassungsrechtlich garantierten Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts, der in Absatz 5 des Artikels geregelt ist, Dienstverhältnisse öffentlichrechtlich begründen.38 Allerdings steht es ihnen auch frei, sich der jedermann offenstehenden Privatautonomie zu bedienen, um Dienstverhältnisse einzugehen und zu regeln.39
III.Schranken des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts
Das allgemeine Selbstbestimmungsrecht wird jedoch nicht schrankenlos gewährt, sondern unterliegt, neben den allgemeinen Schranken40, den Schranken des „für alle geltenden Gesetzes“, Art. 137 Abs. 3 WRV. Zu Zeiten der Frankfurter Reichsverfassung von 1849, an die Art. 137 Abs. 3 WRV letztlich angelehnt ist41, hat sich der Staat von jeglichem Eingriff in die gesellschaftliche Ordnung enthalten. Dagegen hat sich diese gesamtpolitische Haltung schon zu Zeiten der Weimarer Republik stark gewandelt und der Gesetzgeber war zur Gestaltung der Gesellschaft und ihrer Funktionsbereiche nach der Reichsverfassung legitimiert – insbesondere im Bereich der Arbeitsverfassung nach Art. 157 bis 165 WRV.42 Der Schrankenvorbehalt des kirchlichen Selbstbestimmungsrecht in Form des „für alle geltendes Gesetzes“ bedarf schon deshalb einer genauen Auslegung, um eine übermäßige staatliche Einmischung abwenden zu können. In welchem Umfang die Religionsgemeinschaften bei der Ordnung und Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten frei sind, hängt deshalb in großem Maße von der in der Vergangenheit viel diskutierten Definition dieser Schranken ab. Jenseits ihrer eigenen Angelegenheiten sind Religionsgemeinschaften aber dem Staat und dem staatlichen Recht genauso verpflichtet wie weltliche Organisationen.43 Die Schrankenklausel wirkt damit als Kollisionsregel: Sie beschreibt zum einen die Grenze der Regelungszuständigkeit der Religionsgemeinschaften und beschränkt zum anderen die Zuständigkeit des Staates, da nur solche Normen für die Religionsgemeinschaften bindend sein können, die für alle geltendes Gesetz sind.44
1.Ansatz von Johannes Heckel
Jahrelang hat die Rechtsprechung in der Bundesrepublik45 die Formel von Johannes Heckel angewendet, nach der ein „für alle geltendes Gesetz“ wie folgt interpretiert wurde: „Ein Gesetz, das trotz grundsätzlicher Bejahung der kirchlichen Autonomie vom Standpunkt der Gesamtnation als politische Kultur- und Rechtsgemeinschaft unentbehrliches Gesetz ist, aber auch nur ein solches Gesetz.“46 Diese Heckel’sche Formel begegnete allerdings vielen Einwänden und es wurde vorgebracht, dass sie das kirchliche Selbstbestimmungsrecht nicht zu sichern vermöge.47 Unter anderem wurde kritisiert, dass sie zu wenig präzise sei und damit praktisch kaum handhabbar. Außerdem sei die Grenzziehung in einer rational kaum nachvollziehbaren, freien Abwägung erfolgt und nicht in einem rechtlich und rational argumentierenden Prozess, um die praktische Konkordanz zwischen rivalisierenden Rechtsgütern herzustellen.48 Zudem ergibt sich aus dem Grundrecht der Glaubensfreiheit nach Art. 4 GG, dass der Staat nicht nur die Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaften akzeptiert, sondern auch ihr bekenntnismäßiges Verständnis respektiert. Der Schrankenvorbehalt gibt dem Staat auch nicht im Rahmen von Gesetzen, die die Sozialordnung festlegen, das Recht für die Religionsgemeinschaften zu entscheiden, wie sie ihren Auftrag zu erfüllen hat.49
2.Bereichslehre und „Jedermann-Formel“
Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb einen eigenen Weg zur Begriffsbestimmung der Schrankenklausel eingeschlagen. Danach dürfen die Kirchen innerhalb ihres Selbstbestimmungsbereichs nicht an das „für alle geltende Gesetz“ i.S.v. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV gebunden sein, denn dadurch würde die verfassungsrechtlich garantierte Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der kirchlichen Gewalt geschmälert werden.50 Der Bereich der rein innerkirchlichen Angelegenheit, das „forum internum“, ist daher dem staatlichen Eingriff vollständig entzogen, im Gegensatz zu Sachverhalten, die unmittelbaren Bezug zur weltlichen Rechtsordnung haben (Bereichslehre).51
Dieser Lehre ist entgegenzuhalten, dass zwischen Sachverhalten der innerkirchlichen Bereiche und solchen, die Bezug zur weltlichen Rechtsordnung haben, nicht immer scharf abgegrenzt werden kann. Schließlich können auch eigene Angelegenheiten der Kirche in den weltlichen Rechtskreis hineinwirken. Somit handelt es sich letztendlich wiederum um eine Abwägungsentscheidung. Im Grunde kommt es deshalb maßgeblich darauf an, wer diese Grenzziehung treffen darf.52
Die Bereichslehre wurde darum durch verschiedene Theorien in der Rechtsprechung modifiziert und weiterentwickelt. In der Entscheidung vom 21.09.197653 hat das Bundesverfassungsgericht seine Ansicht weiter verdeutlicht und klargestellt, dass eine Materie auch dann eine „innere kirchliche Angelegenheit“ bleibe, wenn sie mittelbare Rechtswirkungen in den staatlichen Zuständigkeitsbereich hat. In diesem Bereich kommt nur solchen Bestimmungen der Status eines „für alle geltenden Gesetzes“ zu, die für die Kirchen und Religionsgemeinschaften dieselbe Bedeutung wie für jeden anderen haben. Denn „trifft das Gesetz die Kirche nicht wie den Jedermann, sondern in ihrer Besonderheit als Kirche härter, ihr Selbstverständnis, insbesondere ihren geistig religiösen Auftrag beschränkend, also anders als den normalen Adressaten, dann bildet es insoweit keine Schranke“.54 Jedes Gesetz, das sich zwar nicht speziell gegen die Kirche wendet, sie aber härter trifft als andere, ist somit nach der so genannten „Jedermann-Formel“ nicht als „ein für alle geltendes Gesetz“ i.S.v. Art. 137 Abs. 3 WRV anzusehen. Die „Jedermann-Formel“ soll damit die Schaffung von einschränkendem Sonderrecht verhindern, das sich gegen Kirchen und Religionsgemeinschaften richtet.55 Positiv formuliert können staatliche Gesetze also nur dann die religionsgemeinschaftliche Selbstbestimmung beschränken, wenn sie für das Gemeinwesen bedeutsame Rechtsgüter beschützen. Ein für alle geltendes Gesetz im Sinne der Vorschrift ist danach ein Gesetz nur dann, wenn es „zwingenden Erfordernissen des friedlichen Zusammenlebens von Staat und Kirche in einem religiös und weltanschaulich neutralen politischen Gemeinwesen entspricht.“56
3.Wechselwirkungs- und Abwägungslehre
Die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zieht einen differenzierteren Verhältnismäßigkeitsmaßstab heran, ohne dabei jedoch von den früheren Ansätzen ausdrücklich abzurücken.57 In der grundlegenden Entscheidung vom 25.03.198058 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass insgesamt der Wechselwirkung zwischen dem selbständigen Ordnen und Verwalten der eigenen Angelegenheiten durch die Kirchen und dem staatlichen Schutz anderer Rechnung getragen werden soll. Art. 137 Abs. 3 WRV gewährleistet demnach „in Rücksicht auf das zwingende Erfordernis friedlichen Zusammenlebens von Staat und Kirchen sowohl das selbständige Ordnen und Verwalten der eigenen Angelegenheiten durch die Kirchen als auch den staatlichen Schutz anderer für das Gemeinwesen bedeutsamer Rechtsgüter“.59 Danach soll jedes Gesetz, das dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht Schranken zieht, selbst auf eine solche Schranke treffen, nämlich die materielle Wertentscheidung der Verfassung, die über einen für die Staatsgewalt unantastbaren Bereich hinaus die besondere Eigenständigkeit der Kirche gegenüber dem Staat anerkennt.60 Die das kirchliche Selbstbestimmungsrecht begrenzende Schranke ist deshalb im Wege der Güterabwägung zu ermitteln, damit die Wechselwirkung von Verfassungsgarantie und einschränkendem Gesetz gebührende Berücksichtigung findet.61 Abzuwägen ist dabei das kirchliche Selbstbestimmungsrecht mit damit kollidierenden Rechten Dritter oder sonstigen Verfassungsgütern. Zwar stellt das Selbstbestimmungsrecht des Art. 137 Abs. 3 WRV kein Grundrecht im eigentlichen Sinn dar, aber es besteht eine enge Verbindung zur Religionsfreiheit des Art. 4 GG.62 Die Wechselwirkungslehre kann somit zur Anwendung kommen und im Fall einer erforderlichen Abwägung ist das Verhältnis von Kirchenfreiheit und Schrankenzweck zu bestimmen.63 Die völlige Vernachlässigung des einen oder anderen Verfassungswerts muss vermieden werden.64