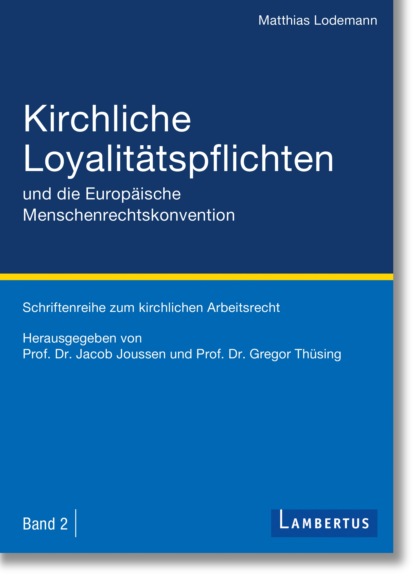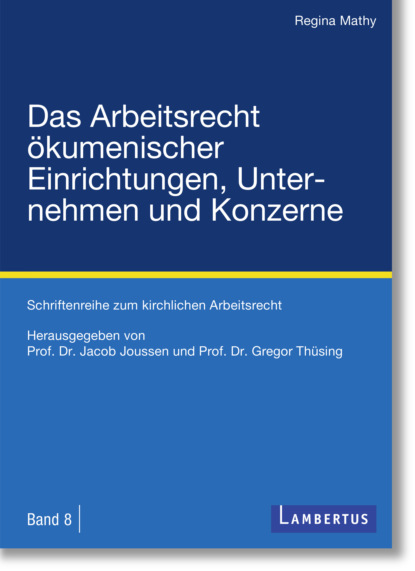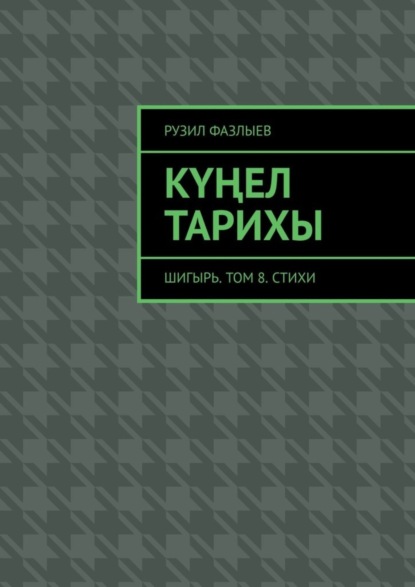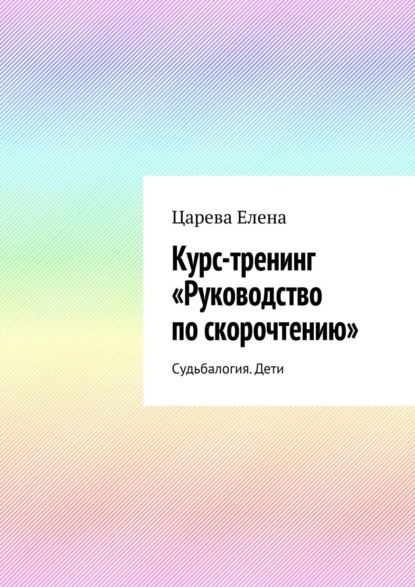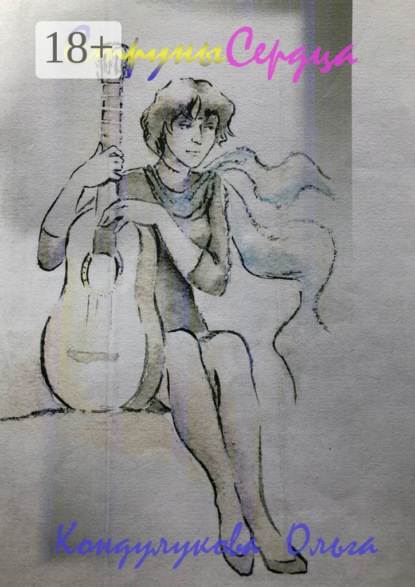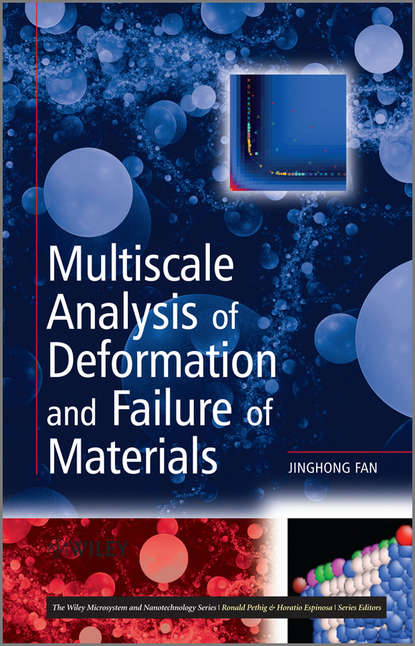Die Behandlung Schwerbehinderter im kirchlichen Arbeitsrecht der katholischen Kirche
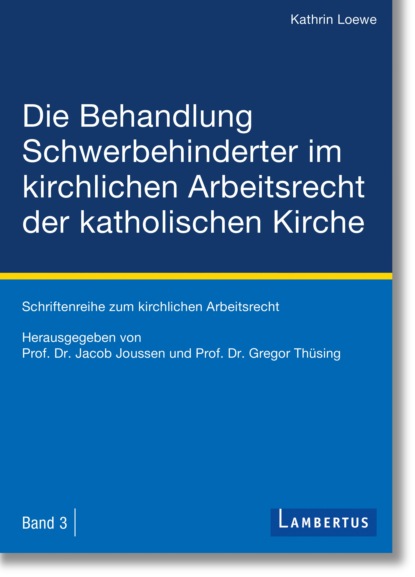
- -
- 100%
- +
Zu beachten bleibt allerdings, dass bei jeder Entscheidungsfindung die Kirchenfreiheit vor dem Hintergrund des staatskirchenrechtlichen Gesamtsystems des Grundgesetzes berücksichtigt werden muss. Offen bleibt also durch die reine Abwägungstheorie, welches Gewicht bei der Abwägung im Einzelfall dem Recht der Religionsgesellschaften auf Selbstbestimmung einzuräumen ist.65 Weder eine automatische Privilegierung der Religionsgesellschaften, noch eine Abwägung gleichberechtigter Positionen und Rechtsgüter nach Maßgabe der zu Art. 5 Abs. 2 GG entwickelten Kriterien entspräche einer vom Bundesverfassungsgericht gewollten Abwägung unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrechts der Kirchen. Letzterem, also einer Grundrechtsabwägung gleichberechtigter Positionen, erteilt das Bundesverfassungsgericht eine Absage. Bereits in seiner Entscheidung vom 21.9.197666 stellt es klar, dass bei einer Abwägung im Rahmen von Art. 137 Abs. 3 WRV dem geistig-religiösen Auftrag der Kirchen Rechnung getragen werden müsse und deshalb die Schrankenformel gerade nicht mit dem „allgemeinen Gesetz“ im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG gleichgesetzt werden könne. Weitere Entscheidungen heben ebenfalls die Bedeutung des kirchlichen Selbstverständnisses im Rahmen der Abwägung explizit hervor.67 Danach müsse bei der Begrenzung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts durch ein für alle geltendes Gesetz, dem Selbstverständnis der Kirchen ein besonderes Gewicht beizumessen sein.68 Eine besondere Rolle spielt dabei die Nähe des berührten Gebiets zum zentralen kirchlichen Auftrag. Je ausgeprägter der fragliche Sachverhalt das religiöse Zeugnis zum Ausdruck bringt, desto stärker muss der beschränkende Gesetzgeber auf das Selbstverständnis Rücksicht nehmen.69 Umgekehrt vermag das kirchliche Selbstverständnis auch in Bezug auf innere Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften einer Güterabwägung unterworfen werden, wenn eine Kollision mit staatlichen Schutzrechten vorliegt, allerdings ist dem kirchlichen Selbstverständnis im Rahmen der Abwägung hohes Gewicht beizumessen.70 Die Abwägung muss grundsätzlich auf eine Weise erfolgen, „die es gestattet, auf beiden Seiten davon auszugehen, dass staatliche Gesetze nicht den Kirchen und Religionsgemeinschaften wesentlichen eigenen Ordnungen beeinträchtigen und dass kirchliche und religionsgemeinschaftliche Gesetze nicht die für den Staat unabdingbare Ordnung kränken werden.“71 Nach den Grundsätzen der praktischen Konkordanz sind kollidierende Rechtsgüter also schonend auszugleichen.
Die dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht Schranken ziehenden Gesetze müssen damit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit standhalten und keines der beteiligten Grundrechte darf zu Lasten des anderen einseitig berücksichtigt werden.72 Insgesamt sichert die Verfassungsgarantie des Selbstbestimmungsrechts die Freiheit der Religionsgemeinschaften innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung.73
B. Staatliches Arbeitsschutzrecht
Der Bereich des Arbeitslebens wird für alle Arbeitnehmer vom staatlichen Gesetzgeber einem besonderen Schutz unterstellt: dem Arbeitsrecht. Dieses dient primär dem Schutz der abhängig Beschäftigten.74 In einem Arbeitsverhältnis wird der Arbeitnehmer vor Benachteiligungen, gesundheitlichen Gefährdungen sowie Arbeitsplatzverlust durch das Arbeitsrecht geschützt.75 Für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis gibt der staatliche Gesetzgeber ebenfalls Ziele und Maßnahmen vor. Diese bilden insgesamt das Arbeitsschutzrecht.
I.Arbeitsschutzrecht
Vor Gefahren am Arbeitsplatz stellt der Staat mit dem sogenannten Arbeitsschutzrecht einen speziellen gesetzlichen Schutz sicher und überlässt insofern die Geltendmachung von Rechten nicht allein dem abhängig Beschäftigten oder seiner Interessenvertretung. Zu diesem Arbeitsschutz im engeren Sinne gehören beispielsweise das Mutterschutzgesetz (MuSchG) und auch das SGB IX, das den Kreis der schwerbehinderten Menschen besonders schützt.76
1.Geschichtliche Entwicklung und Gegenstand des Arbeitsschutzrechts
Die Geschichte des Arbeitsschutzrechts steht in unmittelbaren Zusammenhang mit der Ende des 18. Jahrhunderts aufkommenden Industrialisierung in Deutschland. Durch sie stieg die Quote der Kinderarbeit rapide, was zu einer Gesundheitsgefährdung der Kinder und letztlich zum Anstieg der Untauglichkeitsquote von jungen Männern beim Militär führte. Es wurde daraufhin vom preußischen Staatsministerium am 09.03.1839 das „Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken“ geschaffen, das als erste Vorschrift des Arbeitsschutzrechts angesehen wird.77 Mit dem „Gesetz, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung“78 von 1891 wurden in der Gewerbeordnung, die erstmals 1869 in Kraft gesetzt worden war, die Voraussetzungen für eine schnellere Weiterentwicklung des Arbeitsschutzrechts erschaffen. Es enthielt Ermächtigungsnormen zum Erlass von Rechtsverordnungen neu bzw. verändert.79 Diese wurden in den Jahren 1893 bis 1914 auch intensiv genutzt und insgesamt 34 Arbeitsschutzvorschriften als Reichsrecht erlassen. Am 06.07.1884 trat zudem das Unfallversicherungsgesetz zur Absicherung der Geschädigten vor finanzieller Not in Kraft.80 Zur Zeit der Weimarer Republik wurde im Jahr 1928 ein umfassendes Arbeitsschutzgesetz entworfen, das allerdings aus politischen Gründen nicht verabschiedet werden konnte.81 Es blieb vorerst bei den zahlreichen Einzelvorschriften. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden bestehende Arbeitsschutzvorschriften ergänzt und abgeändert, aber auch zu einem großen Teil außer Kraft gesetzt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden diese Einschränkungen aber wieder aufgehoben und Regelungen im Bereich des sozialen Arbeitsschutzes neu gefasst, wie etwa das Mutterschutzgesetz und das Schwerbeschädigtengesetz.82 Erst ab 1968 kam es dann zu einer flächendeckenden Arbeitsschutzrechtsreform, bei der alle bestehenden Arbeitsschutzvorschriften außer Kraft gesetzt und in flächendeckende, neue Rechtsvorschriften übernommen wurden, wie etwa die Arbeitsstättenverordnung.83
Wie schon an der geschichtlichen Entwicklung erkennbar, ist das Arbeitsschutzrecht ein ungeordnetes „Konglomerat buntscheckiger Normen“84. Der staatliche Gesetzgeber hat in ihnen dem Arbeitgeber Pflichten gegenüber der Staatsgewalt auferlegt und damit im Interesse der Allgemeinheit gehandelt. Zum Arbeitsschutzrecht gehören demgemäß all diejenigen Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmerschaft, deren Einhaltung behördlich überwacht wird oder die straf- bzw. ordnungsrechtlichen Sanktionen unterliegen.85 Grundsätzlich ist das Arbeitsschutzrecht im engeren Sinn dem öffentlichen Recht zuzuordnen und umfasst Regelungen mit dem Ziel, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten, unabhängig davon, ob der betroffene Arbeitnehmer sein Recht aktiv verfolgt.86 Die Vorschriften sind zum Teil abwehrender Natur gegen mögliche Gefahren, Belastungen und Nachteile, und zum Teil soll durch sie gestaltend in die bestehende Arbeitsplatzsituation eingegriffen werden, um beispielsweise einen Arbeitsplatz oder Arbeitsabläufe möglichst menschengerecht zu machen.87 Ein entscheidender Ansatz des Arbeitsschutzes ist es, zur optimalen Zielerreichung präventionsorientiert zu handeln, um einen möglichen Schaden von vornherein zu vermeiden. Dabei gilt es nicht nur, spontane Verletzungen und plötzliche Erkrankungen zu verhüten, sondern vor allem auch Gesundheitsbeeinträchtigungen, die durch lang anhaltende Überbeanspruchung oder durch ständiges Einwirken von Arbeitsstoffen nach und nach eintreten, wie etwa Berufskrankheiten.88
2.Rechtliche Gliederung des Arbeitsschutzrechts
a.Verfassungsrechtliche Grundlagen
Die verfassungsrechtliche Grundlage des Arbeitsschutzrechts ist an Art. 1 Abs. 1 (Schutz der Menschenwürde), Art. 2 Abs. 2 (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) und Art. 20 Abs. 1 GG (Sozialstaatsprinzip) festzumachen89, da das Grundgesetz abgesehen von Art. 74 Nr. 12 GG, der die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes vorschreibt, keine Bestimmungen enthält, die sich speziell auf den Arbeitsschutz beziehen. Diese Grundrechte sind nicht nur subjektive Abwehrrechte jedes Einzelnen gegenüber dem Staat, sondern nach der Rechtsprechung des BVerfG folgt aus diesen Grundrechtsbestimmungen auch eine Verpflichtung des Gesetzgebers, Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer zu erlassen.90 Denn bei einer ungleichen Kräfteverteilung wie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen staatliche Regelungen auch im Bereich des Vertragsrechts ausgleichend eingreifen, um den Grundrechtsschutz zu sichern.91 Dies kann in Form öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Pflichten erfolgen. Staatliche Regelungen sind auch für die Privatautonomie unerlässlich, um dem sozialen und wirtschaftlichen Ungleichgewicht entgegenzuwirken und damit die Voraussetzungen für eine rechtsgeschäftliche Ordnung zu schaffen.92 Allerdings muss dieser Schutz nicht so weit gehen, dass die Arbeitswelt als risikofreie Zone gebildet werden müsste, denn so würde möglicherweise auch die gewissenhafte Nutzung der fortschrittlichen Technik schon von vornherein ausgeschlossen.93
b.Dualer Aufbau
Das öffentlich-rechtliche Arbeitsschutzrecht in Deutschland ist von seinem dualen Aufbau geprägt. Es entfällt in folgende zwei Gruppen: das staatliche Arbeitsschutzrecht und das öffentlich-rechtliche, autonome oder auch unfallversicherungsrechtliches Arbeitsschutzrecht genannt.94 Letzteres ist durch das Siebte Sozialgesetzbuch (SGB VII) geregelt und wird durch die Unfallversicherungsträger wahrgenommen. Diese sind in erster Linie Berufsgenossenschaften sowie Gemeinde- und Eigenunfallversicherungsträger.95 Aufgabe der Unfallversicherung ist es, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden bzw. nach Eintritt eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit, die Gesundheit des Betroffenen wiederherzustellen § 1 SGB VII. Der Arbeitsschutz wird hier durch mittelbare Staatstätigkeit wahrgenommen, indem der Staat die Regelungskompetenzen der Unfallversicherungsträger in diesem Bereich durch das SGB VII festgelegt hat.
Im Bereich des staatlichen Arbeitsschutzrechts schafft der Staat Gesetze und sichert ihre Einhaltung durch staatliche Ämter für Arbeitsschutz bzw. Gewerbeaufsichtsämter.96 Man unterscheidet zwischen dem technischen und dem sozialen Arbeitsschutz. Ersterer lässt sich systematisch wiederum in Vorschriften den betrieblichen Arbeitsschutz betreffend und in Regelungen einteilen, die den produktbezogenen Gefahrenschutz angehen. Wichtige Gesetze sind dabei das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), das SGB VII und das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (PSG). Der soziale Arbeitsschutz umfasst neben dem Arbeitszeitschutz nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) auch den Schutz bestimmter Personengruppen im Arbeitsleben, wie beispielsweise werdende Mütter im Mutterschutzgesetz (MuSchG), Jugendliche im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) oder eben den Schutz schwerbehinderter Menschen nach dem SGB IX.97 98
c.Ergänzende betriebliche Ebene
Das duale Arbeitsschutzsystem wird durch eine weitere Ebene, die betriebliche Ebene, ergänzt, die bei der Durchführung und Ausfüllung der Regelungen des Arbeitsschutzes eine erhebliche Rolle spielt. Sie bezieht folgende betriebliche Akteure in die Durchführung des Arbeitsschutzrechts mit ein: der jeweilige Betriebsrat bzw. Personalrat, einzelne Beschäftigte sowie die vom Arbeitgeber aufgrund öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen bestellte Personen, wie etwa Sicherheitsbeauftragte nach dem SGB VII oder Betriebsärzte nach dem ASiG.99 Letztlich führt diese Einbeziehung in die Durchführung des Arbeitsschutzrechts zu einer Dreigleisigkeit des Arbeitsschutzsystems.100 Dem Betriebsrat kommt vor allem im betrieblichen Arbeitsschutz eine zentrale Rolle zu, da ihm bei ausfüllungsbedürftigen Rahmenregelungen häufig ein Beteiligungs- oder Mitbestimmungsrecht zusteht wie etwa nach § 87 Abs. 1 BetrVG bzw. bei Vorschriften ohne arbeitgeberseitigen Gestaltungsspielraum ein Überwachungsrecht zukommt.101 Zudem ist er verpflichtet, den Arbeitsschutz im Betrieb zu fördern, § 80 Abs. 1 Nr. 9 BetrVG. Das BetrVG selbst ist somit ebenfalls Arbeitsschutzrecht102 und ist zugleich zum Bereich des kollektiven Arbeitsrechts zu zählen. Es sind außerdem in weiteren Arbeitsschutzgesetzen, außerhalb des BetrVGs, Beteiligungsrechte des Betriebsrats verankert103, wie etwa in § 10 Abs. 2 ArbSchG oder in § 84 Abs. 2 SGB IX. Auch diese Rechte dienen letztlich dazu, die Umsetzung der jeweiligen Arbeitsschutz-vorschrift individuell für den Betrieb im Interesse der Arbeitnehmer zu regeln.
II.SGB IX als Arbeitsschutzrecht
Das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) stellt insgesamt eine Verknüpfung arbeits- und sozialrechtlicher Regelungen dar.104 Erstere sind hauptsächlich in den Paragraphen 68ff. SGB IX geregelt. Es ist Teil des staatlichen, sozialen Arbeitsschutzrechts.105 Mit Hilfe dieses Gesetzes soll den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen werden, indem ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert wird. Gleichzeitig soll Benachteiligungen entgegengewirkt werden.106 Im Folgenden wird auf die Entstehungsgeschichte des Gesetzes eingegangen sowie auf seine verfassungsrechtliche Verankerung.
1.Entstehung des SGB IX
Erst am 01.07.2001 ist das neunte Buch des Sozialgesetzbuches mit dem Titel „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ in Kraft getreten. Es kann aufgrund der langen Entstehungsgeschichte des Schwerbehindertenrechts insgesamt als das Ergebnis einer fast drei Jahrzehnte währenden Diskussion über das „Ob“ und „Wie“ eines einheitlichen Rehabilitationsrechts für behinderte Menschen angesehen werden.107
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde mehr und mehr die Idee eines Staates geboren, der die Widersprüche zwischen formaler Gleichheit und tatsächlicher Unterlegenheit – sei es aufgrund körperlicher Benachteiligungen oder aufgrund wirtschaftlicher Abhängigkeit108 – versucht auszugleichen und so die Gesellschaft in ihrem Wirtschaftsleben nicht komplett sich selbst überlässt. Es wurde also die Idee eines Sozialstaates geboren, der zum Schutz Einzelner in die Gesellschaft ordnend eingreift.109 Kriegsgeschädigte, deren Anzahl mit dem technischen Fortschritt der Waffen immer mehr stieg, erlitten meist ein ähnliches Schicksal wie Personen, die Opfer von Betriebsunfällen geworden waren: Der Geschädigte erhielt zwar Schadensersatz im Rahmen des geltenden Haftpflichtrechts, letztlich konnte seine Versorgung dadurch aber nicht langfristig sichergestellt werden, so dass er meist auf die Armenpflege angewiesen war.110 Oberstes Ziel im Umgang mit Kriegsgeschädigten war es also, sie schnellstmöglich wieder erwerbsfähig zu machen und in das Wirtschaftsleben zurückzuführen.111 Ebenso wie die Weimarer Kirchenartikel wurde darum auch das Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 06.04.1920 bereits zu Zeiten der Weimarer Republik erlassen. Es sah eine Pflichtquote der Beschäftigung von Schwerbeschädigten für alle Arbeitgeber vor und legte zudem einen besonderen Kündigungsschutz fest.112 Nach dem Zweiten Weltkrieg und einer daraus resultierenden hohen Anzahl Schwerbeschädigter wurde das soziale Arbeitsschutzrecht dann weiter ausgebaut. 1950 wurde das Gesetz über die Versorgung der Kriegsopfer (Bundesversorgungsgesetz) erlassen und 1953 das Gesetz zur Beschäftigung Schwerbeschädigter neu gefasst. Ein entscheidender Schritt zur Förderung der Rehabilitation wurde schließlich im Jahr 1974 getan mit dem Erlass des Schwerbehindertengesetzes und des Gesetzes über die Angleichung der Leistungen zur Rehabilitation (RehaAnglG). Letzteres hatte schon damals die Angleichung der medizinischen und der berufsfördernden Leistungen zur Rehabilitation zum Ziel, weil deren Verteilung aufgrund der komplexen Gesetzeslage und der unterschiedlichen Behandlung der behinderten Menschen in den verschiedenen Versicherungszweigen als ungerecht empfunden wurde.113 Allerdings blieb der gewünschte Effekt aus bzw. wurde nur teilweise erreicht. Wegen der Unübersichtlichkeit des gesamten Rehabilitationssystems kam es nicht zu der für einen reibungslosen Ablauf notwendigen Zusammenarbeit der einzelnen Rehabilitationsträger und das System blieb für die Betroffenen weiterhin intransparent.114
Erst 1994 konnte mit der Einführung des Benachteiligungsverbots gegenüber behinderten Menschen nach Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG der Grundstein für einen Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik gelegt werden, in der es fortan nicht mehr hauptsächlich um Fürsorge und lebenslange Versorgung ging, sondern deren zentrales Ziel die Gleichstellung und Selbstbestimmung behinderter Menschen war.115 1998 legten die Regierungsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein Eckpunktepapier vor, nach dem das Teilhaberecht als neuntes Buch in das Sozialgesetzbuch eingegliedert werden sollte. Nach eingehender sozialpolitischer Diskussion wurde schließlich am 16.01.2001 ein Referentenentwurf in den Bundestag eingebracht. Verbände und Organisationen der behinderten Menschen wurden bei der Schaffung des SGB IX bereits von Anfang an mit einbezogen und nicht erst ab Bestehen eines Gesetzesentwurfs, damit sie ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen von Beginn an einbringen und die Regelungen maßgeblich mitgestalten konnten.116 Das heutige SGB IX haben der Bundestag letztendlich am 06.04.2001 und der Bundesrat am 11.05.2001 beschlossen. Nach Auffassung des Deutschen Bundestages sollte Mittelpunkt dieses neuen Gesetzes nicht mehr die Fürsorge und die Versorgung von behinderten Menschen sein, sondern ihre selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Beseitigung der Hindernisse, die ihrer Chancengleichheit entgegenstehen.117 Es ist somit Aufgabe des sozialen Staates, die Rahmenbedingungen für die Teilhabe behinderter Menschen als Gleichberechtigte am gesellschaftlichen Leben zu schaffen und Gefährdungen dieser Teilhabe durch Übergriffe Dritter abzuwehren.118 Auch die Erweiterung der Beteiligungsrechte der Schwerbehindertenvertretung bereits zum 01.10.2000 war ein Schritt in Richtung selbstbestimmte Teilhabe der Betroffenen, da sie von der Schwerbehindertenvertretung in ihrem Interesse gegenüber dem Arbeitgeber unterstützt werden.119 Praktisches Ziel des neuen Gesetzes sollte es außerdem sein, das Rehabilitationsrecht in einem Buch des Sozialgesetzbuches zu vereinheitlichen und zusammenzufassen, um die Unübersichtlichkeit des alten Rechts zu beenden und Betroffenen damit die Verwirklichung ihrer Rechte zu erleichtern.120
2.Verfassungsrechtliche Verankerung
Das Rehabilitationsrecht insgesamt wird maßgeblich von nationalem Verfassungsrecht geprägt. Eine besondere Bedeutung nimmt hierbei das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes nach Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 GG ein. Die Stellung schwerbehinderter Menschen – nicht nur im Verhältnis Staat und Bürger – wird außerdem durch Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG geprägt.
a.Sozialstaatsgebot nach Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 GG
Wie bereits erwähnt ist es Aufgabe des Sozialstaates, die gleichberechtigte Teilhabe Schwerbehinderter am Leben in der Gesellschaft zu fördern und einer Benachteiligung entgegenzuwirken. Die verfassungsrechtliche Grundlage dazu liegt im Sozialstaatsgebot. Dieses Gebot ist ein Prinzip staatlicher Verantwortung für die ganze Gesellschaft im Gegensatz zu einem nur punktuell oder nicht intervenierendem Staat.121 Es gebietet dem Staat für Einzelne oder Gruppen der Gesellschaft, Vorsorge und Fürsorge zu leisten, wenn sie aufgrund persönlicher Lebensumstände oder gesellschaftlicher Benachteiligung, insbesondere wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen, in ihrer Selbstbestimmung behindert sind.122 Als Mittel zu Erreichung dieser Ziele dient die Rechtsgestaltung. Durch Förderung, Lenkung und Zwang wahrt der soziale Rechtsstaat letztlich seine Verantwortung im Ganzen.123 Im Ergebnis soll im sozialen Rechtsstaat eine soziale Gerechtigkeit für alle Bürger geschaffen werden124, die es vor allem auch im Bereich des Arbeitslebens zu erreichen gilt. Gerade dort muss der soziale Rechtsstaat regulierend in die Privatrechtsgestaltung eingreifen, weil eine Integration allein mit staatlichen Einrichtungen und Mitteln des öffentlichen Rechts im Arbeitsleben nicht möglich ist.125 Bei der Erfüllung des Sozialstaatsprinzips geht es zum einen um die materielle Verteilungsgerechtigkeit, aber zum anderen auch um die Gestaltung einer Ordnung an und in der jeder teilnehmen kann.126 Zentrum ist dabei das Bestreben des Staates, allen Menschen die Möglichkeit der tatsächlichen Wahrnehmung ihrer Freiheitsgrundrechte zu ermöglichen.127 Formal stehen die Freiheitsgrundrechte zwar jedem Menschen zu, die tatsächliche Wahrnehmungsmöglichkeit kann allerdings infolge einer Behinderung stark eingeschränkt sein, wie etwa bei Art. 12 Abs. 1 GG, dem Freiheitsgrundrecht, das gewährleistet, dass jeder seinen Beruf sowie seine Ausbildungs- und Arbeitsstätte frei wählen und den gewählten Beruf ausüben kann. Ein behinderter Mensch kann beispielsweise seinen gewünschten Beruf nicht ausüben, wenn sein Arbeitsplatz nicht leidensgerecht gestaltet wird. Dieser Grundzusammenhang zwischen dem Sozialstaatsgebot und der Realisierung von Freiheitsgrundrechten ist für die Auslegung des SGB IX, das das Sozialstaatsgebot mit der Gewährung sozialer Rechte konkretisiert, von großer Bedeutung.128 Es ist also Aufgabe des sozialen Rechtsstaates, die tatsächlichen Möglichkeiten der Grundrechtswahrnehmung den formalen anzugleichen. Die arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen des SGB IX greifen zu diesem Zweck zwar in das Arbeitsverhältnis gestaltend ein, im Ergebnis müssen aber die Interessen und Freiheitsgrundrechte des Arbeitgebers genauso wie die des Arbeitnehmers möglichst weitgehend verwirklicht werden.129
b.Benachteiligungsverbot nach Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG
Bei der möglichst weitreichenden Gewährung der Freiheitsgrundrechte hat der Gesetzgeber allerdings gleichzeitig zu beachten, dass er auch dem Gleichheitsgrundrecht verpflichtet ist und damit Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln muss. Allerdings ist für das Merkmal der Behinderung von der Verfassung nur die benachteiligende, nicht aber die bevorzugende Ungleichbehandlung ausgeschlossen, so dass eine kompensatorische Bevorzugung von behinderten Menschen grundgesetzlich unbedenklich ist.130 Ein individuelles Abwehrrecht gegen Benachteiligungen Behinderter besteht nach ganz überwiegender Auffassung in dem Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG, das im Jahr 1994131 ergänzt wurde. Es veranschaulicht die staatliche Aufgabe des besonderen Schutzes von behinderten Menschen.132 Im Rahmen dieses Förderungsauftrags kann der Gesetzgeber auch Normen schaffen, die eine Gleichbehandlung behinderter Menschen im Privatrechtsverkehr verlangen, um so die Möglichkeit gleicher Chancenwahrnehmung zu gewährleisten.133 Adressat des Gleichheits-grundsatzes bleibt dabei der Staat, der ihn aber im Rahmen seiner sozialen Gestaltungsaufgabe durchsetzen kann.134 So hat das Prinzip der sozialen Gleichheit behinderter Menschen auch im Zivilrecht mittelbare Drittwirkung.135 Zwar ist das privatrechtliche Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätzlich von der Privatautonomie geprägt - greift der Gesetzgeber hier aber nicht korrigierend und gestaltend ein, so bleibt eine Vielzahl von Menschen vom Wirtschafts- und Arbeitsleben ausgeschlossen.136 Der Sozialstaat übernimmt diesbezüglich eine Verantwortung, damit Menschen aus gesundheitlichen Gründen gerade nicht an der Teilhabe ihrer Rechte gehindert sind.137 Da sich im Privatrechtsverkehr typischerweise zwei Grundrechtsträger gegenüberstehen, findet der Behindertenschutz in den gegenläufigen Grundrechten anderer Privatrechtssubjekte eine Schranke.138 Dabei ist es auch die Aufgabe des Gesetzgebers, möglichen Konflikten gerecht zu werden, die entstehen können, wenn die Vertragsfreiheit des Arbeitgebers auf der einen Seite mit dem Beschäftigungsanspruch des behinderten Arbeitnehmers auf der anderen Seite konkurriert. Ziel muss es dabei sein, die Freiheitsrechte aller im Wege der praktischen Konkordanz möglichst weitreichend zu gewährleisten.139