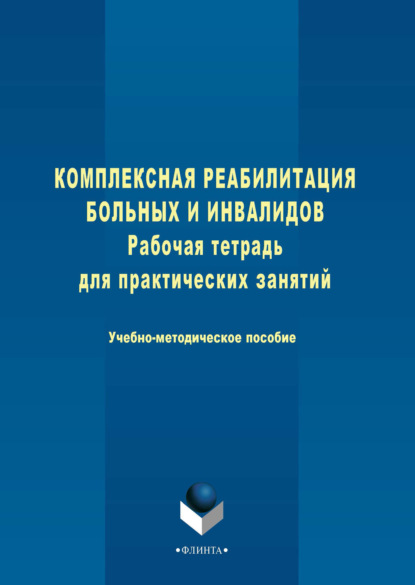- -
- 100%
- +
Und was ist mit dem C? Es wird gerne verschwiegen oder – wenn überhaupt – eher unverbindlich einmal erwähnt. Weil das aber letztlich nicht geht, weil das C stets eine Verbindlichkeit mit sich bringt, wird es für viele buchstäblich zu einem Kreuz, das nicht mehr zu passen scheint. Den einen tut es weh, den anderen ist es nicht nahe genug an den Kirchen dran. Die einen nehmen es als wohlklingende Floskel, andere verlangen nach klarer und längst überfälliger Profilierung.
Doch seien wir ehrlich. Denn auch diese Forderungen und Fragen sind im Jahr des 60. Geburtstages des Grundgesetzes alles andere als neu. Bereits zum 25. Geburtstag der deutschen Verfassung sah der Nestor der Katholischen Soziallehre und Jesuitenpater Oswald von Nell-Breuning beide „Unionsparteien vor der Wertfrage“. Seine Erkenntnisse und Forderungen in der Zeitschrift „Stimmen der Zeit“ von 1974 haben auch 2009 nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil. Beide Parteien, die CDU und die CSU, hätten von Anfang an das C in besonderer Weise vor die Wertfrage gestellt – und sich selbst einen hohen Anspruch gegeben. Mehr noch: Sie stellen an sich selbst einen „ebenso strengen Anspruch und unterwerfen sich der Messung an ebendiesem Maßstab“. Es stehe außer Zweifel, dass „man weit über die Kreise hinaus, von denen die Gründung der CDU und CSU ausging oder die sich diesen Parteien zuwandten, aufgrund der gemachten Erfahrungen entschlossen war, den in Weimar unternommenen Versuch eines wertneutralen Staates nicht zu wiederholen“, sondern den Bau der neuen Gesellschaftsordnung auf einem „Consensus über vorgegebene Werte“ zu gründen.
Ohne C keine Identität
60 Jahre und kein bisschen greise – so könnte man der 1949 in Bonn verabschiedeten deutschen Verfassung zurufen. Es liegt auf der Hand, im Zusammenhang mit unserem Thema einen Blick darauf zu werfen, wie sehr dieses Grundgesetz mit dem C verbunden ist, und auch, wie viel Segen aus diesem C möglich war und möglich sein wird. Die Präambel beginnt mit der „Verantwortung vor Gott und den Menschen“ und ist wahrlich mehr als nur ein nettes Vorwort. Schon gar nicht ein unverbindliches. Es ist zumindest, wie einmal formuliert wurde, ein Vorsatz. Es ist eine Grundentscheidung, ein Schlüssel zur Gültigkeit des Vorgegebenen, ein – um das christliche Identifikationsmerkmal des Kreuzes zu bemühen – unersetzbares Pluszeichen der gesamten Gesellschaftsordnung, von der manche richtig sagen, sie sei die freieste und menschengerechteste der Welt. Der in Bonn lebende Karlsruher Verfassungsrichter Udo di Fabio sieht in dieser Präambel gar die „tiefe kulturelle Verknüpfung von Christentum und Rechtskultur des Verfassungsstaates“ und hält eine „Entkoppelung von Politik und Christentum, von Staat und Kirche“ für undenkbar.
Das C, sprich der christliche Gott, spielt übrigens in einigen Landesverfassungen ebenfalls eine nicht unbedeutende Rolle. Von „Ehrfurcht vor Gott“ und „Gottesfurcht“ ist etwa in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Rede. „Gott“, „Gewissen“ und „Achtung der Würde des Menschen“ werden eigens in der Bayerischen Verfassung betont. Völlig verstaubt kann also das C und alles, was mit ihm verbunden ist, auch heute nicht sein. Horst Köhler hat – um nur ein Beispiel zu nennen – bei seiner Eidesleistung den angebotenen Zusatz „So wahr mir Gott helfe“ 2004 ausdrücklich in seiner Antrittsrede als Bundespräsident hervorgehoben. Er verstand seinen Amtseid als „Verpflichtung, zur Erneuerung Deutschlands beizutragen“. Als persönlichen Kompass nannte er dabei sein „christliches Menschenbild und das Bewusstsein, dass menschliches Tun am Ende immer vorläufiges Tun ist“.
Es ist kein Zufall, dass die vielen Väter und die wenigen Mütter des Grundgesetzes an den Anfang der deutschen Freiheitsordnung eine Verpflichtung gestellt haben, die – zum Schutze der Demokratie – dem demokratischen Zugriff entzogen ist und entzogen bleiben wird. Auch dieser § 1 hat etwas mit dem C zu tun. Dort heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das kann man nur verstehen, wenn man die Menschenwürde als etwas Vorgegebenes begreift, also etwas, das nicht geschaffen werden kann, sondern nur respektiert werden muss. Nach christlichem Verständnis ist jeder Mensch – ob reich oder arm, gesund oder krank, angesehen oder nicht, klein oder groß, geboren oder noch nicht, gläubig oder ungläubig, schwarz oder weiß, jung oder alt – ein Abbild Gottes und von ihm erschaffen. Oder, wie es Papst Benedikt XVI. in seiner Antrittspredigt im April 2005 formulierte: „Wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution. Jeder von uns ist Frucht eines Gedankens Gottes. Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht.“ Und deshalb heißt es ohne Ausnahme und ohne Wenn und Aber: Die Würde „des Menschen“ ist unantastbar. Punkt. Nein, eigentlich: Drei Ausrufezeichen!
Fundament, kein Fundamentalismus
Warum das wichtig ist? Wichtig gerade für unser Thema? Weil sich genau an diesen Fragen beziehungsweise deren aktueller Konkretisierung und dem mit dem C im Parteinamen verbundenen Anspruch vielfach jene Diskussion entzündet, die nach der Christlichkeit der Unionsparteien fragen lässt. Wer sich dieser Diskussion aber stellt, sollte – bei aller Kritik an den C-Parteien – sich zunächst einmal vor Augen führen, dass die mit dem besonderen Anspruch gegründeten Parteien niemals vorhatten oder hätten vorhaben können, gleichsam politische Kirchen zu sein oder zu werden. Weder war geplant, kirchliches, also katholisches und evangelisches Gedankengut eins zu eins in die Politik zu übersetzen, noch war und kann geplant sein, losgelöst von kirchlichen Überzeugungen eine Art Kirchenersatz auf politischer Bühne zu sein. Es gibt also letztlich so etwas wie eine abgefederte Unabhängigkeit der Abhängigkeiten. Was zu den keineswegs nur von C-Politikern definierten Grunderkenntnissen des deutschen Staates und seiner Fundamente gehört, ist von Politikern erklärt worden. Im Parlamentarischen Rat saßen politisch Interessierte und Politiker, nicht aber Moraltheologen oder Dogmatiker. In ihrer christlichen Freiheit oder – um Martin Luther zu bemühen – in der Freiheit eines Christenmenschen legten sie das Fundament für die gesellschaftliche Ordnung wie auch das Fundament für die Parteien.
Dieses Fundament ist aber weder eine Einladung zum toleranzfreien Fundamentalismus noch eine von jeder Vorgabe freie losgelöste Neudefinition dessen, was das C bedeutet. Hinzu kommt auch dies, worauf nicht nur Oswald von Nell-Breuning hinwies: Den Gründern, die „ihre Partei als christlich bezeichneten und das C in deren Namen aufnahmen, war es zweifellos darum zu tun, im Gegensatz zum integralistisch überbetonten Konfessionalismus den interkonfessionellen Charakter ihrer Gründungen herauszustellen; insofern brachte das C mehr das Negative, die Absage an die konfessionelle Trennung, zum Ausdruck als ein positives Bekenntnis zu christlichen Normen und Werten, die man ganz selbstverständlich als verbindlich ansah und annahm, sodass es eines eigenen Hinweises darauf nicht bedurfte.“
Diese Selbstverständlichkeit ist offenbar weithin verdunstet. Heute erscheint es daher schwieriger als früher zu sein, beurteilen zu wollen, was gut und böse, was richtig und falsch nach christlichem Glauben ist. Christliche Sittenordnung – das ist ein nicht mehr verstandener Begriff. Vergessen werden darf übrigens nicht, dass die in der Präambel des Grundgesetzes definierte Verantwortung vor Gott und den Menschen nicht ausdrücklich als ausschließlich christlich gemeint war und ist. Diese Verantwortung schließt alle Gottgläubigen ein, jedenfalls alle, die sich dem alttestamentlichen Gott verpflichtet wissen. Das sind Juden, Christen und Muslime. Letztlich sind es alle, die davon überzeugt sind, dass die Menschenwürde unantastbar sein und bleiben muss und es unverletzliche wie unveräußerbare Rechte geben muss. Der Staat kann nur als humaner funktionieren, wenn er die Natur des Menschen und seiner ihm vorgegebenen Rechte und Pflichten berücksichtigt, sie also nicht der Beliebigkeit anheimstellt. Wo aber sind die Grenzen? Wie weit geht die Freiheit eines Christenmenschen? Wie christlich darf, wie christlich kann und wie christlich müssen die Unionsparteien sein? Gestern, heute und morgen?
So gesehen und weil es keinen Fundamentalismus auf der Grundlage des so beschriebenen Fundamentes geben kann, ist stets zu Recht betont worden, dass es eine christliche Politik nicht geben kann. Wohl aber eine Politik aus christlicher Verantwortung. Wenn schon der Staat mit seinem Grundgesetz weltanschaulich neutral, aber keineswegs wertneutral ist, um wie viel mehr darf und muss ein Anspruch an die C-Parteien formuliert und eingefordert werden? Müssen, dürfen und sollen sie sich unterscheiden von anderen? Wenn ja, wo und wie? Haben sie mehr zu bieten als andere? Können und sollen sie klarer und zugleich toleranter sein als andere politische Parteien? Stehen sie nicht vor einer neuen Herausforderung zur Klarheit, wenn allenthalben erkannt wird, dass – wie es selbst die Zeitschrift „Stern“ bemerkt – es eine neue Sehnsucht nach alten Werten in der Gesellschaft gibt? Stimmt die Beobachtung des Bundesverfassungsrichters di Fabio, dass vor allem die 68er-Bewegung traditionelle und bewährte Werte deformiert und zerstört hat und zu einer „fatalen gesellschaftlichen Bindungslosigkeit“ führte? Ist seine Beschreibung richtig, dass es unserer Gesellschaft „an Identität und innerer Stärke“ fehlt, um in der „Auseinandersetzung mit anderen Kulturen bestehen zu können“?
Mehr als andere?
Wenn ja, wäre und ist es dann nicht gerade eine Herausforderung an die Parteien mit dem C, den vergessenen Schatz zu heben, sich aus den Verneblungen der 68er-Verführungen zu befreien und den Mut zum toleranten Profil der Klarheit zu wagen? Wie viele verdrängte, versteckte und geleugnete Chancen stecken und schlummern im C? Ist das C konservativ oder progressiv oder liberal? Ist alles nur noch Mitte? Und was ist die Mitte? Was kann sie sein? Was muss sie sein? Reicht es, wenn die C-Parteien seit der Wahl 2005 gesellschaftliche Debatten lediglich in möglichst unverbindliche Kompromissmuster münden lassen? Zwingt der Anspruch, eine Volkspartei bleiben zu wollen, gar zu einer profillosen Kompromissverliebtheit? Ist das, was etwa in der Familienpolitik seit einigen Jahren propagiert wird, C-gerecht, fair und human? Kann es – um ein wahrlich umstrittenes Feld des Lebens anzusprechen – im Lebensrecht Kompromisse auf Kosten des Lebensrechtes geben? Embryonale Stammzellen, Patientenverfügung, Sterbehilfe – was haben, was hätten die Unionsparteien hier mehr anzubieten als andere? Was wäre und ist wirklich modern? Wo könnten sich mehr Humanität, mehr Freiheit und mehr Lebensqualität abzeichnen? Ist das C nur ein Kreuz oder ist es vielleicht eine Chance?
C-Politiker geben hier unterschiedliche, nachdenkliche Antworten, fragt man sie nach der persönlichen Bedeutung des C für sie. Der Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Mißfelder, antwortet auf die Frage „Was mir das C für mein politisches Engagement bedeutet“: „Christ zu sein, bedeutet für mich, frei zu sein – frei von Ängsten und Furcht zu sein und stattdessen voller Hoffnung und Zuversicht leben zu können. Sich in der Kirche, in der Gemeinde geborgen zu fühlen. Mein christlicher Glaube dient mir daher als innerer Kompass. Für mich bedeutet das konkret, dass ich mir politische Entscheidungen nicht leicht mache, dass ich abwäge, prüfe und darüber nachdenke, wo die ethischen Grenzen unseres Handelns liegen. Der Mensch darf nicht alles tun, wozu er technisch fähig ist. Das gilt beispielsweise für das Thema Spätabtreibung oder die Humangenetik mit dem wichtigen Bereich der Stammzellforschung. Wir dürfen den Lebensschutz nicht den anderen überlassen, sondern müssen als Union ein eindeutiges Profil zeigen.“
Mehr als schöne Formeln?
Der junge Bundestagsabgeordnete hätte sich deshalb „auch eine andere Position der CDU bei der Stammzelldiskussion gewünscht“. Die beschlossene Verschiebung des Stichtags hält er „für falsch“ und bekennt: „Wir müssen das Leben von Anfang bis Ende schützen, es in seiner Fülle annehmen. Das ist für mich ein Ergebnis meines christlichen Glaubens, der zwar häufig in der Politik auf die Probe gestellt wird, der sich aber nicht verändert hat durch mein politisches Engagement.“ Der Politiker ist gar davon überzeugt, dass die Union mit ihren „christlichen Prinzipien und der Orientierung an Werten wie Würde, Nächstenliebe und Rücksichtnahme“ sich unterscheide „von allen anderen politischen Richtungen“. Und den Kritikern seiner Partei gibt er gleich einen Rat mit auf den Weg. Sie sollten sich „einbringen und für die christlichen Werte auch politisch einstehen“. Es sei, so Mißfelder, „möglich, das ,C‘ in der Politik hochzuhalten“, zumal dies „in der heutigen Zeit wichtiger denn je“ sei.
Horst Seehofer, der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident, bekennt auf Nachfrage Ähnliches und erklärt zunächst einmal, dass das „C“ im Namen der CSU ein Bekenntnis zum christlich-abendländischen Menschen- und Weltbild sei. Daraus ergebe sich für die CSU „der Auftrag, jeden Tag und jede Stunde dafür zu arbeiten, dass es den Menschen in unserem Land besser geht“. Sein Leitmotiv des politischen Handelns: Politik als Dienst am Menschen. Und dann kommen Formulierungen, die schön klingen, aber eben im konkreten Alltag stets einer Überprüfung unterzogen werden müssen: „Das christliche Menschenbild geht vom Einzelnen aus – von dem Menschen in seiner Würde und Freiheit. In der Schöpfungsgeschichte schenkte Gott dem Menschen einen freien Willen und gab ihm die Fähigkeit, Gutes und Böses zu erkennen und entsprechend zu handeln. Der Mensch ist zur Freiheit und Selbstbestimmung berufen. Dieses Menschenbild erlaubt Unterschiede zwischen den Menschen – es gilt, jeden mit seinen besonderen Stärken zu akzeptieren, ihm freie Entfaltung zu lassen und ihn zu fördern, aber auch Eigenverantwortung einzufordern. (...) Wer alle gleich machen will, wer an den Staat glaubt und nicht an die Kraft des Einzelnen, wer vorgibt, wie die Menschen zu leben haben, beraubt die Menschen der Freiheit.“
Der bayerische CSU-Löwe spricht vom „Rang der Freiheit des Individuums“, erwähnt die „Verantwortung für den anderen, so wie in der katholischen Soziallehre und der evangelischen Sozialethik die Prinzipien der Personalität, Solidarität und Subsidiarität miteinander verknüpft sind“, lobt die Vorzüge der Sozialen Marktwirtschaft und die aus den christlichen Werten erwachsende Verpflichtung „auch zur Verantwortung gegenüber künftigen Generationen“, nennt die Bewahrung der Schöpfung und reklamiert den Schutz von Ehe und Familie. Den Kindern wolle man in den Schulen Werte vermitteln, weil unsere Gesellschaft diese Werte brauche. Auch wenn es „uns als Menschen nicht jederzeit vergönnt“ sei, diese Werte „vollständig selbst zu erfüllen“, seien sie doch als Richtschnur unerlässlich. Für Seehofer heißt das C „nicht Unfehlbarkeit. Es gibt Licht und Schatten. Den Schatten auszublenden, wäre falsch. Regeln sind keine Belastung, sondern eine Hilfe. Aber selbst wenn man sie nicht einhalten kann, bleiben sie eine wichtige Orientierung im Leben“, schreibt Seehofer.
Lippenbekenntnisse? Schöner Schein? Oder vielleicht doch realistischer Einblick in die lebbare Wirklichkeit? Nur theoretisches Programm oder Ansatz zur Realpolitik? Über all das ist zu reden. Darüber soll auch gestritten werden. Dieses Buch soll und will ein Diskussionsbeitrag dazu sein. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger.
Offene Fragen Wofür steht die UnionWie viel Profil will sie sich leistenLassen ihre Führungskräfte eine ehrliche Kritik zu?Feigheit vor dem Freund
Das C und sein Wert
Der Blick nach Berlin lohnt immer. Nicht nur, weil dort seit einigen Jahren eine bemerkenswerte Frau das Land regiert. Nicht nur, weil Berlin eine faszinierende Stadt ist. Nicht nur, weil zwischen Reichstag und den Parlamentsgebäuden rund um ihn eine bedeutungsschwangere Atmosphäre der Wichtigkeit bei manchem Besucher aus der sogenannten Provinz das respektvolle Staunen möglich macht. Nicht nur, weil dort eine Wirklichkeit des Raumschiffs entstanden ist, gegen die ähnliche Entwicklungen im beschaulichen Bonn nichts als kaum wahrnehmbare Zuckungen waren. Nein, es ist die Symphonie aus Vergangenheit und Zukunft, die dieser Hauptstadt eine ganz eigene, eine unvergleichliche Wirklichkeit verleiht.
Nicht zuletzt ist es – zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer – auch eine neue Generation von Politikern, die der deutschen Demokratie für die medial wahrgenommene Wirklichkeit ein anderes Gesicht verleihen, als dies zu Bonner Zeiten der Fall war. Bonn, die Stadt des Grundgesetzes und der erfolgreichsten Demokratiezeit auf deutschem Boden, liegt am Rhein, ist Teil eines über zwei Jahrtausende gewachsenen Charakters, der wesentliche Züge des Christlichen trägt. In Bonn spielte und spielt Kirche eine selbstverständliche Rolle. Auch wenn sich in Bonn, das sich seit dem Verlust des Hauptstadttitels tapfer Bundesstadt nennt, vieles ändert und anno 2009 nicht mehr verglichen werden kann mit den Gründerjahren der Bundesrepublik, so ist bis heute das Christliche irgendwie da. Regelmäßiges Kirchengeläute von nicht allzu weit entfernt war im Regierungsviertel immer zu hören, wenn man wollte. Manche sagen gar, der Geist des rheinisch-katholischen Adenauers sei auch noch Jahrzehnte später nicht ganz erloschen. Rheinisch-katholisch – das weiß man im Rheinland – steht für die der rheinischen Weltoffenheit entsprechende Mentalität der Leichtigkeit des Seins, auch gegenüber allem Kirchlichen, das man zwar ernst nimmt, aber bitte nie zu ernst.
Die andere Hauptstadt
Bonn war Hauptstadt. Berlin ist es. Und hier an der Spree muss man schon etwas genauer suchen, um christliche Kultur zu entdecken. Es gibt sie. Aber sie ist keineswegs so alt und in der Geschichte verwurzelt wie im Rheinland, wo mit den Römern bereits vor zweitausend Jahren das C, um im Bild dieses Buches zu bleiben, zu den Menschen kam. Der märkische Sand konnte damals noch mehr als zwölf Jahrhunderte nicht ahnen, dass die Zivilisation auch an die Spree kommen würde. Sie kam. Mit beeindruckendem Selbstbewusstsein. Heute ist Berlin eine Metropole der Welt, die für vieles in Deutschland Maßstab ist. Eine Metropole, die zahlreichen Kulturen Heimat bietet und im wahrsten Sinne des Wortes bunt schillernd ist.
So etwas prägt. So etwas prägt auch Politiker, die aus dem ganzen Land anreisen, um hier Politik für ganz Deutschland zu machen. Berlin prägt mit seiner Macht der Faszination und Größe übrigens mehr, als das Bonn jemals wollte oder auch konnte. Irgendwie war es am Rhein leichter, seine Heimat aus seinem Wahlkreis mitzubringen und ihr Gehör zu verschaffen. Bonn prägte so gesehen nicht. Bonn ließ gewähren. Bonn war tolerant, weil es nicht anders konnte.
Berlin ist da anders. Die Atmosphäre ist hier weit weniger christlich angereichert als anderswo. Sicher, auch das Christliche hat seinen Platz. Aber eben neben vielem anderen. Vertretern der Kirchen fehlt eine Aura des etwas Besonderen. Sie sind eher so etwas wie gleichberechtigte Lobbyisten in der Schar der anderen Verbands- und Interessenvertreter. Sie sind gerne gesehene Gesprächspartner, aber sie müssen mehr um ihr politisches Beachtungsgewicht kämpfen als ihre Vorgänger in Bonn. Es ist nun einmal so. Berlin hat mit seiner säkularisierten und auch bisweilen gottlosen Wirklichkeit die Kraft, von sich aus ins Land zu wirken. Dabei weiß jeder, dass Berlin nicht Deutschland ist und Deutschland nicht Berlin. Mag sein, dass man dieses Phänomen quasi entschuldigend und, wie es jemand einmal sagte, strafmildernd durchaus gewichten muss, wenn man gerade im Blick auf den Reichstag und das Kanzleramt sowie den um diese Stätten kreisenden Mikrokosmos die Frage nach dem C stellt. Ich plädiere also für Fairness, wenn scharf und mit dem Unterton der zweifelsfrei gegebenen harten Antwort aus den anderen und womöglich selbstverständlich christlich geprägten Regionen des Landes nach dem C in der Union gefragt wird.
Das C unter vielem anderen
Ähnliches gilt übrigens auch für München. Auch München ist nicht Bayern, und Bayern ist nicht München.
Das C hat in Oberbayern eine ganz andere Verwurzelung im Leben als etwa im nördlichen Franken. Und München ist sowieso nichts als München. So wie Berlin der Mittelpunkt ist, ist es München auch. Und wie in der Bundeshauptstadt die Lebenswirklichkeit keineswegs nicht automatisch christlich ist, so ist sie es auch in der bayerischen Landeshauptstadt nicht. Obwohl in München die Liebfrauenkirche das Stadtbild so prägt wie in Berlin der Funkturm am Alexanderplatz. Die Hedwigskathedrale jedenfalls liegt etwas abseits in Berlin, obwohl sie mittendrin liegt.
Und was heißt das alles jetzt für unsere Frage? Man muss es einfach wissen und berücksichtigen, wenn C-Politiker, die sich auf der politischen Bühne in Berlin und auf den Empfängen und Tagungen in der Metropole perfekt zu bewegen verstehen, zum C befragt werden. Es wäre einfach unfair, sie mit jener Schablone zu bewerten, die vor einigen Jahrzehnten am Rhein vielleicht noch berechtigt gewesen ist. Bonn bot als Bühne allenfalls das Kanzlerfest oder die übersichtlichen Sommerfeste der Ländervertretungen. Das Beethovenfest zu Ehren des in Bonn geborenen Musikgenies fand schon wieder ohne Bundesprominenz statt. In Berlin hingegen müssen sich, wie gelegentlich von ihnen selbstbewundernd geklagt wird, die Politiker täglich entscheiden, welche der zahlreichen Einladungen sie denn wahrnehmen. Am besten alle nacheinander. Viel Ablenkung, wenig C. So ist es nun einmal. Fast könnte man sagen: Das C geht unter in Berlin.
Könnte das eine Rechtfertigung sein für nicht nur in Berlin feststellbare Entwicklungen? Oder doch nur eine Erklärung? Ist die Berliner Republik, von der man im Unterschied zur nie so bezeichneten Bonner Republik unmittelbar nach dem Umzug vom Rhein an die Spree zu reden begonnen hat, längst östlicher und heidnischer geworden? Mit entsprechender Ausstrahlung auf – nicht zuletzt – die C-Politiker und damit auf das von der Zentrale aus geprägte und überall im Lande wahrgenommene Profil der C-Parteien? War es vielleicht doch ein Fehler, dass nach dem Fall der Mauer verhindert wurde, einen Katholischen Arbeitskreis in der Union zu gründen – gleichsam als Ergänzung zum Evangelischen Arbeitskreis? Diesen hatten engagierte Christen in der Politik zu Bonner Zeiten ins Leben gerufen, um der im Rheinland vornehmlich katholisch geprägten CDU ein ökumenisches Gegengewicht zu bieten. Doch entsprechend engagierte Versuche, mit demselben Argument nach der Wende ein sichtbares katholisches Forum zu installieren, scheiterten in den Neunzigerjahren, auch am Widerstand eines prominenten protestantischen Unionspolitikers. Der dann ins Leben gerufene und nach dem früheren Kölner Erzbischof und Sozialethikers benannte Kardinal-Höffner-Kreis schaffte den Sprung aus einem eher unverbindlichen Gesprächskreis ohne besondere Wirkung ins mehr als nur Nette und Freundliche nicht, obwohl er bei der Bundestagsfraktion der Union angesiedelt ist und als Vorsitzenden einen Unionspolitiker hat. Einen in der Partei verankerten und als Teil dieser Partei wahrgenommenen Katholischen Arbeitskreis, vergleichbar mit dem Evangelischen Arbeitskreis, mit einer eigenen Publikation gibt es bis heute nicht. Leider.
Ganz anders, aber religiös
Im Konzert der Meinungen und Überzeugungen scheint das C im pluralistischen Berlin kaum oder nur eine geringe Chance zu haben. Ist das vielleicht einer der Gründe, warum sich die neue deutsche Republik ganz anders präsentiert als die vermeintlich christlicher geprägte alte Republik des Westens? Ist die Klage, die man gelegentlich hört, dass der Geist der Berliner Republik letztlich an vielem schuld sei bis hin zur Verdunstung des C in der Union, ernst zu nehmen? Wohl kaum. Es wäre zu kurz gesprungen, derart monokausal Veränderungen erklären zu wollen. Richtiger wird sein, daran zu erinnern, dass die Union, dass deren Köpfe Teil einer Gesellschaft sind, die sich stets verändert und auch schon verändert hat. Irgendetwas wird schon dran sein an dem Spruch, dass jede Gesellschaft die Politiker hat, die sie verdient. Will sagen: Die Politiker sind Teil der Gesellschaft und haben eben jene Gesellschaft, aus der heraus sie kommen, widerzuspiegeln. Von einer Vorbildfunktion und der Verantwortung, die sie etwa als gewählte Vertreter des Souveräns zu tragen haben, einmal abgesehen: Sollen sie völlig anders sein als die deutsche Wirklichkeit? Und ist diese nicht längst weitgehend vom C befreit? Sollen Unionsvertreter also päpstlicher als der Papst sein?