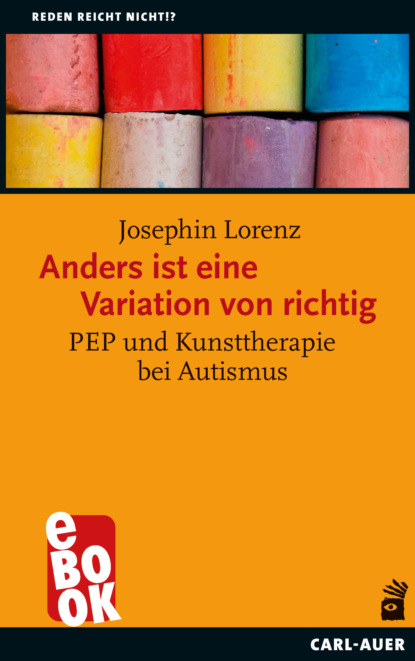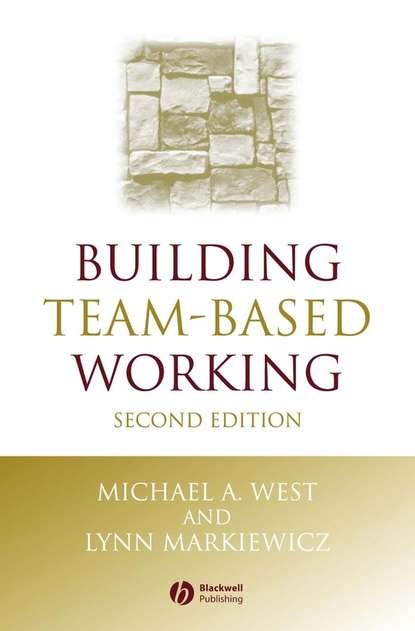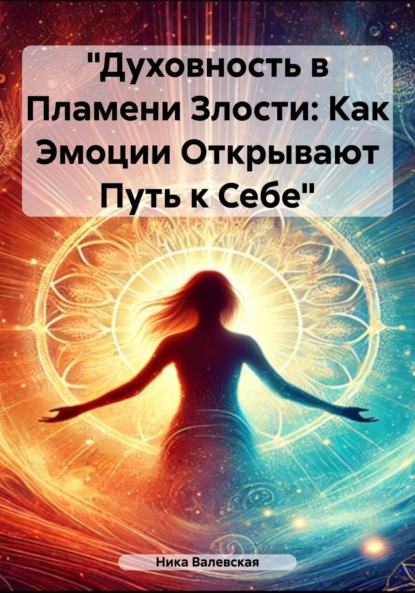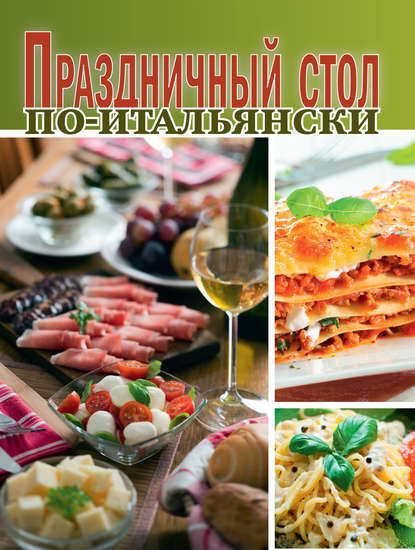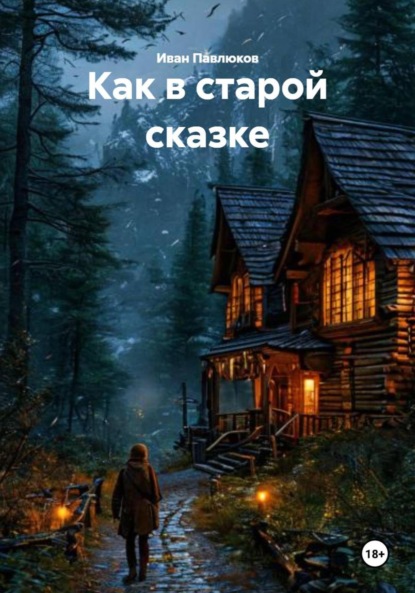- -
- 100%
- +
Bei allen Unterschieden zwischen Menschen mit und ohne Autismus gibt es jedoch eine Gemeinsamkeit: Autistische und nichtautistische Personen reagieren auf Stress. Allerdings geraten autistische Personen wegen ihrer Reizempfindlichkeiten schneller in Stress. So kann zum Beispiel eine einfache Stundenplanänderung im schulischen Alltag das Stresslevel eines autistischen Schülers so extrem ansteigen lassen, dass es in seinem Gehirn zu einem »Absturz« kommt. So erklärte es mir ein Therapiekind: »Wenn das passiert ist, brauche ich 10 Minuten, um meinen ›Computer‹ (damit meinte er sein Gehirn) wieder für das nun stattfindende Fach ›hochzufahren‹!«
Bereits als Kinder haben Autisten wiederkehrende Schwierigkeiten, Beziehungen zu Gleichaltrigen zu knüpfen. Besonders die unausgesprochenen Regeln der menschlichen Kommunikation bereiten ihnen zahllose Schwierigkeiten. Das gesprochene Worte, die Mimik, den Tonfall oder die Körpersprache ihres Gegenübers richtig zu deuten ist eine große Herausforderung – und sie reagieren daher oft auch nicht auf solche nonverbalen Signale. Die eigenen Emotionen über Mimik, Gestik oder Stimmlage so zu transportieren, dass es für Nichtautisten leichter verständlich wäre, ist ihnen kaum möglich.
Eine große Anzahl von Menschen aus dem Autismus-Spektrum können aufgrund ihrer Schwierigkeiten kein eigenständiges Leben führen und sind auf Hilfe, zum Teil auf intensive Betreuung, angewiesen. Manche lernen das Sprechen nie richtig, neigen zu selbstverletzendem Verhalten oder Wutausbrüchen. Andere leiden zusätzlich unter anhaltenden Schlafproblemen, Ess-Störungen oder Phobien.
Es gibt aber auch Autisten, die die gleichen Berufe ausüben wie Nichtautisten und ohne fremde Hilfe ihren Alltag leben. Inzwischen gibt es immer mehr Jugendliche und Erwachsene, die im Internet oder in Büchern über ihr Leben mit Autismus schreiben, bloggen oder die ihre Kunst veröffentlichen. Bei ihnen wird anschaulich, dass sie durch den Begriff »Autist« auf diesen einen Aspekt reduziert werden. Eine passendere Benennung zu finden, die die positiven Seiten im Sinne von autismuskompetenten Menschen betont, wäre hier wünschenswert.
Tiefgreifende Entwicklungsstörung, Wrong-planet-Syndrom oder doch eine Superkraft?
Viele dieser Erwachsenen stören sich sehr an dem Begriff »Autismus-Spektrum-Störung«. Denn für sie ist ihre Wahrnehmung keine falsche, sondern eben eine andere Art der Wahrnehmung. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg geht recht offen mit ihrem Asperger-Autismus um. »Ich habe Asperger, und das bedeutet, dass ich manchmal ein wenig anders bin als die Norm«, schrieb sie auf Facebook. »Doch unter den richtigen Umständen ist es eine Superkraft, anders zu sein.«
Für die Weltgesundheitsorganisation ist es eine psychische Krankheit, die Experten sprechen von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung des Gehirns. Es wird von einer fehlenden »theory of mind« ausgegangen – der Fähigkeit, sich in ein Gegenüber hineinzuversetzen, die autistische Klienten nicht entwickeln. All das klingt für Personen mit Autismus und ihre Eltern erschreckend, düster und abwertend. Denn tatsächlich konzentriert sich die Diagnose auf die Schwächen autistischer Menschen.
Auticon, eine Firma, die sich auf die Anstellung von Menschen aus dem Autismus-Spektrum spezialisiert hat, spricht von:
»Autismus ist kein Systemfehler, sondern ein anderes Betriebssystem.«
Fragt man Betroffene selber, so fühlen sie sich oft wie auf einem fremden Planeten. Den meisten fällt es schwer, zu anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Sie sind überempfindlich gegen Sinneseinflüsse – wie schmerzhaft gleißendes Licht, unerträglich lautes Stimmengewirr oder stechende Gerüche.
Dieses Gefühl, »wie vom anderen Planeten zu kommen«, wird in den meisten Fällen als negativ empfunden. Eigentlich wollen sie so sein wie die anderen und bemühen sich auch, durch ihr Verhalten nicht aufzufallen. Doch das gelingt ihnen meist nicht. Sie treten, wie Robin Schicha (2015) es in seinem Buch Außerirdische Reportagen vom Schulalltag beschreibt, »scheinbar in jedes Fettnäpfchen, das so auf dem Weg bereitsteht«.
Sie müssen sich die sozialen Regeln mühsam aneignen und erlernen sie nicht wie die anderen, intuitiv. Das wiederum löst bei ihnen das Gefühl aus, dass etwas an ihnen falsch sein muss. Denn alle anderen können ja offensichtlich ganz einfach mit diesen Regeln umgehen. Eigene Gefühle und Bedürfnisse werden unterdrückt. Oft haben diese Menschen deswegen nicht nur mit Schamgefühlen zu kämpfen, das zu sein, was sie sind, sondern auch mit der Furcht davor, das zu tun, was sie tun wollen. Es kommt vor, dass sie im Vorfeld eines möglichen Kontakts die Blicke der anderen als gegen sich gerichtet oder sogar als Verachtung interpretieren. Dieses Gefühl des Verachtetwerdens löst in den Betroffenen emotional fast immer eine Selbstentwertung aus – sie verurteilen dann bestimmte Eigenschaften und Bedürfnisse selbst und sehen sie nur noch negativ.
Hinzukommt, dass die Betroffenen sich mit ihrem »Anderssein« oft falsch verstanden fühlen. Ihr individuelles Verhalten wird in der Regel nicht wertschätzend als eine interessante Form der Bewältigung von Stress anerkannt. Im Gegenteil: Oft löst ihr Verhalten in Situationen, denen sie sich sowieso schon nicht gewachsen fühlen, im Umfeld zusätzlich Unfreundlichkeit oder sogar Abwehr aus. Das kann einen Teufelskreis von gegenseitiger Ablehnung und Zurücksetzung auslösen. Wenn ihr Verhalten dann von anderen als befremdlich empfunden und damit nicht anerkannt wird, leidet ihr Selbstwertgefühl enorm.
Donna Williams, Schriftstellerin und Künstlerin aus dem Autismus-Spektrum, beschreibt Autismus in ihrem Buch Wenn du mich liebst, bleibst du mir fern so (Williams 1994):
»Der Autismus ist etwas, das ich nicht sehen kann. Er hält mich davon ab, meine eigenen Wörter zu finden und zu benutzen, wenn ich es möchte. Oder er lässt mich all die Wörter benutzen und die albernen Dinge sagen, die ich nicht sagen will.
Der Autismus lässt mich alles gleichzeitig fühlen, ohne dass ich weiß, was ich fühle. Oder er schneidet mich davon ab, überhaupt etwas zu fühlen.
Der Autismus lässt mich die Wörter anderer Menschen hören, macht mich aber unfähig zu wissen, was die Wörter bedeuten. Oder er lässt mich meine eigenen Wörter sprechen, ohne dass ich weiß, was ich sage oder auch nur denke.«
Temple Grandin, eine führende Tierwissenschaftlerin in den USA, beschreibt ihre eigenen autistischen Wahrnehmungen so (Grandin 1997):
»Als ich klein war, waren auch laute Geräusche ein Problem. Sie fühlten sich oft an, als träfe der Bohrer eines Zahnarztes auf einen Nerv. Sie verursachten tatsächlich Schmerzen. Platzende Ballons erschreckten mich zu Tode, weil sich das Geräusch in meinen Ohren wie eine Detonation anhörte. Geringfügigere Geräusche, welche die meisten Menschen ausblenden können, lenkten mich ab. Als ich im College war, klang der Haartrockner meiner Zimmerkollegin wie ein startender Düsenjet …«
Auch Sean Barron (1998) beschreibt seine Wahrnehmung als Kind sehr eindrücklich:
»Mir ist klar, dass ich fast meine ganze Kindheit hindurch meine Mutter einfach nicht hörte. Ihre Bemühungen, geduldig und lieb zu mir zu sein, drangen einfach nicht bis zu mir durch. Ich schenkte ihren Wörtern genauso wenig Aufmerksamkeit wie dem Geräusch eines Wagens, der die Straße entlangfuhr. Ihre Stimme war lediglich Hintergrundgeräusch. Nur wenn sie anfing zu brüllen oder zu schreien, drang sie zu mir durch und holte mich für kurze Zeit aus meinem Schneckenhaus.«
Ähnliches beobachteten die Gehirnforscher Henry und Kamila Markram. Ihre persönlichen Erfahrungen mit ihrem autistischen Sohn ließen sie so lange forschen, bis sie eine für sie schlüssige Antwort auf die Probleme mit ihrem Sohn fanden. 2007 veröffentlichten sie erstmals ihre »Intense World Theory«. Diese Theorie beschreibt, dass autistische Personen ein überempfindliches Gehirn haben und im Gehirn der Betroffenen eine permanente Reizüberflutung stattfindet. Aus diesem Grund ziehen sich autistische Kinder in bestimmten Phasen der Entwicklung aus dem Sozialleben zurück. Die Konsequenzen sind Schwierigkeiten im Umgang mit den Reizen.
Neurowissenschaftler (Velazquez a. Galán 2013) konnten errechnen, dass die Gehirnaktivität bei autistischen Kindern im Ruhezustand durchschnittlich um 42 % höher liegt als bei den anderen.
Das Wissen, dass Menschen aus dem Autismus-Spektrum die Sinnesreize aus der Umwelt ganz anders verarbeiten, ist für mich als Therapeutin absolut wichtig. Wenn ein Kind extrem überlastet zu mir in die Therapiestunde kommt, mich anschreit, auf Sachen einschlägt oder auch sich selbst verletzt, ist es sehr hilfreich herauszufinden, was diesem Verhalten vorausgegangen ist. Was war los? Warum? Warum schreit, kratzt, beißt er/sie? (Siehe dazu Kapitel 5 »Das Wüte-Dings«)
2»Stimming« wird abgeleitet aus dem Englischen self-stimulating behavior = »sich selbst stimulierendes Verhalten« (s. auch Kap. 5).
2Unterstützung im Autismus-Spektrum
In den letzten Jahren häufte sich die Anzahl von Autismus-Diagnosen. Es wurde nach ADHS als die nächste Modediagnose gesehen. Steve Silberman schreibt in seinem Buch Die geniale Störung jedoch dazu:
»Diese zunehmende Zahl von Autismus-Diagnosen wurde zunächst als Zusammenspiel von genetischer Veranlagung und Risikofaktoren, die sich irgendwo in unserer toxischen modernen Welt verbergen: Luftverschmutzung, maßlosen Videospielen, denaturierte Lebensmittel.
Unsere DNA erzählt eine andere Geschichte. In der letzten Zeit gelangten Forscher zu der Feststellung, dass die meisten Fälle von Autismus keineswegs auf seltene De-novo-Mutationen, also spontane genetische Veränderungen, die erstmalig bei einem Familienglied auftreten und nicht ererbt sind, sondern im Gegenteil auf uralte Gene zurückgehen, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind und in manchen Familien lediglich konzentrierter auftreten als in anderen. Was immer Autismus ist – er ist kein singuläres Produkt der modernen Zivilisation, sondern ein eigenartiges Erbe aus ferner Vergangenheit, das durch Millionen Jahre der Evolution weitergegeben wurde.«
Es gab Autismus also schon immer, nur der Umgang mit den betroffenen Menschen hat sich mit der Zeit gewandelt. Je nach Beeinträchtigung wurden sie vielleicht in Heime abgeschoben, waren in ihren Familien als »Eigenbrötler« akzeptiert oder konnten sich bestenfalls auf Berufe spezialisieren, die ihren Fähigkeiten entsprachen. Schon immer gab es eine Bandbreite von Erscheinungsformen des Autismus und davon, wie das Umfeld damit umgegangen ist.
Heute gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten für Menschen aus dem Autismus-Spektrum, um kognitive und sprachliche Fertigkeiten zu entwickeln, die soziale Interaktion und Kommunikation zu trainieren und den Betroffenen somit ein Leben im sozialen Umfeld zu erleichtern. Die bisher etablierten und von der Wissenschaft als effektiv angesehenen Therapieverfahren basieren alle auf verhaltenstherapeutischen und übenden Ansätzen. Zusätzlich kann eine Vermittlung von wissenschaftlich fundiertem Wissen über Autismus den Betroffenen sowie deren Umfeld wie Eltern, Verwandte, Erzieher und Lehrer helfen, das Verständnis von Autismus und den Umgang damit zu verbessern.
In der Regel liegt in der Unterstützung der Betroffenen der Schwerpunkt bislang auf dem Erlernen von Fähigkeiten, die sie noch nicht beherrschen. Die dabei angewendeten Lehrkonzepte können den Menschen mit Autismus unter Umständen schwerfallen und in der Folge Stress auslösen. Je gestresster autistische Menschen sind, desto mehr neigen sie zu unerwarteten Verhaltensweisen. Übrigens ist es bei Menschen ohne Autismus sehr ähnlich: Je gestresster diese Personen sind, desto »verhaltens-origineller« werden sie.
Ein weiteres Phänomen wurde durch eine Studie der Autismus-Forschungs-Kooperation (AFK) deutlich – diese zeigt, dass Personen aus dem Autismus-Spektrum trotz größeren Hilfebedarfs und häufigerer Gedanken an eine ambulante Psychotherapie signifikant weniger Therapien gemacht haben. Laut dieser Studie lehnen Psychotherapeuten sie häufig mit der Begründung ab, sich mit der Diagnose nicht auszukennen. Personen aus dem Autismus-Spektrum haben also oft das Gefühl, dass eine ambulante Psychotherapie für sie schwierig zu bekommen ist. Die meisten Teilnehmer der Studie (85 %) empfanden die Kontaktaufnahme zu einem Psychotherapeuten erschwert (AFK 2015).
Das spricht deutlich für die Notwendigkeit des Wandels zu einer neuen Form der Psychotherapie, die Menschen aus dem Spektrum darin unterstützt, Stress abzubauen und ihre Stärken auszubauen. An dieser Stelle ist PEP für mich als Therapeutin eine wichtige Erweiterung der bisherigen psychotherapeutischen Ansätze. Zusätzlich wäre eine bessere Wissensvermittlung von autismusbedingten Stärken und Schwächen in den psychotherapeutischen Ausbildungen wünschenswert.
Diese Notwendigkeit des Wandels wird zunehmend auch von Fachleuten formuliert. So fordert Georg Theunissen (2014) in seinem Vortrag »Das Autismus-Verständnis im Wandel – von der Tradition zur Innovation« folgende Konsequenzen für die Begleitung von Menschen aus dem Autismus-Spektrum:
•Prävention in Bezug auf Stress oder Situationen, die womöglich Stress erzeugen
•Methoden zur Bewältigung von Stress und Würdigung
•Nutzung von Stärken und Spezialinteressen
Ausführlich hat er seine Standpunkte in dem Buch Menschen im Autismus-Spektrum: Verstehen, Annehmen, Unterstützen beschrieben.
Georg Theunissen folgend ist Prävention in Bezug auf Stress oder Situationen, die Stress erzeugen, ein wichtiger Punkt, der in der Autismus-Therapie zu beachten ist.
Stress vermeiden
Wir alle wissen, wie wichtig es ist, Stress zu vermeiden. Auch ist uns bekannt, dass körperlicher und seelischer Stress auf die Dauer nicht gesund ist. Dennoch fühlen sich heutzutage immer mehr Menschen von Stress belastet. Kinder und Jugendliche haben Stress in der Schule, Studenten an der Uni, Erwachsene im Job. Wichtig ist es, dass Menschen mit und ohne Autismus erst mal erkennen, wo und warum sie Stress erleben, wie sie ihn ggf. reduzieren können oder wie sie mit unvermeidbarem Stress besser umgehen können.
Natürliche Stressreaktionen des Körpers sind eigentlich eine sehr sinnvolle »Erfindung« der Evolution. Geraten wir in eine bedrohliche Lage, reagiert der Organismus mit dem Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck, sodass mehr Sauerstoff und Glukose zu den Muskeln gelangen. Auf diese Weise gewinnen wir Energie für den Kampf oder für die Flucht. Die menschliche Natur ist also so »programmiert«, dass wir ohne unser bewusstes Zutun schnell ausreichend Energien bekommen, um gefährliche Situationen meistern zu können. Dieses »Programm« ist fest installiert und läuft immer noch ab, auch wenn keine echte Lebensgefahr mehr droht. Im Kontakt zu einem cholerischen Mitmenschen oder beim Bearbeiten des dringend zu erledigenden Aufgabenberges wird es heute genauso aktiviert wie früher beim Anblick eines Säbelzahntigers. Wieso aber löst ein unfreundlicher Mitmensch bei der einen Person so viel Angst und Stress aus und bei der anderen überhaupt nicht?
Entscheidend dafür scheint die subjektive Bewertung des Einzelnen zu sein. Stress entsteht, wenn man das Gefühl hat, anstehende Aufgaben und Anforderungen nicht bewältigen zu können. Das bedeutet jedoch, dass in der Regel nicht allein das stresst, womit man konfrontiert wird. Entscheidender ist, ob und wie man seine Ressourcen und Fähigkeiten einsetzen kann, um die Herausforderungen nach den eigenen Bedürfnissen und Möglichkeiten zu lösen. Die eigene Haltung und der Umgang mit stresserzeugenden Situationen können darüber entscheiden, wie gut man damit zurechtkommt.
Immer wieder kommt es vor, dass ich Kinder aus dem Autismus-Spektrum schon im Vorschulalter erlebe, die mit eingefahrenen Glaubenssätzen zu kämpfen haben wie »Ich bin einer, der eben immer ausrastet« oder »So, wie ich bin, bin ich nichts wert!«. Diese Glaubenssätze haben eine toxische Wirkung auf das Selbstwertgefühl. Und natürlich kann so ein geschwächtes Selbstwertgefühl auch aggressiv und kämpferisch machen – vielleicht sogar als eine Art »gesunde« Reaktion auf etwas, was nicht gut ist. Nur kann ein mangelndes Selbstwertgefühl nicht dafür sorgen, dass man die eigenen Fähigkeiten wertschätzt und sich entsprechend seinen Potenzialen entwickelt.
Wenn dann auch in der therapeutischen Begleitung dieser jungen Menschen hauptsächlich Probleme und Defizite im Fokus stehen, ist diese Problemorientierung nicht nur stressauslösend, sondern dient eher der Stabilisierung der Probleme anstatt der Lösung. Analytische Rückblenden sind weniger zielführend als ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft durch Kompetenzerweiterung und Potenzialentfaltung.
Auch ist es eher hilfreich, wenn Lösungswege im gemeinsamen therapeutischen Prozess zwischen dem Klienten und dem Berater erarbeitet werden. Diese kooperative Beziehung ist ein wichtiges Element, um beim Klienten, der mit seiner autistischen Wahrnehmung sowieso schon ständig überlastet ist, nicht noch zusätzlichen Stress zu erzeugen.
Meine Grundüberzeugung ist, dass das Wahrnehmen und Fördern der Stärken zu deutlich mehr Selbstwertgefühl und Lebenszufriedenheit führen, als immer nur zu versuchen, die Schwächen zu reduzieren. Das beinhaltet auch, den Klienten Mut und Zuversicht zu geben, dass sie die eigenen Kräfte zur Entspannung aber auch zur Versöhnung mit dem »autistisch sein« aufspüren und nutzen.
Ein wichtiges Ziel in der Unterstützung von Menschen aus dem Autismus-Spektrum ist, dass sich die Betroffenen ihrer individuellen Stärken wieder bewusst werden und ihre vermeintlichen Schwächen als ihre »special effects« wertschätzen können. Im Sinne des Empowerments respektiert die Haltung von Anders ist eine Variation von richtig die eigenen Lebensentwürfe von Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Sie unterstützt diese dabei, individuelle Ziele zu verfolgen und die eigenen Stärken zu erweitern. Es gilt, achtsam zu klären, wie sich Grundbedürfnisse nach Verbundenheit und Geborgenheit, aber auch nach Freiheit und Autonomie erkennen und erfüllen lassen. Dabei ist es wichtig, belastende und einschränkende Gefühle zu überwinden, um so neue Energie zu gewinnen. Dazu benötigt jedoch ein Mensch, der felsenfest davon überzeugt ist, dass er ein »Master of Disaster« ist – also einer, der immer ausrastet –, eine geduldige, ressourcenorientierte Haltung von außen, dass er wieder Vertrauen in seine Fähigkeiten fasst.
Wenn Menschen aus dem Autismus-Spektrum nicht mehr nach ihren Defiziten klassifiziert und »behandelt« werden, sondern wenn man sie befähigt, ihre individuellen Kompetenzen zu erweitern und ihr ureigenes Potenzial zu entwickeln, dann hat sich in der Unterstützung dieser Menschen etwas gewandelt.
Diese neue Haltung – also in einem sicheren Rahmen autistische Fähigkeiten zu entdecken, um Kompetenzerweiterung und Potenzialentfaltung zu ermöglichen – erfordert zu Beginn einer Begleitung oder Therapie die genaue Klärung von Anliegen und Auftrag des Klienten, bzw. der Klienten. Denn bei Kindern und Jugendlichen sind ja auch immer die Eltern mitentscheidend für den Erfolg einer gelingenden Unterstützung.
Kernelemente einer erfolgreichen Unterstützung im Autismus-Spektrum:
•Anerkennung der höheren Stressanfälligkeit
•achtsamer Umgang mit sensiblen Bedürfnissen
•Auslöser für Überforderungen erkennen und nach Möglichkeit beheben
•Umgang mit unvermeidbarem Stress erlernen
•genaue Auftragsklärung in Bezug auf Art und Weise einer Unterstützung
•Wahrnehmung und Förderung der Stärken
•Empfinden für eigene Bedeutsamkeit stärken
•individuelle Kompetenzen erweitern
•Potenziale entwickeln
•Selbstwertgefühl und Lebenszufriedenheit stärken
Anliegen und Auftrag klären
Wenn Klienten sich therapeutische Hilfe wünschen, ist es immer wieder hilfreich, genau zu klären, welche Erwartungen an die Unterstützung sie formulieren. Erwachsene Klienten können ihre Wünsche bezüglich einer therapeutischen Begleitung meist klar äußern. In der therapeutischen Begleitung von Kindern und Jugendlichen hingegen merke ich bei der Auftragsklärung immer wieder, dass ganz unterschiedliche Erwartungen formuliert werden – je nachdem, wen ich frage.
Anliegen der Eltern
Die Eltern kommen in der Regel zu mir, weil das Kind in Kindergarten oder Schule solche Probleme hat, dass Eltern und das pädagogische Fachpersonal an ihre Grenzen stoßen. Sie sind besorgt, weil sie spüren, dass ihr Kind überfordert ist und unter der Situation leidet. Sie kommen aber auch, weil sie selbst mit diesen Problemen überlastet sind und nicht mehr wissen, wie sie mit dem Kind umgehen sollen. Sie verstehen das Verhalten des Kindes oftmals nicht und erhoffen sich Unterstützung. Ihre Vorstellung, wie sich das Problem auflösen könnte, ist häufig: Das Kind muss lernen, sich anders zu verhalten.
Von den Institutionen wie Kindergarten oder Schule erwarten sie, dass diese mit den Besonderheiten ihres Kindes besser umgehen können. Dagegen gehen die Institutionen oft davon aus, dass das Kind »nur« falsch erzogen ist, und erwarten, dass Eltern konsequentere Erziehungsarbeit leisten. Dort vertritt man die Ansicht, dass sich das Kind/der Jugendliche in die »Norm« einzufügen hat und sich mit Spaß und Freude an den Gruppenaktivitäten beteiligt oder sich zumindest ruhig und angepasst verhält. Bei Kindern aus dem Autismus-Spektrum wird schnell klar, dass das Kind diese Erwartung nicht erfüllt. Das Kind sondert sich ab, spielt im besten Fall für sich alleine oder zeigt vielleicht aggressives Verhalten gegenüber Gleichaltrigen oder sogar gegenüber den Erwachsenen. Das Kind »stört« also den gewünschten Tagesablauf, und dieser »Fehler« müsse behoben werden. In der Folge erleben die Eltern häufig ein Gefühl von Ohnmacht gegenüber den Institutionen.
Diese Vorstellungen und Erwartungen helfen nur leider in der Regel nicht weiter, um Probleme, mit denen ein autistisches Kind konfrontiert ist, zu lösen. Also gilt es, schon bei der Auftragsklärung mit den Eltern zu besprechen, welche Anliegen sie an die Unterstützung haben.
Anliegen der Familie können sein:
•Informationen über die Diagnose Autismus
•Analyse des individuellen Unterstützungsbedarfs
•autismusspezifisches, alltagsorientiertes Elterncoaching
•Unterstützung in Erziehungsfragen
•Stärkung von Handlungskompetenzen in Konflikt- und Krisensituationen
•Begleitung bei der Auswahl und Installation geeigneter Hilfen
•Teilhabemöglichkeiten für die ganze Familie
Manche Eltern sind über meine Fragen nach Ressourcen und Fähigkeiten ihres Sohns/ihrer Tochter verwundert, aber meistens können alle Eltern auch von Dingen berichten, die richtig gut gelaufen sind. Eine hilfreiche Orientierung bei der Suche nach weiteren Fragen und Lösungen sind für mich die drei Leitsätze, die Insoo Kim Berg und Steve de Shazer in ihrem Konzept der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie entwickelt haben:
1) Repariere nicht, was nicht kaputt ist!
2) Wenn etwas funktioniert, mache mehr davon!
3) Wenn etwas nicht funktioniert, wiederhole es nicht. Mach etwas anderes!
Besonders die Fragen nach dem, was schon funktioniert, oder besser, wann etwas funktioniert hat, sind hilfreich, um zu erforschen, mit welchen Problemen das Kind und seine Eltern zu kämpfen haben. Immer wieder suche ich daher in Beratungen mit Eltern nach Ansätzen, wo etwas schon gut geklappt hat. Das gleicht manchmal einer Detektivarbeit. Geeignet sind Fragen wie:
•Was läuft vielleicht trotz aller Probleme gut?
•Wann war es gut?
•Was war davor?