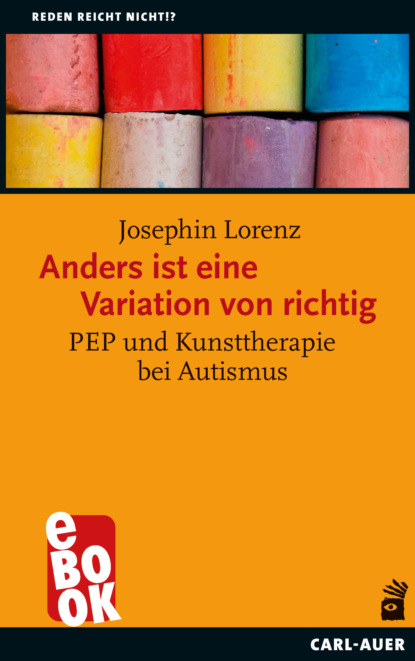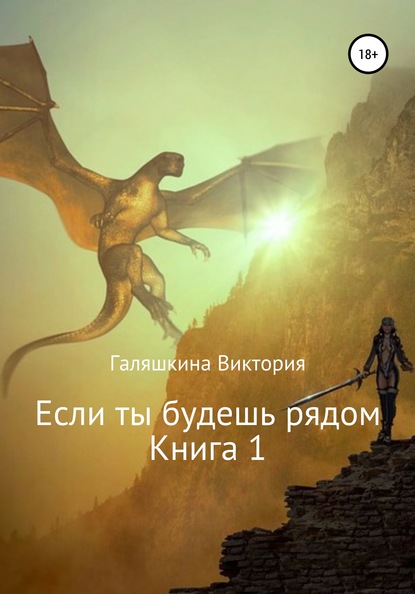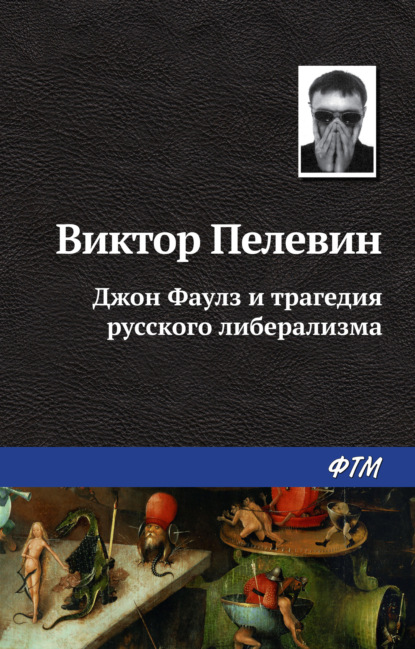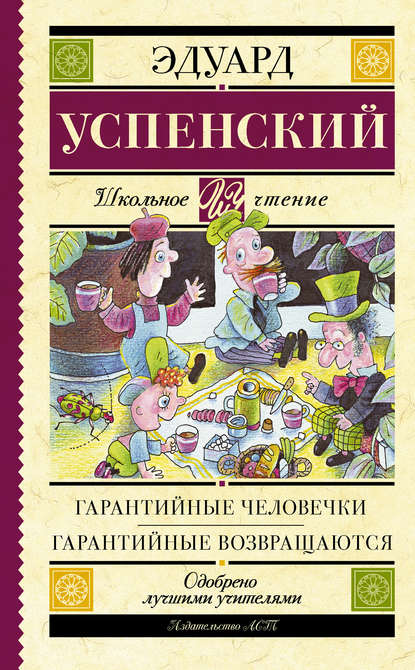- -
- 100%
- +
•Wie sah es dort aus?
•Wie war die Geräuschkulisse?
•Wer war dort?
Die Fragen scheinen manchmal banal, können jedoch Aufschluss darüber geben, wo das eigentliche Problem liegt. So rief mich eine Lehrerin nach den Herbstferien verzweifelt an und berichtete, dass mein Therapiemädchen plötzlich ständig den Unterricht stören würde. Gemeinsam fanden wir im Gespräch heraus, dass das Mädchen wohl durch den Ton der Neonbeleuchtung, die nach den Herbstferien morgens eingeschaltet werden musste, deutlich abgelenkt war. Da das Mädchen eine Schulbegleitung hatte, wurde verabredet, dass die beiden bei Bedarf das Klassenzimmer verlassen können.
Anliegen der Kinder und Jugendlichen
Eltern bzw. Sorgeberechtigte und das soziale Umfeld formulieren ihre Erwartungen, dass sich das Kind/der Jugendliche ändern soll. Interessanterweise haben die meisten Kinder ähnliche Wünsche. Die Erwachsenen sollen sich ändern, und dann sei alles ganz einfach!
Die Lösung für dieses Dilemma sollte nicht darin liegen, dass die Erwachsenen die jungen Klienten übergehen und nur selbst die Ziele definieren, die das Kind erreichen soll. Sie sind ebenso in der Verantwortung, eigene Wünsche und Erwartungen zu reflektieren, um so zu überprüfen, welche Handlungsmöglichkeiten sich in der Gemeinschaft auch für ein autistisches Kind eröffnen können. Und es gilt herauszufinden, was den Kindern und Jugendlichen wichtig ist, und sie mit ihrer Sicht der Dinge und ihren Anliegen dem jeweiligen Alter angemessen an diesem Prozess zu beteiligen.
Was will der junge Klient? Was genau soll sich verbessern? Denn darum »muss« das Kind ja zu mir kommen – weil sich etwas verbessern soll. Die Frage ist nur, wer oder was sich verbessern kann! Kann ein Kind sich vorstellen, was es sich von einer therapeutischen Begleitung wünscht? Kann es das schon in Worte fassen? Je nach Alter und Fähigkeit, sich mit Worten ausdrücken zu können, kann man diese Frage direkt stellen oder im Kontakt über nonverbale Ausdrucksformen (wie zum Beispiel im Spiel, beim Gestalten) klären.
Manchen Kindern fällt es sehr leicht, auf diese Fragen zu antworten. Sie sprudeln dann nur so vor Wünschen, was sich alles ändern soll. In ihren Augen sind es meistens die anderen Menschen, die sich ihnen gegenüber ungerecht verhalten. Sie können sich dann sehr ereifern, wie blöd, gemein und unmöglich diese Menschen sind. Sie fühlen sich unverstanden und wollen, dass sich das ändert. Aus ihrer Sicht müssen sich dazu natürlich die anderen ändern. Es gibt auch immer wieder Kinder, die sich wünschen, dass in der Schule weniger Anforderungen an sie gestellt würden. Und dann gibt es die, denen die Schule zu langweilig ist und die nach mehr intellektuellen Herausforderungen verlangen.
Und es gibt immer wieder junge Klienten, die ihre Wünsche nach Freundschaften oder im Jugendalter nach Partnerschaft und Liebe thematisieren. Die allgemeine Vorstellung, Autisten interessierten sich nur für Gegenstände und deren Eigenschaften und seien nicht an anderen Menschen und sozialem Miteinander interessiert, entspricht also nicht der Realität von Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Sicher gibt es viele dieser »Einzelgänger«, aber gerade Jugendliche aus diesem Spektrum thematisieren ihre Suche nach einem Partner/einer Partnerin. Sie wissen schon selbst, dass sie zu schnell zu sozialem Rückzug neigen oder Situationen vermeiden, in denen eine Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen möglich wäre. Sie wünschen sich Unterstützung dabei, wie sie mit der Überforderung und dem Stress umgehen können, der durch ihre besondere Wahrnehmung und Empfindlichkeit ihrer Sinne in sozialen Situationen ausgelöst wird. Dann gilt es, das Chaos menschlicher Gefühle, das durch (Liebes-)Beziehungen entstehen kann, gemeinsam zu sortieren und Strategien zu finden, die Freundschaften und Beziehungen ermöglichen.
Auch bei jungen Klienten ab einem Alter von 8 Jahren ist es wichtig, dass sie von Beginn der Therapie an wissen, dass sie weder passiv »behandelt« werden noch ich als Experte ihnen etwas »überstülpe«. Es geht mir darum, auf beiden Seiten – Klient und Therapeut – Klarheit über die Ziele der Therapie zu erhalten und diese zu benennen.
Je nachdem, wie stark die Haltung beim jungen Klienten ausgeprägt ist, dass die anderen alle doof sind – also auch ich als Therapeutin, muss ich mir etwas einfallen lassen, um mit dem jungen Klienten in Kontakt zu kommen. Die Kontaktaufnahme kann durchaus erst einmal nonverbal stattfinden. Das kann schon bei der Begrüßung anfangen. Eine »normgerechte« Begrüßung mit Handschlag kann für den Klienten schon die erste Überforderung im Kontakt sein. Oft sehe ich da bei meinen jungen Klienten ein erstes Augenleuchten, wenn ich einfach nicht meine Hand ausstrecke und auf einem höflichen Händeschütteln bestehe, sondern sie mit einem entspannten Winken mit der Hand begrüße. Es ist immer wichtig, achtsam zu registrieren, was dem Kind schwerfällt, um nicht etwas zu erwarten, was es nicht kann – wie zum Beispiel Augenkontakt, Stillsitzen oder das Ruhighalten seiner Hände.
Ich richte meine Kontaktaufnahme also auf die spezielle Erlebens- und Funktionsweise meines jungen Klienten aus. Wichtige Elemente für eine solche Kontaktaufnahme sind sicher sprachliche und spielerische Kreativität. Bei mitunter fehlender emotionaler Resonanz kann aber auch eine Haltung von Leichtigkeit oder ärgerlicher Zurückweisung der Beginn gemeinsamen kreativen Handelns sein. Wenn der junge Klient manches noch nicht in Worten ausdrücken kann, wird es dann auf einer nonverbalen Ebene vielleicht schon deutlich.
Mir ist es wichtig, gemeinsam zu erforschen, was hinter dem Wunsch liegt, »die anderen müssen sich ändern«. Meist können auch schon Grundschulkinder erfahrene Ungerechtigkeiten sehr genau formulieren, wenn ihre Ängste und Sorgen uneingeschränkt ernst genommen werden. Dabei geht es mir darum, den jungen Klienten zu unterstützen und sich nicht nur über sein Verhalten klarer zu werden, sondern auch das der anderen besser einordnen zu können. Gemeinsam suchen wir im Laufe der Therapie nicht nur nach möglichen Bewältigungsstrategien, sondern beschäftigen uns auch mit der Frage nach den dahinterliegenden Motiven.
Vor dem Hintergrund von Ergebnissen der Wirksamkeitsforschung, die den Wert des Arbeitsbündnisses in einer Therapie herausstellt, ist es wichtig, dass man die Kinder oder Jugendlichen im Laufe des Therapieprozesses immer wieder auf die verabredeten Ziele anspricht und prüft, ob diese Ziele so noch stimmen. Auf diese Weise erfahren die Klienten schon früh, dass es gut und wichtig ist, ihre autismusbedingten Bedürfnisse achtsam im Blick zu haben und sie wertzuschätzen.
Anliegen dieser jungen Menschen können sein:
•Entdecken von Fähigkeiten, Potenzialen und Ressourcen
•Stärkung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl
•Erlernen von Alltagskompetenzen
•Umgang mit den eigenen Besonderheiten und Belastungsgrenzen
•Lernen von Achtsamkeit und Entspannungsverfahren
•Üben von Perspektivwechsel und sozialer Interaktion
•Begleitung in Ablöseprozessen und Krisensituationen
•Suche nach passender Beschulung/Ausbildung/Studium
•Berufseinstieg meistern
Kontakt aufnehmen
Ungewohntes löst bei vielen Menschen – ob mit oder ohne Autismus – anfangs Angst und unangenehme Empfindungen aus. Die Situation, mit einem fremden Menschen Kontakt aufzunehmen – sei es auch mit einem Therapeuten, bei dem man Hilfe sucht –, kann unterschiedliche Emotionen wachrufen. Klienten aus dem Autismus-Spektrum, Erwachsene ebenso wie Kinder und Jugendliche, haben jedoch häufiger Schwierigkeiten, ihre Gefühle passend zum Ausdruck zu bringen. Sie wirken dabei bisweilen förmlicher oder gefühlsärmer, als sie in Wirklichkeit sind. Unverständliches Verhalten wird nachvollziehbar, wenn man es sich erklären lässt. Denn hinter vermeintlichen Provokationen steht oft einfach ein Missverständnis, das es zu klären gilt. Betroffene haben in der Regel nicht die Absicht, andere anzugreifen oder zu verletzen, sondern verstehen einfach nicht, wie sie reagieren sollen.
Die Frage ist dann: Vor welchen Herausforderungen steht der Betroffene gerade? Ist es womöglich das Gefühl, dass es dem Betroffenen wichtig ist, mit mir in Verbindung zu kommen, er aber nicht weiß, wie er das bewerkstelligen kann oder soll?
Der Erfolg einer Behandlung hängt, nach dem Konzept von Insoo Kim Berg und Steve de Shazer, maßgeblich von einer guten Beziehung zwischen Klient und Therapeut ab. Therapieerfolge können sich danach nur einstellen, wenn der Behandler mit dem Klienten kooperiert und dessen Anliegen wirklich ernst nimmt.
Es ist für Therapeuten sehr hilfreich, sich die Art der Beziehung zum Klienten genauer zu betrachten. Denn jeder der im Folgenden beschriebenen drei Interaktionsstile bedarf einer speziellen Haltung. De Shazer beschreibt in seinem lösungsfokussiertem Therapiekonzept drei verschiedene Stile, wie Klienten und Behandler in Beziehung treten können (de Shazer 2008):
1) Interaktion vom Typ des Kunden
2) Interaktion vom Typ des Klagenden
3) Interaktion vom Typ des Besuchers
So ist die Interaktion vom Typ des Kunden geprägt durch konkrete Veränderungswünsche des Klienten. Er leidet in unterschiedlichem Maße unter einem Problem, das er alleine nicht lösen kann. Oder er hat ein Ziel vor Augen, das er trotz seiner Bemühungen bislang noch nicht erreicht hat. Er hat auch schon eine Vorstellung davon, dass er selbst etwas zur Lösung beitragen kann. Aber er hat noch keine konkrete Idee, bzw. ihm fehlt noch die geeignete Methode, wie er sein Problem lösen oder sein Ziel erreichen kann.
Wenn junge Klienten einen konkreten Wunsch an mich herantragen, erkläre ich ihnen die Möglichkeiten, die sich eröffnen, wenn wir mit der Prozess- und Embodimentfokussierten Psychologie, kurz PEP, arbeiten. Bei Kindern, die sich mögliche Lösungen auf gestalterische Art erarbeiten möchten, beginnen wir mit kunsttherapeutischen Angeboten.
Wenn ein junger Klient in einer Interaktion vom Typ des Klagenden vor mir sitzt, benötigt er erst mal eine angemessene Würdigung seines bislang erlebten Leids. Gerade für Klienten mit einer Autismus-Diagnose ist es wichtig, dass der Behandler versteht, welche autismusbedingten Probleme der Klient hat, die von der Umwelt bislang nicht verstanden wurden. Nach meinen Erfahrungen kann sich das Gegenüber für meine Kreativangebote öffnen, wenn derjenige sich in diesem Leid angenommen fühlt. Im kreativen Gestalten kann der Klient in dem therapeutischen Setting dann möglicherweise erste Erfahrungen sammeln, wie er sich selbst als Handelnder erlebt.
Oft stellt eine kreative Gestaltung jedoch schon ein derartig großes Hindernis dar, dass es erst mal hilfreich ist, nach den Interessen des Klienten zu fragen. Die Beschäftigung mit den Spezialinteressen gibt dem Klienten oft die nötige Sicherheit, sich in der ungewohnten Therapiesituation auch neuen Themen zu öffnen. Gerade bei Jugendlichen ist es immer hilfreich, sie bei den Themen »abzuholen«, mit denen sie sich gerade gerne beschäftigen. Sie können sich so entscheiden, mit welchem Thema sie in die Beziehung zum Therapeuten einsteigen. Dieses erste aufkommende Gefühl von Selbstwirksamkeit beim Klienten ist entscheidend, um eine gute Beziehung zwischen Therapeut und Klient aufzubauen.
Bei der Interaktion vom Typ des Besuchers stellt der Beginn eines Beziehungsaufbaus eine größere Herausforderung dar. Dieser Kliententyp scheint ja aus seiner Sicht selbst gar keine Probleme zu haben. Es sind ja die anderen, die »Idioten«, die »bescheuert« oder eben »einfach ätzend« sind. Kinder und Jugendliche sind von Eltern geschickt, oder die Lehrer sind daran schuld, dass man zur Therapie muss. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion ist oft nicht bzw. kaum ausgeprägt. Kreative Angebote werden dann als langweilig, nervig oder sinnlos abgewiesen.
Oft konnte ich jedoch feststellen, dass ein solcher, nach außen zwar cooler, nach innen jedoch eher ängstlicher, abwehrender Klient schnell in einen ruhigeren Zustand wechselt, wenn er in irgendeiner Form Verbundenheit wahrnimmt. Schließlich ist es ein Grundbedürfnis aller Menschen – mit oder ohne Autismus. Dieses Wahrnehmen von Verbundenheit eröffnet dann neue Möglichkeiten für die Kommunikation. So beobachtete ich z. B. bei Dennis3 (14 Jahre) ein Strahlen in den Augen, als ich ihn nach seinem Lieblingsfilm fragte und wir uns wunderbar über die lustigen Szenen im Film austauschen konnten.
Findet man nicht schnell genug eine Gemeinsamkeit, kann die Betonung darauf, wie bemerkenswert es ist, dass sie doch gekommen sind und mit dem Therapeuten reden, ein erster Schritt sein, doch noch in eine wertschätzende Beziehung zu kommen. Haben diese Klienten ein Spezialgebiet, erweist sich das als sehr hilfreich. Bei kleineren Kindern ist immer das Angebot des Spielens wichtig. Wobei es auch da wichtig ist, mit dem autistischen Kind zu kooperieren und dessen ganz eigene »Spielbedürfnisse« wertzuschätzen.
Während, bzw. zum Abschluss des ersten Kennenlernens, erkläre ich auch, dass der junge Klient und seine Eltern sich in Ruhe zu Hause darüber unterhalten können, ob sie sich bei mir verstanden fühlen und der Klient die Therapie aufnehmen möchte. Mit der Möglichkeit, dass sie diese Frage nicht sofort klären müssen, respektiere ich mögliche, autismusspezifische Schwierigkeiten, wie z. B., sich nicht schnell entscheiden zu können. Diese Fragestellung ist meist ein guter Indikator dafür, ob die Beziehungsaufnahme bereits gelungen ist. Wenn sich der Klient schon in der Stunde für den Beginn der Therapie entscheiden kann, ist die Beziehungsaufnahme bereits geglückt. Manchmal ist aber auch genau diese Möglichkeit, sich erst zu einem späteren Zeitpunkt telefonisch oder per Mail melden zu können, das Zeichen für den Klienten, dass hier seine autismusspezifischen Bedürfnisse geachtet werden.
Am Ende des Erstgesprächs verabschiede ich mich sehr wertschätzend, indem ich zusammenfasse, was mir bei dem jungen Klienten und seiner Begleitperson an konstruktiven Eindrücken und besonderen Ressourcen aufgefallen ist und was sie in dieser ersten Stunde bei mir geleistet haben.
»Es hat mich tief beeindruckt, dass du uns so genau beschreiben konntest, wie es dir in der Schule ergangen ist und welche Gefühle das in dir ausgelöst hat.«
»Es ist bemerkenswert für mich, wie du diese fremde Situation hier gemeistert hast!«
Diese wertschätzende Haltung ist nicht nur für den Klienten wichtig. Es ist mir als Therapeutin wichtig, die positiven Fähigkeiten und Ressourcen eines jungen Klienten deutlich wahrzunehmen und zu benennen. Ich bin überzeugt, dass diese Grundhaltung, von Anfang an Potenziale in den Fokus zu nehmen, eine Art »Brücke« zwischen dem Gegenüber und mir bauen kann. Es ist manchmal geradezu rührend zu sehen, wie meine kleinen Klienten vor Stolz übers ganze Gesicht strahlen oder auf einmal ein ganzes Stück größer scheinen.
Zusätzlich kann dieses Wissen später für mich immer wieder zur Leichtigkeit beitragen, wenn autismusspezifische Schwierigkeiten uns in einen »Es-verändert-sich-gar-nichts-Strudel« zu reißen drohen.
Bedürfnisse ernst nehmen
»Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.« Dieses Zitat aus dem wunderschönen Gedicht »Stufen« von Hermann Hesse gilt auch für mich in jeder Therapiestunde mit einem neuen Klienten. Mir ist es wichtig, dass er sich mit seinen Wünschen und Fähigkeiten zeigen kann. Damit er sich öffnen kann, ist es hilfreich, wenn der Therapeut achtsam mit möglichen autismusspezifischen Bedürfnissen umgeht.
Im Vorfeld einer therapeutischen Intervention ist es wichtig zu klären, welche Sinneseindrücke im Therapieraum für den Klienten Stress auslösen können, und sie ggf. zu beheben. Denn tickende Uhren, lauter Autolärm durch ein offenes Fenster oder zu helles/zu dunkles oder zu kaltes/zu warmes Licht beeinflussen seine Befindlichkeit womöglich zusätzlich.
Jeder Klient kommt mit seinen ganz individuellen Wahrnehmungen, Vorstellungen, Bildern und Sichtweisen. Insofern sollte man diese achtsam kennenlernen.
So beschwerte sich zum Beispiel eines meiner Therapiekinder, als ich die Lampe über dem Maltisch auf ein warmes, gelbliches Licht dimmte, dass er doch kein Grillhähnchen sei, das geröstet werden soll! Also stellten wir die Lichtintensität auf sein Bedürfnis ein. Ein Jugendlicher hingegen fühlte sich durch den kühleren Farbton der Lampe an die Arktis erinnert. Wenn diese modernen, verstellbaren Lampen dann kein zusätzliches Geräusch erzeugen, sind sie perfekt für eine angenehme Beleuchtung im Therapieraum.
Es kann natürlich auch passieren, dass man als Therapeut in eine Zwickmühle kommt, da ja jeder Klient unterschiedliche Bedürfnisse haben kann.
Zum Beispiel hat sich ein junger Klient zur Weihnachtszeit bei mir beschwert, dass der Therapieraum ja überhaupt nicht weihnachtlich geschmückt sei. Gemeinsam bastelten wir etwas, das seinen Ansprüchen für Weihnachten genügte, und hängten es, nun beide zufrieden und beruhigt, auf. Der Jugendliche, der im Anschluss kam, war da völlig anderer Meinung. Er war von den vielen Weihnachtsaktivitäten restlos überfordert und drohte nun schon beim Anblick des Weihnachtsschmuckes und der Kerze, in Panik zu geraten. Nun kann man natürlich darauf hinweisen, dass es doch möglich sein muss, unterschiedliche Geschmäcker zu akzeptieren. Doch gerade bei autistischen Menschen kann die Wahrnehmung durch bestimmte Reize so überfordert sein, dass einfach kein Gefühl von Sicherheit aufkommen kann.
Eine für den Klienten angenehme Umgebung bildet auch eine gute Grundlage zur wertvollen Zusammenarbeit. Da die Empfindlichkeiten bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum sehr unterschiedlich sind, gilt es hier sensibel nachzufragen bzw. selbst achtsam auf möglicherweise überfordernde Sinneseindrücke zu sein.
Frau Preißmann (2007) beschreibt dies aus ihrer persönlichen Erfahrung:
»Abgelenkt haben mich lange Zeit die Bücher (meiner Therapeutin), die in zwei Regalen stehen. Anfangs hat sie sie oft umgeräumt, was mich immer sehr irritiert hat. Mittlerweile macht sie das zum Glück nur noch selten. Die zwei Bilder, die ich von meinem Sessel aus sehen kann, hängen manchmal schief, was mich ebenfalls irritiert. (…) Wir scheinen oft so sehr in uns versunken, aber wir registrieren sehr genau, was um uns herum geschieht. Viel zu genau vielleicht.«
Viele Kinder und besonders die Jugendlichen kommen mit einem unsicheren Gefühl zur ersten Therapiestunde. Oft steckt eine Angst dahinter, was wohl von ihnen verlangt wird. Auf ihre eigene Art und nach ihren Möglichkeiten suchen auch sie nach einem Gefühl von Verbundenheit. Wenn sie merken, dass ich zum Beispiel ihre Spezialinteressen aufgreife oder auf bestimmte Dinge verzichte, die sie nicht leisten können, nehme ich einen ersten »Funken« von Aufeinander-Zugehen und In-Verbindung-Treten wahr.
Jeder von uns weiß, dass wir in einer unbekannten Umgebung oder Situation innerlich wieder ruhiger werden, wenn wir spüren, dass wir wohlwollend aufgenommen werden. In diesem Zustand wird in unserem Gehirn das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Dieser Botenstoff beruhigt die Amygdala – das Angstzentrum des Gehirns. Anders ausgedrückt: Das Gefühl von Verbundenheit schafft die Voraussetzung für angstfreies, kreativ-entspanntes Handeln. Über das Teilen von positiven Erfahrungen gelingt dann leicht der Einstieg in eine gute Beziehung, die ja als maßgeblich für eine gelingende Therapie angesehen wird.
Ich erkläre daher am Anfang immer, was wir zusammen machen könnten. Über Zeichnen und Malen, Plastizieren, Fotos machen, Filme erstellen oder … oder … oder … – der Kreativität sind bei mir (fast!) keine Grenzen gesetzt. Ich erkläre den Kindern, dass ich es wichtig finde herauszubekommen, worin man wirklich gut ist. Denn nur in dem, was einem Spaß macht, ist man wirklich gut. Meistens löst sich die Spannung dann schon ein wenig. Da ich von Natur aus dazu neige, zu viel zu reden, lege ich das im Erstkontakt auch immer offen und mache den Kindern Mut, mir, wenn ich zu viel rede, bitte ein Zeichen zu geben, dass ich den Mund halten soll. Dabei registriere ich dann meistens ein weiteres entspanntes Ausatmen. Je nach Art des Ausatmens spreche ich das dann schon konkreter an – wie zum Beispiel mit der Frage, ob es dem Kind öfters so geht, dass zu viel geredet wird. Wenn das der Fall ist, schaut es mir vielleicht für Bruchteile von Sekunden in die Augen, und ich sehe ein kleines bejahendes Leuchten in seinen Augen. Wenn ich keine Reaktion auf meine Frage wahrnehmen kann, erzähle ich weiter, dass ich von Natur aus sehr neugierig bin und viele Fragen stelle. Aber dass es mir auch sehr wichtig ist, dass das Kind genau überlegt, ob es mir die Frage beantworten will oder nicht.
Wichtige Aspekte für einen guten Kontakt
•Einfühlungsvermögen und Empathie: Wahrnehmung des emotionalen Zustands einer Person, auch auf manchmal noch subtile Signale, die auf unterschiedliche Grade von Regulation und Fehlregulation hinweisen
•Anliegen genau klären: Wer hat welches Problem? Was wünscht sich das Kind, was kommt von den Eltern? Was ist hilfreich? Berücksichtigung der unterschiedlichen Interaktionen zwischen Klient und Therapeut nach Steve de Shazer (s. o.)
•offene und direkte Kommunikation: klare Sprache verwenden, das heißt, auf Ironie und Floskeln verzichten, bei Verwendung von Metaphern und Redewendungen das Verständnis beim Klienten klären, Nachfragen bei Unklarheiten
•»Warum?«: widerständiges Verhalten nicht einfach als aufsässig etikettieren, sich die Mühe machen herauszufinden, was dem Verhalten zugrunde liegt; Wissen um Zustände autistischer Überlastungen mit einbeziehen
•gemeinsame Kontrolle: Entschleunigung, Zeit geben, Antworten geduldig abwarten, Sie teilen die Kontrolle mit der Person und leiten sie nach Bedarf an. Überlässt man dem autistischen Menschen in vielfältigen Situationen und Settings die Kontrolle, führt das letztlich zu mehr Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung.
•Humor: Nicht jede Überlastungsreaktion wird durch die Katastrophenbrille betrachtet. Viel hilfreicher – sowohl für das Kind als auch die Familie – ist es, wenn die Menschen im Umfeld ihren Sinn für Humor bewahren.
•Vertrauen: Es ist wesentlich, von Beginn an zuzuhören, dem Klienten mit Respekt zu begegnen und gleichzeitig die Familie als Partner anzusehen.
•Flexibilität: Wichtig ist folgende Erkenntnis. Wenn Plan A nicht funktioniert, ist es Zeit, zu Plan B überzugehen.
In der Regel ist das der Moment, wo die Kinder und die meisten Jugendlichen in eine Beziehung zu mir einsteigen können. Ich erkläre, dass ich offen bin für die unterschiedlichsten, gemeinsamen kreativen Ausdrucksformen. Auch erkläre ich gleich zu Beginn, dass ich bestimmte Sachen nicht akzeptiere. Gemalt wird zum Beispiel nicht auf meiner Hose oder auf der weißen Tapete. Möglichst schnell versuche ich, bei den Kindern und Jugendlichen herauszubekommen, welche Talente und Interessen sie mitbringen und in der Therapie zum Ausdruck bringen können oder wollen, was sie gerne machen bzw. mit mir machen möchten.
Natürlich spielen für das Gelingen der Kontaktaufnahme auch persönliche Qualitäten des Therapeuten eine große Rolle. Dabei sind emotionale Wärme, Echtheit, Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz auch für Menschen aus dem Autismus-Spektrum wichtige Kriterien. Denn auch sie erkennen sehr genau, ob sie als Persönlichkeit wohlwollend aufgenommen werden.
3Alle Namen in den Fallbeispielen sind geändert.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.