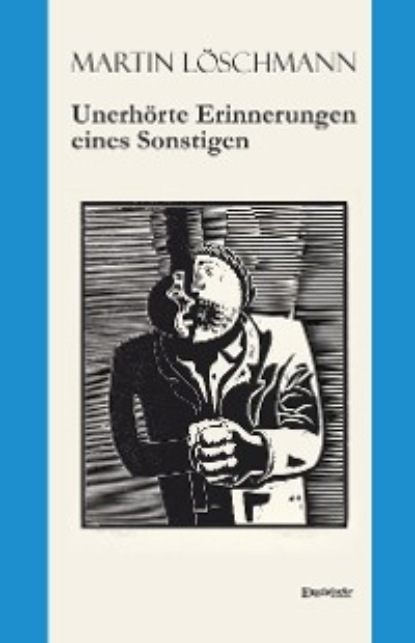- -
- 100%
- +
An unserem ehemaligen Besitz wieder angekommen, bedanken wir uns artig bei Frau Flissakowski für die freundliche Aufnahme und versprechen wiederzukommen. Und wir kamen schneller als gedacht wieder. Ein Jahr darauf machten wir uns gleich mit zwei Autos auf den Weg, mit Schwester Gisela und ihrem Mann Wolfgang, also Familie Fuhrmann mit Tochter Britta, Löschmanns mit Sohn Jörg und Nabil, unserem syrischen Familienmitglied, ehemals Student am Herder-Institut, einer der besten im Jahrgang 1967/68. Sein Volkswagen war das zweite Auto. Der Reiz der Fahrt bestand für mich vor allem darin, dass ich den anderen das zeigen konnten, was sie bisher nur aus Erzählungen kannten, außer mir hatte lediglich Gisela eigene Erinnerungen daran.
Große Ernüchterung überkam mich als Fremdenführer. Beim ersten Besuch hatte ich spontan erklärt: Der nächste Sommerurlaub wird in Ugoszcz verbracht, ich werde Janucs bei der Ernte helfen. Es muss überzeugend geklungen haben, sonst hätte Marianne nicht dermaßen vehement reagiert: „Ohne mich.“ Im Moment des Aussprechens dieser Ferienaussicht war an deren Ernsthaftigkeit nicht zu zweifeln. Heute weiß ich, der unterdrückte und fast völlig vergessene Bauernsohn in mir hatte sich in vertrauter Umgebung ein Ventil gesucht. Ganz und gar klar war mir schon damals, es führt kein Weg zurück, auch nicht nach erfrischender Abkühlung im Pfaffensee, dem Badesee im Gegensatz zum Dorfteich, auf halber Strecke nach Studnice.
Am Pfaffensee hatten wir einst im nahe gelegenen Erbsenfeld bei schönstem Sonnenschein Aale überrascht und zwei, drei mit Knüppeln erschlagen, nachdem Harald uns versichert hatte, es seien keine Schlangen. Oder waren es tatsächlich welche? Jedenfalls zeichnet Aale ein extrem zähes Wanderverhalten aus, das sie zu Landgängen befähigt. Du suchst wohl ein Gegenstück zu Günter Grass’ verwestem Pferdekopf. Nein, ich will keine Legenden stiften. Wie bestechend die Szene in der Blechtrommel literarisch sein mag, Aale sind keine Aasfresser, sie verstecken sich bestenfalls in einem Kadaver, was früher durch das Auslegen von Tierschädeln zum Fang genutzt wurde. Ob es nun Aale waren oder nicht, Krebse gab es auf jeden Fall. Im Bach, der sich durch das Dorf schlängelte, fingen wir im Sommer Flusskrebse. Da sie dämmerungs- und nachtaktiv sind, mussten wir sie in ihren Verstecken unter Steinen und Geröll, in das Flüsschen ragenden Baumwurzeln aufstöbern, von hinten packen und in den Eimer werfen. In der Küche wurden sie in kochendes Wasser geworfen, nicht länger als fünf Minuten und die leuchtend rot erstrahlenden Krebse waren zum Essen bereit, durch geschickte Drehbewegungen die Schwänze und Scheren vom Körper gelöst, um an das zarte Fleisch heranzukommen. Bei uns zu Hause war Krebsessen nichts Besonderes, ein Angebot der heilen Natur.
Ich bin dann doch noch einmal nach Bernsdorf gekommen, und zwar 2006 mit meiner damals 83jährigen Schwester, die sich im Juni in Bad Polzin an der Ostsee zusammen mit ihrem Mann Christian einer Kur unterzog. Wir besuchten sie dort und verwirklichten an einem recht kühlen Tag einen Plan, der mehrmals geschmiedet, bislang aus den verschiedensten Gründen nicht erfüllt worden war – zwei Jahre nach dem EU-Beitritt Polens.
Als wir uns auf den Weg nach Bernsdorf machten, hatte sie längst erkennbar mit unserem Heimatort abgeschlossen. Sie hatte vieles von mir und anderen gehört bzw. gelesen, war zu Treffen der Pommerschen Landsmannschaft gereist, doch in die Jahre gekommen, fiel es ihr nicht schwer, sich von dem Erinnerungsband Spatzen Pellkartoffeln. Als Kind auf der Flucht aus Hinterpommern von Eckehard Oldenburg, ein Jahr jünger als ich, zu trennen. Der Autor, Sohn ihres Biologie- und Englischlehrers an der Mittelschule in Bütow, war bei seinem Onkel August von Mroczek in Bernsdorf, kurz bevor der Krieg in unser Dorf kam, und ist zusammen mit uns auf die Flucht gegangen. Im Gegensatz zu mir konnte er sich auf Aufzeichnungen seines Großvaters stützen und Flucht, Rückkehr und Vertreibung aus des Großvaters und seiner eigenen Perspektive erzählen.
Woran Irla sich nicht alles erinnerte, während wir durch die gefällige Endmoränen-Landschaft mit den vielen kleinen und großen Seen fuhren. Welch ein Enttäuschung für sie, als wir vor dem Hof standen, die Ställe, die Scheune, der Speicher und der riesengroße Misthaufen in der Mitte verschwunden, alles plattgemacht, eine saftige Grasnarbe bedeckte den für uns historischen Grund. Das Haus angemessen rekonstruiert. Es wirkte viel einladender als unser ehemaliges Haus, der Vorgarten gleichermaßen. Wertsteigerung allemal. Andererseits hatte das alles nichts mehr mit uns zu tun. Im wahren Sinne des Wortes: Gras war darüber gewachsen. Leider waren die jungen Leute unterwegs, die sich auf unserem ehemaligen Anwesen eingerichtet hatten, wie uns ein Dorfbewohner berichtete. Ich denke, es war gut so, denn keine Frage, im Haus wurde ebenfalls vieles verändert. Von Flissakowskis war niemand mehr da, Janusc auf dem Friedhof, mein damaliger Arbeitgeber auch. Der Bahnhof stillgelegt.
„Mit unserem Besuch in Bernsdorf/Bütow habe ich noch lange zu tun gehabt“, schrieb Irla in ihrem Brief vom 26. Juli 2006, „innerlich muss es mich doch sehr bewegt haben. Vielleicht hätte ich doch lieber die alten verfallenen Gebäude an ihrem alten Platz plus Plumsklo und Backhaus mit den alten Bäumen gesehen, weil die Umgebung des Wohnhauses eben fremd war. Aber ich habe gestaunt, was noch alles in meinem Gehirn geruht hat. Viele Namen von Bernsdorfer Einwohnern kamen zum Vorschein. Fast allen konnte ich ein Haus zuordnen, neben uns vor der katholischen Kirche wohnten Dargatz, Lüdtke und Stangohr. Martin, sind Dir die Namen noch ein Begriff?“ Nein, sind sie nicht. Mir schießt der Gedanke durch den Kopf: Sprechen wir von Heimat, ist immer Verlust mit im Spiel. Eine zweite Heimat gibt es eigentlich nicht.
Hier und jetzt wird endgültig ein Schlussstrich gezogen. Ich werde meinen Geburtsort nun nie wieder besuchen. Es gibt kein Erbe mehr. Der Erbhofbauernsohn wurde nach dem Umschwung mit 4.000 DM von der Kohl-Regierung abgespeist. Erstaunlich, dass gerade diese Regierung die Vertriebenen völlig gleichstellte. Unabhängig von dem, was sie besessen und verloren hatten, bekamen alle DDR-Bürger und -Bürgerinnen aus den ehemaligen Ostgebieten des deutschen Reiches die einmalige pauschale Abfindung. Jenny Neumann, eine ehemalige Kollegin – wohl aus Schlesien kommend – hat das Almosen mit der Begründung abgelehnt: Mit der Empfangsbestätigung würde man sich seiner Ansprüche begeben. Ich erhebe keinen Anspruch auf mein Erbe in Hinterpommern, das sei an dieser Stelle besonders all den 61,5 Prozent Polen versichert, die sich nach mehr als 60 Jahren Kriegsende weiterhin vor deutschen Besitzansprüchen fürchten.
Ich fahre mit meinem Neffe Gernot zu dem Restaurant, wo das festliche Essen anlässlich des 80. Geburtstages meiner Schwester stattfindet, durch eine prächtige Villengegend Hamburgs: „Onkel Martin, siehst du dort drüben diese Jugendstilvilla? Da wohnt ein Kollege von mir, hat die Villa von seinen Eltern geerbt.“ Ich habe das Fazit einer statistischen Untersuchung parat und biete sie Gernot verschmitzt lapidar, quasi als Trost an: „Die Werte, die in den neuen Bundesländern nach dem Tod weitergegeben werden, sind vielfach geringer als in den alten.“

Ohne Schlittschuhe in den Krieg geschlittert
Es ehrt unsere Zeit, dass sie genügend Mut
aufbringt, Angst vor dem Krieg zu haben.
Albert Camus
„Opa, wie hast du den Zweiten Weltkrieg erlebt?“, hatte mich Julika 2003 in einer E-Mail aus Chiang Mai gefragt. Im Geschichtsunterricht in ihrer internationalen Schule wurde der 2. Weltkrieg behandelt und im Rahmen einer Projektarbeit sollten Zeitzeugen befragt werden. Allein, wie vermittelt man Vierzehn-, Fünfzehnjährigen vieler Herren Länder in Thailand Kriegserlebnisse aus ferner Zeit und fernem Ort? Wie soll sich ein Großstadtkind wie Julika, ein Friedenskind, das Leben in Kriegszeiten in einem kleinen Dorf vorstellen können, in einer Gegend, deren Namen sie nie gehört hat. Ein Gott verlassenes Nest, wie soll sie sich da hineinversetzen?
Wie erzählt ein Großvater seiner Enkelin vom zweiten Weltkrieg, den sie aus dem Geschichtsbuch als einen von vielen Kriegen kennen lernt und der für sie vorab durch die vorgesetzte ZWEI relativiert wird? Jaja, der Ansatz, ein Enkelkind vor Augen über große Ereignisse in unserem Leben zu berichten, ist nicht gerade originär. Wer hat nicht alles versucht, sich über von Nachkommen eingeforderte Erinnerungen zu definieren. Ich denke an Jürgen Kuczynskis Anfang der 80er Jahre veröffentlichten kritischen Dialog mit meinem Urenkel, in der DDR geradezu verschlungen und 1997 mit schwarzen Marginalkennzeichnungen erschienen, die von der DDR-Zensur entfernte Stellen markierten. Ach, da fallen mir sofort andere Namen ein: „Im Leben sammelt sich was an“, sagt in Erwin Strittmatters Laden der Großvater zu seinem Enkel Esau, als der von seinen schriftstellerischen Ambitionen berichtet. Nach unserem Chinaaufenthalt fiel mir Der Kaiser von China von Tilman Rammstedt, Ingeborg-Bachmann-Preisträger, in die Hände: Aus der Höhlenperspektive, nämlich unterm Schreibtisch schlafend, essend, wohnend, beginnt ein Keith, die Hauptfigur in diesem Roman, das Leben seines Großvaters aufzurollen.
Mein Großvater war stets beleidigt, wenn man nicht auf ihn gehört hatte, dabei konnte man nie auf ihn hören, weil er einem immer erst im Nachhinein mitteilte, was man alles hätte anders machen sollen, aber ihn habe ja keiner gefragt, und schau, jetzt bist du nass, und schau, jetzt haben wir uns verfahren, und schau, jetzt bin ich tot.
Ich begann so: Als sich der Krieg ernstlich in mein Leben einmischte, näherte sich mein zehnter Geburtstag. In unserem kleinen Dorf hatte ich lange kaum etwas vom Krieg gespürt. Bedenke, ich war mal gerade vier, als der Krieg ausbrach. Mein erstes „Kriegserlebnis“ hatte ich im ersten oder zweiten Kriegsjahr. Mein Vater und einige Dorfhonoratioren saßen in der Wohnstube, um eine Rede Hitlers aus dem Radio, dem sogenannten Volksempfänger, zu hören. Uns Kinder kümmerte es wenig, wer da sprach und aus was für einem Gerät die Stimme kam, wir spielten vor dem Schlafgehen schnell noch Verstecke. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. 1 – 2 – 3 – ich komme! Zuerst versteckten wir uns in der Küche, darauf im Wohnzimmer. Verstecke ohne Geschrei ist, keine Frage, die halbe Freude, also immer kräftig mit Gebrüll durch die Stube. Mein Vater ermahnte uns leise zu sein. Man wollte kein Wort Hitlers verpassen, schließlich hatte der bis dato ausnahmslos Siege zu verkünden. Wir jedoch waren von unserem Spiel derart gefangen genommen, dass wir uns nicht bremsen konnten. Plötzlich sprang mein Vater auf, griff zum Siebensträhner, der ständig bedrohlich hinter der Anrichte im Wohnzimmer hing. Meinen größeren Schwestern gelang es, nach oben in ihr Zimmer zu flüchten. Ich wollte mich der Reichweite des mir bekannten Instruments gleichfalls entziehen, erreichte die Rettung verheißende Treppe, spürte aber schon den Atem meines Vaters im Nacken. Völlig unkontrolliert verpasste er mir fünf oder sechs Hiebe, während ich mit einem Bein eine Stufe nehmend nach oben stolperte. Gott sei Dank blieb er unten stehen und setzte mir nicht weiter nach, möglicherweise weil ich wie am Spieß schrie oder weil er schnell wieder zur Rede zurück wollte. Oben angelangt, zeigten sich Gisela und Renate, um mich zu trösten, indem sie die gestriemten Stellen bepusteten und Schmerzlinderung versprachen. Zu schreien hörte ich nicht eher auf, bis Irla mir klar machte, dass mein Weinen Vater dermaßen stören könne, dass er gleich noch einmal auftauchen würde.
Bernsdorf verfügte über einen Bahnhof und unsere Felder grenzten ein ganzes Stück lang an die Eisenbahnstrecke. Züge erwarten und beobachten, während ich die Kühe hüten musste, war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Sie kamen aus einer unbekannten Welt, tauchten aus dem Wald auf, der unsere Felder nach Norden hin abschloss und fuhren in eine andere Welt, die uns jetzt zwar verschlossen, eines Tages aber erreichbar sein würde. Der absolute Höhepunkt war es immer wieder, wenn wir einen flachen Gegenstand auf das Gleis legten und die Veränderungen bestaunten, nachdem der Zug drüber gefahren war. Geldstücke waren geradezu ideal. Da mussten Münzen besorgt werden, und das war kein leichtes Unterfangen. Es konnten Tage vergehen, bis einer von uns einen Groschen aufgetrieben hatte. Wie oft haben wir das Ohr auf die Schienen gedrückt, um festzustellen, ob sich der planmäßige Zug oder gar ein Güterzug näherte, der zeitlich nicht vorauszubestimmen war. Eines Tages stellten wir etwas Neues an den Güterzügen fest. Über mehrere Waggons hinweg war zu lesen: Räder müssen rollen für den Sieg, denn es ist Krieg. Mehrmals haben wir den Satz in Weidenbaumrinde geschnitzt. Das war eine willkommene Abwechslung zur Pfeifenherstellung aus Weidenstöcken.
Meine Eltern wie andere geradeso wurden immer öfter aufgefordert, allerlei Dinge zu spenden. Was man im Krieg so braucht: Wolldecken, Handschuhe, Pulswärmer für die Soldaten, die im unerbittlich harten Winter in Russland kämpften. Kindersachen waren nicht gefragt.
Irgendwann hieß es, man brauche in Zukunft eine Schlachtgenehmigung. Richtig einschränken mussten wir uns deshalb anscheinend nicht, jedenfalls habe ich davon nichts gespürt. Als Bauern waren wir weitgehend Selbstversorger, immerhin besaßen meine Eltern den zweitgrößten Bauernhof und waren die reichsten Bauern im Dorf, da der größte Hof arg verschuldet war. Das bringt Kati aus der letzten Begegnung mit meiner nunmehr über 90 Jahre alten Schwester mit.
Ein französischer Kriegsgefangener tauchte auf unserem Hof auf. Irgendwo im Dorf gab es ein Gefangenenlager, einer der Gefangenen war Marcel, der bei uns schuftete. Als Gegenleistung wurde er verpflegt, billige Arbeitskraft dieser freundliche Mann aus Frankreich. Allzu gern wüsste ich, was aus ihm geworden ist – das schreibend, werde ich von der Erkenntnis überrascht: Der Wunsch nimmt erst beim Schreiben Gestalt an. Was soll’s, ich kenne nicht einmal seinen Familiennamen.
Einmal bin ich mitten in der Nacht von einem furchtbaren Lärm, durchsetzt mit Schreien, aufgewacht. Ich habe mich gefürchtet und zog die Bettdecke über den Kopf. Mir ein Herz fassend, stand ich schließlich auf und folgte den Schreien, öffnete ängstlich die Tür zur Küche, hinter der ich und wie sich zeigte zu recht etwas Furchtbares vermutete. Zwei Männer in Uniform und mein Vater standen um einen Gefangenen herum, einer der Uniformierten hatte einen Schlagstock in der Hand und holte gerade aus, als mein Vater mich in der Tür bemerkte und mich zurück ins Bett scheuchte. Am nächsten Tag gab es für die nächtliche Störung folgende Erklärung: Mehrere Gefangene seien aus dem Lager ausgebrochen, einen davon habe man in einem unserer Kornfelder in der Abenddämmerung gestellt und in die Bürgermeisterei gebracht. Man habe ihn verhört und durch Schläge versucht herauszubekommen, wie die Flucht bewerkstelligt worden sei und wo sich seine mit ihm geflohenen Gefangenen versteckten. Er habe zwar fürchterlich geschrien, als er gepeitscht wurde, herausgepresst haben sie wohl nichts aus ihm. Er wurde in die Kreisstadt überstellt, wie es im Gendarmen-Deutsch hieß.
Vor Marcel schon war ein polnischer Jugendlicher unserem Hof ‚zugeführt‘ worden. Adam wurde er genannt, kaum über 15. Wie er zu uns kam, weiß ich nicht. Mein Vater hätte mir keine Antwort gegeben, „Das verstehst du noch nicht, dafür bist du zu klein.“ Meine Mutter, die ihrem Mann nicht widersprechen wollte, verstrickte sich in vagen Andeutungen: Adam sei elternlos und verwahrlost in Warschau von deutschen Soldaten aufgegriffen und wie andere polnische Jungen und Mädchen in einer deutschen Familie untergebracht worden. Dass man ihn wie einen Knecht behandelte, blieb uns natürlich nicht verborgen. Wir Kinder fühlten uns zu ihm hingezogen, damit meine ich mich und meine Schwester Gisela – deine verstorbene Großtante, Julika. Er war für uns eine Art älterer Bruder, kam aus einer anderen Welt, aus dem Wald, aus dem die Züge heranstampften, drei, vier Jahre jünger als mein Bruder Dietrich, der, nach Notabitur zum Offizier ausgebildet, an die Ostfront kam und 1945 in Russland gefallen ist. Adam spielte in seiner Freizeit oft mit uns: Räuber und Gendarm z.B. Wir bewunderten ihn, wenn er etwas Verbotenes tat und das passierte nicht selten. Er rauchte gern, am liebsten Zigarren. Um uns seine Zuwendung zu erhalten, klauten wir aus der Zigarrenkiste meines Vaters ab und an eine dicke Zigarre für ihn. Heute weiß ich, dass er sich mehr zu Renate, meiner zweitältesten Schwester, hingezogen fühlte, sie war in seinem Alter. Er gab ihr mehrfach zu verstehen und freute sich dabei über die Schockwirkung, die seine Drohgebärde auslöste, er würde sie heiraten, sobald er achtzehn und volljährig wäre. Als der Krieg zu Ende war, hat Renate große Angst ausgestanden, er würde als Sieger sein angedrohtes Versprechen wahrmachen. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie froh Renate über sein spurloses Verschwinden war. Dass Adam ein Recht auf Wiederkehr und Wiedergutmachung hatte, steht auf einem ganz anderen Blatt. Mehr als fünfzig Jahre dauerte es, bis polnischen Zwangsarbeitern von deutscher Seite aus eine Entschädigung für die geleistete Fronarbeit gewährt wurde. Wäre es nach dem Vorschlag von Manfred Gentz Daimler-Chrysler gegangen, hätte Adam keinen Anspruch gehabt; nach diesem Vorschlag sollte nur Geld empfangen, wer „unter Gefängnis ähnlichen Bedingungen“ schuften musste. Und davon konnte auf unserem Hof keine Rede sein, dennoch ist Adam für mich das lebendige Beispiel für die Deportation von Zwangsarbeitern.
Konkrete Gestalt nahm der Krieg für mich an, als die ersten Flüchtlinge aus Gebieten weit weg in unser Dorf kamen, aus Ostpreußen, wo der Krieg bereits hingekommen war. Sie suchten meistens ein Nachtlager, das ihnen durchaus gewährt wurde, erwartungsgemäß auch bei uns im Haus und in der Scheune. Doch sah man sie lieber weiterziehen als zwei Nächte in unserem Dorf verharren. Sie mussten Essen, die Pferde Futter bekommen.
Diese eigentlich nicht gern gesehenen Flüchtlinge berichteten über Gräueltaten der Russen, der russischen Armee: Kindern würden die Ohren abgeschnitten, Erwachsenen habe man die Zunge herausgedreht, als sie nicht reden wollten. Der Name Nemmersdorf, dem ersten von der sowjetischen Armee eroberten Dorf in Ostpreußen, tauchte immer öfter in ihren Berichten auf. Schreckliches musste dort passiert sein. Das verfehlte nicht seine Wirkung auf uns, waren es doch immer wieder Kinder, denen die Russen Grauenvolles angetan hätten.
So Furcht erregend die Schilderungen waren, sie wurden in ihrer Wirkung abgeschwächt, weil sie an dem vorsorglich errichteten Wall der Gewissheit abprallten, dass der Krieg nicht bis zu unserem Dorf kommen würde. Von einer Wunderwaffe war die Rede, die alles richten würde, vom Endsieg. Meine Eltern gaben sich gleicherweise dieser Hoffnung hin. Der Ernst der Lage wurde erst zu dem Zeitpunkt begriffen, als ein russisches Flugzeug ungehindert über unser Dorf flog und die Kreisstadt Bütow bombardierte. Ich weiß nicht, wie viele Male sich Reichsmarschall Hermann Göring hätte Meier nennen müssen: „Wenn auch nur eine Bombe auf Deutschland fällt, will ich Meier heißen.“ Wo blieb die deutsche Abwehr? Bei Bütow stand irgendwo die Flak, sie war weithin zu hören. Schrecken konnte sie die russischen Bomber offensichtlich nicht, die Luftangriffe wiederholten sich. Unser Dorf blieb weitgehend verschont, sieht man von Freitag, dem 2. März 1945, ab. An dem Tag mussten alle Deutschen das Dorf verlassen.
Schon im Februar durfte Irla weg, ging mit ihrem am 11. Januar 1945 geborenen Sohn Gernot auf die Flucht, zusammen mit meiner 82jährigen Oma. Zu dieser Zeit war es noch möglich, mit dem Zug zu reisen, jedenfalls gab es Züge, in die man einsteigen konnte. Spätestens da wurde meinen Eltern allmählich klar, der Krieg würde um uns keinen Bogen machen. Stell dir vor, Julika, wenige Tage nach der Geburt mussten Mutter und Baby das schützende Haus verlassen und sich der Kälte, der Ungewissheit, dem sich anbahnenden Chaos aussetzen. Von allen Seiten strömten Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten westwärts. Irla und Gernot fanden zunächst bei einer Tante in der Nähe von Köslin, in Kavelsberg eine Bleibe. Mit dem Vorrücken der Roten Armee mussten sie auch von dort fliehen und landeten endlich in dem Dorf Hohenaspe in Schleswig-Holstein, nicht weit entfernt von Itzehoe, wo sie heute lebt. Dass ihr Mann nicht wiederkehren würde, erfuhr sie viel später.
Der 2. März also war der unheilvolle Tag. Eckehard Oldenburg, der in Bernsdorf mit uns auf die Flucht ging, wie sich der aufmerksame Leser erinnern wird, schreibt in seinem Buch:
Während wir uns versammelten, und laufend noch weitere Treckwagen, Einheimische wie Flüchtlinge, eintrafen, tauchten erneut russische Tiefflieger auf und beschossen uns mit ihren Bordwaffen. Ausgerechnet den Bürgermeister Löschmann traf ein Granatsplitter genau ins Kreuz, doch seine dicke Winterjoppe verhinderte zu seinem Glück ein tieferes Eindringen. Eine Bombe schlug zudem dicht hinter dem Anwesen Kosins mit dumpfen Getöse in eine moorige Wiese, so dass der gefrorene Morast in hohem Bogen über uns hinwegflog.
Einige Tage nach meinem Geburtstag hatte es geheißen, das Dorf wird geräumt, viel zu spät, wie sich bald herausstellte. Die Deutschen mussten fliehen, die kaschubischen Dorfbewohner und die Fremdarbeiter wie Adam blieben, sie hatten nichts zu befürchten, im Gegenteil, sie konnten damit rechnen, nach Hause zurückzukommen.
Weil die Front bedrohlich näher kam, musste auf einmal schnell gepackt werden. Das eine oder andere war wohl schon vorbereitet, zum Beispiel Pökelfleisch, das ich nicht mochte, in Milchkannen an die Wagen gehängt. Da wir sechs Pferde besaßen, hätten meine Eltern mit drei Wagen voll beladen losziehen können. Aber im Dorf gab es Leute, die weder Pferd noch Wagen besaßen. Sie wurden auf die Bauernhöfe verteilt, die Fuhrwerke hatten. Meine Eltern boten den Familien eine Mitfahrgelegenheit, die auf unserem Hof gearbeitet haben. Stellmacher Wedel hatte Wohnung und die kleine Werkstatt von meinem Vater gemietet. Ihm wurde der dritte Wagen zur Verfügung gestellt.
Wie wenig meine Eltern ernstlich auf die Flucht vorbereitet waren, konnte man daran erkennen, dass wir keine überdachten Wagen hatten, wie man sie aus vielen Filmen kennt, sondern einfache Leiterwagen, wie man sie zur Einbringung der Ernte benutzte. Sie boten nicht den besten Schutz vor Wind und Kälte, obwohl man die warmen Sachen und auch das Futter für die Pferde so verstaute, dass der eisige Wind möglichst wenig Schlupflöcher fand. Gefährlich auf vereisten Straßen zudem, weil die Wagen keine Bremsen hatten. Und damals waren die Winter wirklich kalt. Als wir loszogen, lag tiefer Schnee und in der Nacht herrschten 10 – 20 Minusgrade.
Weil der Packraum arg begrenzt war, hieß es, wir Kinder dürften nur je ein Spielzeug mitnehmen. Ich wählte meine Schlittschuhe aus, ich hatte sie gerade zu Weihnachten bekommen. Bei uns im Dorf liefen fast alle Kinder Schlittschuh. Das konnte man gut und gern drei bis vier Monate lang auf Teichen, Seen und glatten Straßen. Ein Traum war für mich in Erfüllung gegangen. Ich übte jeden Tag und machte gute Fortschritte. Mit der Flucht stand mir eine große Reise bevor. Rundum toll fand ich die Vorstellung, sich an das Pferde-Fuhrwerk zu hängen und über die Straßen zu schlittern, ohne sich allzu sehr anzustrengen. Natürlich war das ein verbotenes Vergnügen. Ich malte mir aus, wie ich mit meinen untergeschnallten Schlittschuhen über die glatten Straßen ins Rettende schlittern würde. Bevor ich die Schlittschuhe mein eigen nennen durfte, war ich mit den Schuhen über die glatten Flächen geschlittert. Der Ausdruck wurde beibehalten. Wir liefen nicht Schlittschuh, sondern wir schlitterten. Was für eine Vorfreude auf die Flucht und wie hab’ ich geweint, als meine Mutter zu guter Letzt entschied, dass ich meine heißgeliebten Schlittschuhe nicht mitnehmen durfte. Sie wurden zusammen mit dem guten Geschirr und anderen Gegenständen nachts in einem Hohlraum unter der Diele versteckt. Meine Mutter tröstete mich, wir kommen bald zurück, dann bekommst du deine Schlittschuhe wieder. Sie sollte nur zum einem Teil recht behalten, wir kamen bald zurück, von meinen Schlittschuhen und all den versteckten Sachen keine Spur.