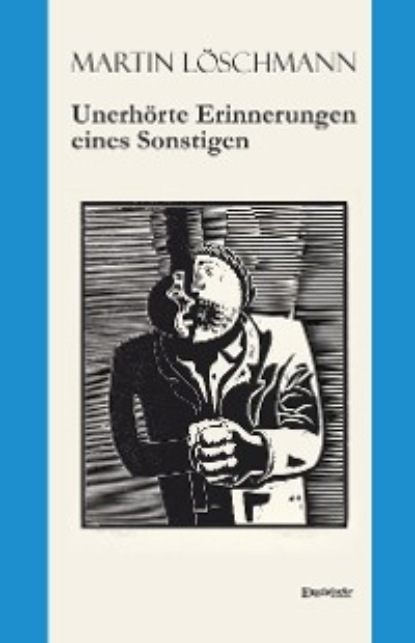- -
- 100%
- +
Nabil gehört zur Familie und muss eingeladen werden. Alle waren sich einig und freuten sich sehr, als er zusagte. zweifelsohne hätte er seine Familie aus Kanada mitbringen können. Es unterblieb, zumal wir keinen nennenswerten Kontakt haben zu seiner Frau und den Töchtern, nicht einmal zu Rania, der Tochter aus der ersten Ehe mit Corinna. Corinna Harfouch dagegen kam als Überraschungsgast und bereicherte das Treffen.
Der Ablauf der Veranstaltung ist schnell berichtet: Unterbringung ‚der Auswärtigen‘ im Hotel Ibis in der Prenzlauer Allee, Brunch in unseren vier Wänden, einstündige Dampferfahrt auf der Spree durch die Berliner Innenstadt, historische Stadtmitte, Museumsinsel, Regierungsviertel und zurück; am Abend dann der Höhepunkt: Abendessen im Speisezimmer von Herr Bielig, freundliches Familienunternehmen, in Hotelnähe, Wohnzimmeratmosphäre, an der Wänden Fotos von Herrn Bieling und seinen Lebensstationen, dem Vater der beiden Betreiberinnen der Restauration. Ein Foto mit dem Namensgeber hatten wir allerdings durch mein Porträt in Öl ersetzt, auf das mich der russische Maler Bogomassov während seines vierwöchigen Besuchs 1976 als „satten Intellektuellen“ (des Malers Interpretation) gebannt hatte. Da das Porträt, das in unserer Wohnung hinter der Couch stand, den meisten unbekannt war, musste es trotz seiner eigentlich unangemessenen Größe (150 x 100) erst einmal nicht auffallen, ergab einen Gag zu späterer Stunde.
Die Gaststätte schuf von Hause aus einen angemessenen Rahmen für ein derartiges Treffen, verwies irgendwie auf den bäuerlichen Erbteil der hier Versammelten. Dass das Essen begrenzt, eher armselig daherkam, die Wirtinnen uns mit einer groben Verletzung des Preis-Leistungsverhältnisses konfrontierten, war freilich enttäuschend und gewissermaßen bloßstellend vor den lieben Verwandten. Allein der nächste Morgen richtete es mit dem Brunch im italienischen Restaurant Istoria am Käthe-Kollwitz-Platz gleich um die Ecke. Zusätzlich zur üppigen Auswahl an Gerichten stellte Marianne reichlich frischen Kaviar aus Tomsk auf den Tisch, den ich vor ein paar Tagen mitgebracht hatte.
Natürlich muss eine kurze Ansprache sein. Ich bin aufgeregt, spreche vom Sinn, von der Vorbereitung, vom Verlauf des Treffens, stelle fest, dass ich mit 14 von den Anwesenden blutsverwandt bin, zitiere, um den verdächtigen Begriff Blutsverwandtschaft zu ironisieren, Karl Kraus „Das Wort Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit“, was nicht ankommt. Den zweiten Spruch „Das Familienleben ist ein Eingriff in das Privatleben“ flechte ich erst gar nicht ein. Stelle die Altvorderen, Erna und Max Löschmann, vor, ordne mich als jüngstes und Irla als ältestes Kind ein, spreche über Dietrich, Renate und Gisela, die nicht mehr unter uns sind und alle unter uns sein könnten, wenn, ja wenn …
Nach dem Essen kommt Hesses Gedicht Stufen an die Reihe, das alle im Raum vertretenen Generationen berührt:
… und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne/Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten/An keinem wie an einer Heimat hängen/Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise/Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen/Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden/Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Anschließend darf jede Familie maximal zehn Fotos aus dem jeweiligen Familienalbum präsentieren. Die Familie von Britta und Carsten Müller aus Jena hatte die gute Idee, die enge Vorgabe 10 voll auszureizen, indem sie Collagen aus mehreren Fotos darbot.
Bei der Zusammenschau wird deutlich, dass es in unserer Familie relativ viele Lehrerinnen und Lehrer gibt und ich frage mich, ob diese Tendenz aus der früheren Wertschätzung des Berufes auf dem Dorfe herrührt. Von einem Lehrergen in unserer Familie spreche ich nicht. Der Lehrberuf kam durch Heirat in die Löschmannsche Familie. Eine Schwester meines Vaters heiratete einen Lehrer Jeschke, Paul Jeschke, der nach dem Krieg in St. Peter Ording lebte und über den eines Tages in der Hallenser Bezirkszeitung Freiheit zu lesen war, dass er die Prügelstrafe praktiziere. Da war in der DDR jegliche körperliche Züchtigung längst verboten
Irlas erster Ehemann war Lehrer, kam aus einer Lehrerfamilie und genoss bei den Schwiegereltern hohes Ansehen. Für den Sohn Gernot stand früh die Entscheidung für den Lehrerberuf fest. Tochter Birge fällt nicht weit vom Stamm: wird Lehrerin. Nichte Britta ist mit Leib und Seele Lehrerin, leitet heute eine Reformschule, schenkt uns ein Buch Ein neuer Jenaplan. Befreiung zum Lernen, in dem sie mit einem Beitrag Grundsätze vertreten ist. Wen heiratete Britta? Selbstredend einen Lehrer, Carsten Müller, Mathematiker, promoviert und Direktor eines Gymnasiums in Jena. Wen wundert es, die eine der beiden Müllers Töchter, Christiane wird Lehrerin.
Und Jörg und Kati ebenfalls in eine Lehrerfamilie hineingeboren: In Mariannes Familie gab und gibt es in jeder Generation Lehrerinnen, möglicherweise ist es hier, das Lehrergen. Antje, die Tochter von Mariannes Schwester Adelheid, setzt als Englisch- und Russischlehrerin in ihrer Linie die Tradition fort. Selbst Michael, ihr Bruder, studierte Philosoph, war er nicht kurzzeitig lehrend tätig, bevor ihn der Systemwechsel in vollkommen andere Bahnen lenkte?
Als Sohn Jörg geboren wird, studieren beide Elternteile mit dem Ziel, Lehrer zu werden, als Tochter Kati drei Jahre später das Licht der Welt erblickte, waren ihre Mutter Lehrerin für Geographie und Geschichte an einer Leipziger Tagesheimschule und ihr Vater Deutschlehrer am Herder-Institut mit der amtlichen Bezeichnung Dozent am Herder-Institut, das klang schon mal nach was.
Kati als praktizierende Psychotherapeutin wird sich bestimmt wehren, wenn ich meine, dass ihr Beruf nicht so weit entfernt vom Lehrerberuf, zumindest z.T. ein Beruf mit einem ‚Lehrauftrag‘ ist und letztlich hat auch Jörg beim Goethe-Institut immer mit Lehre zu tun.
Obwohl ein engagierter Lehrer, zog es ihn in die Kulturarbeit. Bester Beweis seine Ausstellung mit Künstlern aus Südostasien, die über Chiang Mai und Bangkok hinaus vom 22. Oktober bis 30 Januar 2005 in Berlin gezeigt wurde: Identity versus Globalisation? Die über 60 beteiligten Künstler und Künstlerinnen mit ihren Werken hatte Jörg in engen Kontakt mit ihnen ausgewählt. Als Quereinsteiger hatte er die Ausstellung kuratiert in Zusammenarbeit mit seiner Frau Heike, die 1999 die Leitung des Regionalbüros Südostasien der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Chiang Mai übernommen hatte. Bei der Eröffnungsveranstaltung im Ethnologischen Museum tritt uns Dr. Jörg Löschmann als Kurator entgegen und gibt eine Einführung in die zeitgenössische Kunst aus Südostasien. Nach dem offiziellen Teil raunt uns eine Expertin ungefragt zu, die uns in Chiang Mai bei einer Party kennen gelernt hatte: „Brillant, was Ihr Sohn da vorgetragen hat, sie können stolz auf ihn sein. Um seine Karriere müssen Sie sich keine Sorgen machen.“ Schmeichelhaft für die Eltern. Von seinem Interesse an bildender Kunst und seinem Wissen darüber haben wir häufig profitiert.
In einer überbordenden Auseinandersetzung, in der Julika ihren Vater sicherlich treffen wollte, hielt sie ihm vor, er sei ja letztlich „nur“ Lehrer. Die Ursachen für die allenthalben zu beobachtende Geringschätzung des Lehrerberufes in Deutschland sind gewiss vielfältig, mir fallen ein: die z.T. im Verhältnis zu anderen akademischen Berufen geringere Entlohnung, weniger Aufstiegsmöglichkeiten. Wie oft habe ich nicht hören müssen: Ehrlich gesagt, ich hätte auf den Lehrerjob keine Lust. Lehrer wäre für mich nichts. Wieso bist du, Martin, überhaupt mit einem Einser-Abitur Lehrer geworden?
Ursprünglich wollte ich in meiner kurzen Rede auf das schwarze Schaf bzw. die schwarzen Schafe eingehen, die es in jeder Familie mehr oder minder zwangsläufig gibt, weil durch den Kontrast das Charakteristische, das soziale Erbe einer Familie insofern sichtbar gemacht wird, als das ‚schwarze Schaf‘ dieses ignoriert, durchbricht, überschreitet. Ich habe letztendlich davon Abstand genommen, weil ich unnötigen Polarisierungen aus dem Wege gehen wollte. Deshalb spielte Onkel Hugo bei dem Treffen keine Rolle, obgleich er es verdient hätte.
Onkel Hugo, der Bruder meines Vaters, erheiratete sich in Morgenstern einen Bauernhof, indem er die Schwester meiner Mutter heiratete, die Doppelhochzeit wurde schon thematisiert. Nachdem ihm seine Frau weggestorben war, verkaufte er kurzerhand den Hof. Vom Erlös leistete er sich u.a. ein schickes Motorrad und einen Lederanzug plus Fliegerkappe, angelte sich eine Haushälterin, Martha, die er nach der Vertreibung in der Bundesrepublik endlich ehelichte. Besonders von den Kindern, von den Bauernjungen wurde er bewundert; jedes Mal, wenn er ins Dorf hineinknatterte, liefen wir zusammen und bestaunten seine Maschine, eine Dürkopp?
Ich kann mich freilich nur schemenhaft an Onkel Hugo erinnern. Eigenartigerweise: Je älter ich werde, desto stärker konturiert sich für mich sein Lebensweg, der diametral dem meines Vaters gegenüberstand. Für meine Eltern war er fraglos das schwarze Schaf, weil er sich – für sie unfassbar – der Verantwortung für den Hof entzog. Er wurde zwar nicht wie der Bock im alten Israel, auf den man die Sünden der Gemeinschaft übertrug, jedes Jahr vom Oberpriester rituell in die Wüste gejagt, gleichwohl auf Distanz gehalten. Er kam mindestens einmal in zwei Wochen zu Besuch, eine Provokation besonders im Sommer, wenn die Ernte im vollen Gange war und er sich zum Abendessen einlud, er schaute einfach mal vorbei, was kümmerte ihn die Arbeit der anderen. Er hatte die Plackerei auf dem Hof satt, suchte eine Alternative, fand und lebte sie unweit vom Hof seines erfolgreichen Bruders. Wie dichtete Friedrich Freiherr von Logau im 17. Jahrhundert „Brüder haben ein Geblüte, aber selten ein Gemüte.“
In den Augen meiner Eltern war er ein arger Tunichtgut, entgegen allen Annahmen jedoch nach dem Krieg zur Stelle: versorgte uns in Bernsdorf ab und an mit Wild, vornehmlich Hasen, mithilfe selbst gebastelter Fallen trotz Verbots seitens der Polen gefangen, fühlte sich für die Familie seines Bruders verantwortlich. Lange vor uns konnte er nach dem Krieg das Land verlassen, landete im Westen und wollte uns alsdann von Zeitz aus in den vermeintlich verheißungsvolleren Teil Deutschlands holen. Die Ablehnung meiner Mutter hing, da bin ich mir fast sicher, mit seiner Person zusammen. Im Innersten verzieh sie ihm nie, dass er nach dem Tode ihrer Schwester, die mehr oder weniger zur Heirat gezwungen worden war, den Hof verhökert und sich dem Müßiggang ergeben hatte. Er schien ihr nicht vertrauenswürdig, nicht zuverlässig. Ihre Aversion wurde durch den Versuch, sie auf ihren Westreisen mit dem Bruder seiner Frau zu verkuppeln, sicherlich verstärkt. Er war am Leben geblieben, ihr Mann, unser strebsamer Vater, Vater von fünf Kindern, im Krieg umgekommen.
Ich bedauere bis heute, dass ich ihn nicht besucht habe, als es noch ging. Andererseits stellten sich in der Jugend die heutigen Fragen nicht. Nicht, dass ich ihm hätte nacheifern wollen, da war ich zu sehr Sohn meines Vaters, indes seine Beweggründe, aus der bäuerlichen Familientradition auszuscheren, hätten mich echt interessiert.
Es gab Zeiten, wo ich die elterliche Familie mit ihren Verwandten – den in Erzählungen und Romanen oft apostrophierten Familienrat – vermisst habe. Ein Familienrat als Vaterersatz, mir fehlte der Vater. Die enge familiäre Bindung in anderen Kulturen hat mich gelegentlich abgeschreckt, aber am Ende meines Lebens kommt mir zum Bewusstsein, die Patchworkfamilie, das Singledasein, die Lebensgemeinschaften ohne Trauschein, hin und her, zur Erziehung von Kindern bedarf es Vater und Mutter, in welcher Beziehungsform auch immer.
Lange Zeit war ich auf der Suche nach einem Ersatzvater und fragte mich, warum mein älterer Vetter Hans Gutzmer nicht auf die Idee kam, sich um unsere Familie zu kümmern. Der Ritterkreuzträger war in der Bundesrepublik, in München, in die Wirtschaft eingestiegen, Mitglied eines renommierten Wirtschaftsklubs in Deutschland. Als er sich schließlich bequemte und aus der Ferne für mich den Eintritt in die Bundeswehr vorschlug, war ich entsetzt. Alles andere schien denkbar, nicht der freiwillige Eintritt in eine Armee, gleich welcher Couleur. Warum hatte er für mich allein den Vorschlag Bundeswehr? Zu spät, ich kann ihn nicht mehr fragen, er starb 2004 im Alter von 87 Jahren.
Ein anderer Verwandter, ein Onkel, stellte die Existenz von Vernichtungslagern für Juden im sog. Dritten Reich in Abrede. Er las mir einen Brief vor, aus dem hervorgehen sollte, „ins KZ seien nur Kriminelle und Arbeitsscheue gekommen“. Wahrscheinlich fühlte er sich durch mich provoziert. Da kommt ein Grünschnabel daher und will den Verwandten im Westen erklären, wer schuld am 2. Weltkrieg war, dass im Osten mit der Enteignung des Großkapitals die entscheidende Ursache von Kriegen aus der Welt geschafft sei und dass sich die Verbrechen der Nazis nicht wiederholen dürften. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mir damals das Argument aus dem Ahlener Programm der CDU von 1947 nicht zur Verfügung stand, wonach „das kapitalistische Wirtschaftssystem den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden“ sei.
Man mag heute darüber lächeln, ich wollte aktiv mithelfen einen neuen Krieg, jedweden Krieg, um wie viel mehr einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Eine Form meines persönlichen Engagements war eine Zeitlang das Briefeschreiben: aufklärerische Briefe, für die ich mich heute wegen ihrer begrenzten Argumentationskraft bestimmt schämen würde, bekäme ich sie denn zu Gesicht. Gern möchte ich heute wissen, was genau ich als Oberschüler der neunten oder zehnten Klasse an Harald Wedel z.B. schrieb, dem bereits erwähnten Sohn unseres Ortgruppenleiters, der – hieß es – ins Großkapital oder war es der Landadel eingeheiratet hätte. Es würde mich wundern, wenn ich ihn nicht auf die Kriegsgefahr hingewiesen hätte, die er durch seine Heirat heraufbeschwöre. Er hat mir nicht geantwortet, der Brief ist auch nicht zurückgekommen. Vermutlich wurden meine Briefe wegen ‚kommunistischer Friedenspropaganda‘ aussortiert und vernichtet, wie es millionenfach in den ersten zwei Jahrzehnten der Bundesrepublik geschah. Aus der Sicht dieser Verwandten muss ich das schwarze Schaf gewesen sein
Es wäre reizvoll, überlege ich, bei einem zweiten Familientreffen (von keiner Seite bisher wirklich angestrebt) ein Rollenspiel zu initiieren:
Wer wäre denn gern das schwarze Schaf im gegebenen Familienverband geworden oder möchte es werden? Und wenn ja, wie viele?
Kati, die Schauspielerin hätte werden können, würde bestimmt den Reigen beginnen. Ein Ansatz: das angedrohte oder versuchte Hinwerfen der Dissertation kurz vor deren Abschluss. Das geschah in der Zeit der großen Veränderungen, in die sie aktiv eingebunden war. Ihr Vater, der 12 Promovenden und Promovendinnen zum erfolgreichen Abschluss geführt hatte, konnte gar nicht anders, als sie zum Weitermachen trotz aufregender und aufgeregter Zeiten zu ermutigen. Was musste der nicht alles wegstecken: Für mich beginne der Mensch erst beim Doktor vor dem Namen, war nicht der schlimmste Vorwurf.
Julika, allmählich auf die dreißig zugehend, weiß noch immer nicht recht, was sie wirklich will. Sie erklärte bereits im zarten Alter von sieben oder acht der versammelten Runde ihrer promovierten Großfamilie kategorisch: „Doktor werden wie ihr alle will ich nicht, auf keinen Fall“. Doch kein Doktor sein zu wollen ist fraglos kein Maß für ein schwarzes Schaf.
Janis, ihr Bruder, hat sich nicht davon beeinflussen lassen, verfolgt konsequent sein Ziel und steckt derzeit – 2014 – mitten in der Promotion.
Hanna, nach dem Umzug von Coburg nach Chemnitz, als die Mutter dort ihre Praxis eröffnete, legte sich die Latte tiefer, wechselte mehr oder minder munter zwischen den Schulformen: Gymnasium – Realschule – Gymnasium – Fachgymnasium. Was hat sich Hanna nicht alles an Argumenten anhören müssen, Wirkung zeigte das wenig, schon gar nicht mein Verweis auf wissenschaftliche Untersuchungen unter Jugendlichen, wonach mit steigender Bildung die Zufriedenheit mit dem persönlichen Leben wachse. Ich will mich lieber nicht als Prophet betätigen, wundern würde mich nicht, wenn sie als vorerst einzige den Löschmann’schen Nachkriegsstammbaum ohne Abitur ziert und einen anderen Weg geht.
Jörg und Kati wären überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, kein Abitur zu machen, jedenfalls kam mir nichts Derartiges zu Ohren. Birge, Britta, Christiane, Gernot, Maren, Olaf, Wiebke und wie sie alle heißen, höchstwahrscheinlich auch nicht. Dass Olafs Söhne studieren werden, scheint sicher wie das Amen in der Kirche. Hanna in dieser Beziehung das aktuelle schwarze Schaf? Kaum einer im engeren Familienkreis will es wie ich sehen. Wer habe nicht alles das Abitur geschmissen: Thomas Mann verließ das Lübecker Gymnasium Katharineum vorzeitig, Theodor Fontane gehört zu den Schulabbrechern, Einstein nicht vergessen.
Jörgs Aussteige-Ambitionen wurden nach dem Abitur ernst und kamen radikal daher. Eines Tages zog er aus der elterlichen Wohnung aus und bewies Vater und Mutter, dass es in der DDR, in Leipzig, in der Windscheidstraße, möglich war, mit einer Gang eine Wohnung zu finden und darin zu leben, ohne sich polizeilich anzumelden. Am Tag des Umzugs hatte ich einen Termin in Berlin und Marianne musste die Last seines Ausstiegs allein tragen: „Nur nicht weinen, keine Vorwürfe, keine Drohungen, eine Flasche Sekt spendieren und den Abschied gestalten.“ Es gelang, ein Kumpel äußert sich: „Du, so furchtbar finde ich deine Mutter gar nicht.“
Nach einigen Wochen, in denen wir uns große Sorgen um unseren Sohn machten, zog er wieder bei uns ein. Gern möchte ich davon ausgehen, dass ihm unser, in diesem Fall behutsames Vorgehen half, den Weg zurückzufinden. Wir haben ihn besucht, als wäre sein Auszug etwas eher Alltägliches, haben ihn zum Essen eingeladen, ihn nicht als schwarzes Schaf betrachtet, wozu ich in dieser kritischen Zeit gelegentlich neigte. Rational sah ich ein, dass wäre der falsche Weg gewesen, emotional sträubte sich in mir vieles, die Tür nicht zu verschließen. Nichts wäre falscher gewesen als das, da hatte seine Mutter Recht.
Man muss sich schon fragen, was ist in einem solchen Fall falsch gelaufen: Überforderung, zu harsche Durchsetzung von Forderungen an einen jungen Menschen, vor allem Unterschätzung von Aushandlungsstrategien. Was immer den Ausschlag gegeben haben mag, ein Absetzen von der Familie, gleich welcher Gestalt, ist ein natürlicher Vorgang im Prozess des Erwachsenenwerdens, die Art und Weisen sind verschieden. Man agiert auch als Elternteil nicht im zeitlosen Raum, kann sich schwer von den eigenen Bindungen und Erfahrungen lösen, macht Fehler, die, wenn überhaupt, erst im Nachhinein als solche erkannt werden.
Unser Sohn wähnte sich lange im Glauben, er hätte gewusst, wie wir ihn richtig hätten erziehen können, ja müssen. Den Glauben haben wir ihm nicht erschüttern können, das vermag nur das Leben selbst – böser, alter Elternspruch: Unsere Enkel werden uns rächen. Tochter Julika geht ihren eigenen Weg, oder sollte ich schreiben: geht ihre eigenen Umwege. Eines Tages brachte sie allen Vätern und Müttern der Familie das Buch von Alice Miller Das Drama des begabten Kindes mit. Abgesehen von der bewegenden Biografie der Autorin, stießen wir in ihrem Buch auf diskussionswürdige Ansichten, mit denen uns Julika allein ließ. Offensichtlich wollte sie uns zu verstehen geben, dass sich Kinder am besten ohne Anforderungen von außen entwickeln. Wir lesen in diesem Buch:
Ein Kind soll in seinem eigenen Wesen gestützt und gefördert werden. Sofern sich das Kind in seiner Eigenart und Besonderheit ausleben darf, entwickelt es sich von selbst zu einem gesunden und sozialen Wesen.
So sehr das Ausgehen vom Kinde, der behutsame Umgang mit ihm, das Eingehen auf das Kind unabdingbar sind, so wenig kann ich mir sein gedeihliches Heranwachsen ohne die geleitete aktive Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Realität vorstellen. Deshalb ist für mich Alice Millers einfühlsames Herangehen bestenfalls die eine Seite der Erziehungsmedaille, die andere die Notwendigkeit, Verhaltensregeln zu erwerben, die das Bestehen in der Gesellschaft ermöglichen. Deshalb, Julika, bitte nimm, wenn es ernst wird mit der Erziehung eines eigenen Kindes, ergänzend z.B. das Buch von Annette Kast-Zahn Jedes Kind kann Regeln lernen zur Hand.
Da das Spiel vom schwarzen Schaf in der Löschmann’schen Familie bisher nicht gespielt worden ist, muss der Leser mit meiner Sicht vorliebnehmen. Onkel Hugo ist für mich ein klarer Fall, bei all den weiteren, angedeuteten Fällen lassen sich lediglich Ansätze zum schwarzen Schaf erkennen, je nach gewähltem Umfeld und Perspektive. Schwarze Schafe können Außenseiter, Sonderlinge, Einzelgänger, Störenfriede, Kriminelle, aus dem Familienverband Ausbrechende, ihren eigenen Weg Gehende, Querdenker sein. Der Begriff ist zwar im landläufigen Sinne negativ geladen, muss es aber nicht sein. Im Alten Testament gibt es die bekannte Geschichte von Thomas Mann in seiner Tetralogie Josef und seine Brüder gestaltet, wonach Jaakob, Vater von Josef, als gerechten Lohn für seine jahrelange Arbeit von seinem Schwiegervater Laban bekanntlich die gefleckten und gescheckten Ziegen und Böcke sowie die schwarzen Schafe der Herde erbittet, die wegen der Farbe ihrer Wolle gering geschätzt waren. Es hat den Anschein, als ob er in bemerkenswerter Bescheidenheit minderwertige Tiere auswählte, doch er züchtete aus den nicht gewünschten Tieren eine kräftigere eigene Herde.

Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.