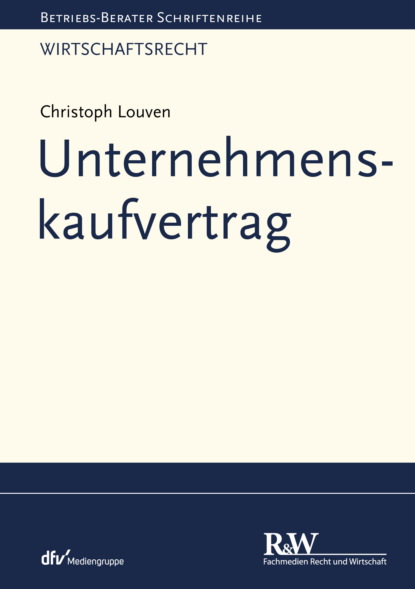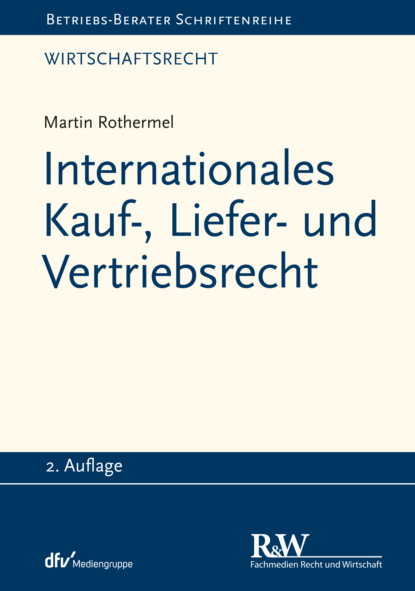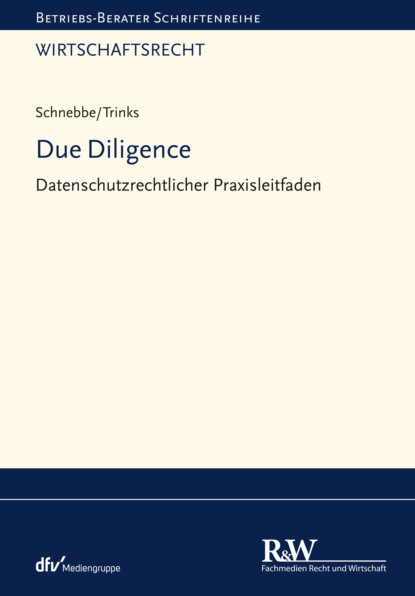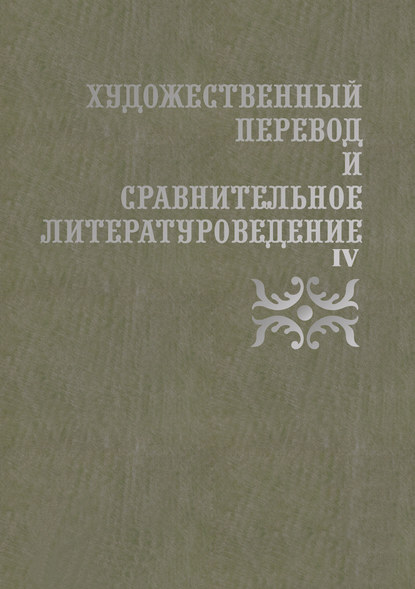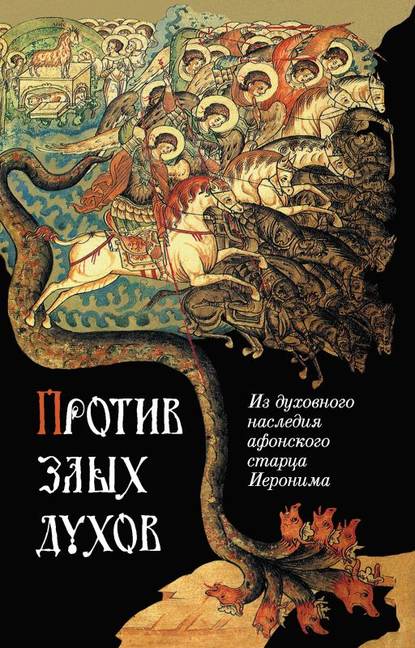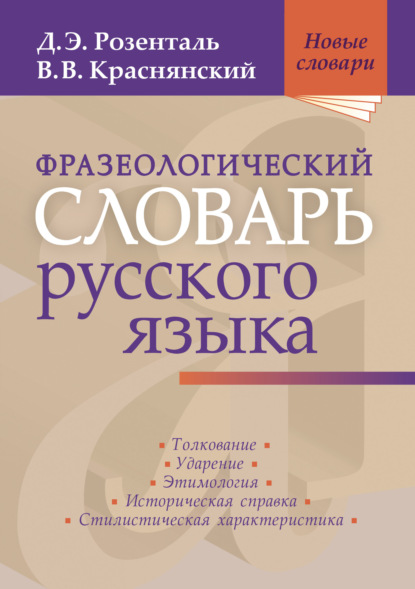- -
- 100%
- +
276
Vorsatz ist das Wissen und Wollen der Verwirklichung eines objektiven Tatbestands.542 Das Bewusstsein der Pflichtwidrigkeit, also aktuelles Unrechtsbewusstsein, ist nach herrschender Meinung (sog. Vorsatztheorie)543 im Zivilrecht (anders als im Strafrecht, in dem die sog. Schuldtheorie gilt544) ebenfalls Voraussetzung für den Vorsatz. Bedingter Vorsatz genügt.
277
Er ist schon dann anzunehmen, wenn der als möglich erkannte pflichtwidrige Erfolg billigend in Kauf genommen wird.545 Vertraut der Schädiger andererseits darauf, der Schaden werde nicht eintreten („es wird schon gut gehen“), handelt er nur bewusst fahrlässig.546 Behauptungen „ins Blaue hinein“, d.h. ohne hinreichende Erkenntnisgrundlage (die etwa erlangt werden könnte durch Rückfrage bei dem, der es wissen könnte, die Durchsicht von Unterlagen etc.), sind vorsätzlich.547 Denn derjenige, der verschweigt, dass ihm die zur sachgemäßen Beurteilung des Erklärungsgegenstands erforderliche Kenntnis fehlt, rechnet regelmäßig mit der Möglichkeit, dass seine Angaben nicht der Wahrheit entsprechen. Gleiches gilt für „Verschweigen auf gut Glück“.548
278
Vorsätzliches Verhalten liegt erst recht in einem bewussten „Stehenlassen“ oder gar Fördern eines erkennbaren Irrtums des Käufers.549
279
Arglist – als eine Ausprägung des Vorsatzes, die Rechtsprechung zum Verschulden bei Vertragsverhandlungen unterscheidet nicht immer zwischen beiden Begriffen550 – ist das Wissen, dass gemachte Angaben unzutreffend sind, obwohl sie für die Entschließung des Vertragspartners bedeutsam sind.551 Arglist erfordert Vorsatz, aber keine Absicht.552 Nach ständiger Rechtsprechung des BGH handelt ein Verkäufer auch arglistig, wenn er zu Fragen, deren Beantwortung erkennbar maßgebliche Bedeutung für den Kaufentschluss seines Kontrahenten hat, ohne tatsächliche Grundlagen „ins Blaue hinein“ unrichtige Angaben macht.553 Der (bedingte) Vorsatz muss sich dabei auf die zu offenbarenden Umstände und die Tatsachen beziehen, die dazu führen, dass der Käufer den Vertrag in Kenntnis dieser Umstände nicht geschlossen hätte, nicht aber auf die Existenz der Aufklärungspflicht.554
280
Abzustellen ist bei alledem nicht nur auf den Verkäufer (bei natürlichen Personen auf diese selbst, bei juristischen Personen auf das Organ der juristischen Person), sondern auch auf Personen, deren Verhalten sich der Verkäufer zurechnen lassen muss. Dies sind seine Erfüllungsgehilfen (§ 278 BGB) und seine Wissensvertreter (§ 166 BGB analog).555 Zudem muss er sich das üblicherweise aktenmäßig oder in elektronischen Dateien556 festgehaltene Wissen in seinem Unternehmen zurechnen lassen557 und es kommt zu einer Wissenszusammenrechnung. Mit anderen Worten: Dass „der Verkäufer selbst“ die offenzulegende Informationen kennt, was ja denklogische Grundvoraussetzung einer Aufklärungspflicht ist (man kann nicht über etwas aufklären, das man selbst nicht weiß), ist im Rahmen der Aufklärungspflichten irrelevant, weil Kenntnis nach der Rechtsprechung anzunehmen ist, wenn Wissen dem Verkäufer nach diesen Grundsätzen zuzurechnen ist.558 Darauf wird näher einzugehen sein.
281
Kommt es zu Post-M&A-Streitigkeiten und stehen Aufklärungspflichtverletzungen im Raum, spielen Fragen der Beweislast regelmäßig eine große Rolle. Den Käufer, der eine Aufklärungspflichtverletzung behauptet, trifft die Darlegungs- und Beweislast dahingehend, dass eine Aufklärungspflicht bestand, aber die Aufklärung unterblieben ist.559 Nicht darzulegen und zu beweisen hat der Käufer hingegen den subjektiven Tatbestand, also das zumindest bedingt vorsätzliche Verhalten des Verkäufers.560 Insoweit muss sich nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB der Verkäufer entlasten. Auch die Kausalität (zwischen Aufklärungspflichtverletzung und Vertragsschluss) muss der Käufer nicht darlegen und beweisen. Hinsichtlich der Beweislast bei der haftungsausfüllenden Kausalität hilft dem Käufer ebenfalls die Rechtsprechung, weil der Käufer im Regelfall nicht in der Lage sein wird, nachzuweisen, wie sich die Parteien bei ordnungsgemäßer Aufklärung verhalten hätten.561 Wenn er am Vertrag festhält, ist er so zu behandeln, als wäre ihm bei Kenntnis der Sachlage gelungen, den Kaufvertrag zu einem günstigeren Kaufpreis abzuschließen.562 Der Käufer muss also nicht beweisen, dass sich die Parteien bei zutreffender Aufklärung auf einen niedrigeren Kaufpreis oder sonstige günstigere Bedingungen geeinigt hätten. Deshalb kann sich der Verkäufer auch nicht erfolgreich darauf berufen, dass er den Kaufvertrag zu einem niedrigeren Preis oder sonstigen günstigeren Bedingungen nicht abgeschlossen hätte.563
(b) Falschangaben
282
Falschangaben (die zur besseren Abgrenzung zu Aufklärungspflichten regelmäßig aber redundant als „positive Falschangaben“ bezeichnet werden) führen, trotz ihres hohen Risikoprofils, in Rechtsprechung und Literatur zum Unternehmenskauf ein Schattendasein.564 Sie können auch bei formbedürftigen Verträgen außerhalb der Vertragsurkunde gemacht werden, auch bloß mündlich.565 Für Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen ausreichende Falschangaben können etwa im Rahmen der Q&A, der Management-Präsentation, der Expert Sessions, bei den Verhandlungen aber auch bei bloß formlosen „Pausengesprächen“566 während einer Verhandlungsunterbrechung gemacht werden.
283
Macht der Verkäufer falsche Angaben über das Zielunternehmen, ist darin eine Verletzung der aus dem vorvertraglichen Schuldverhältnis erwachsenden Pflicht zur Rücksichtnahme zu sehen.567 Ein dagegen schuldhaft verstoßender Verkäufer macht sich nach §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB (Verschulden bei Vertragsschluss) ersatzpflichtig. Das gilt auch dann, wenn keine Aufklärungspflicht besteht.568 Den Verkäufer trifft also die Pflicht, dem Käufer auf ausdrückliche Nachfrage die richtige Auskunft zu geben.569 Kann oder will er eine Frage nicht beantworten, muss er die Antwort verweigern oder sich mit Nichtwissen erklären.570 Halbwahre Antworten sind falsche Antworten.571 Weitere Fälle in der Kategorie „Falschangaben“, für die man Aufklärungspflichten nicht bemühen muss, sind falsche Angaben über Gewinn und Umsatz,572 die Vorlage einer falschen Bilanz573 oder falsche Angaben über Gesellschaftsschulden.574
(c) Verletzung von Aufklärungspflichten
284
Eine auch praktisch große Bedeutung haben die in Rechtsprechung und Literatur entwickelten Aufklärungspflichten:
285
Die Rechtsprechung verlangt vom Verkäufer, trotz der naturgemäß entgegengesetzten Interessen über bestimmte Umstände ungefragt aufzuklären, wenn der andere Teil nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung redlicherweise Aufklärung erwarten durfte.575 Das ist der Fall, wenn die (offenzulegenden) Umstände den Vertragszweck des Kaufinteressenten vereiteln können und daher für seinen Kaufentschluss von wesentlicher Bedeutung sind, sofern er die Mitteilung nach der Verkehrsauffassung erwarten konnte.576 Die Rechtsprechung tendierte in der jüngeren Vergangenheit dazu, den Kreis der Aufklärungspflichten eher zu vergrößern und beim Unternehmenskauf von einer „gesteigerten Aufklärungspflicht“ mit strengem Sorgfaltsmaßstab auszugehen.577 Begründet wird dies mit der Schwierigkeit der Bewertung der Zielgesellschaft durch den außenstehenden Kaufinteressenten, dessen besondere Abhängigkeit von der Vollständigkeit und Richtigkeit der ihm erteilten Informationen sowie den typischerweise weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der Kaufentscheidung für den Erwerber.578
286
Allerdings hängen Bestehen und Umfang der Aufklärungspflicht in hohem Maße von den Umständen des Einzelfalls ab.579 Hat der Kaufinteressent ausreichend Zeit für eine eigene Due Diligence, findet er einen geordneten, vollständigen, strukturierten Datenraum vor, wird er von erfahrenen Beratern unterstützt, sinken die Anforderungen.580 Soll der Transaktionsprozess vereinbarungsgemäß schnell und ohne vertiefte Due Diligence durchgeführt werden, sind die Anforderungen besonders streng.581
287
Die genauen Konturen der von der Rechtsprechung angenommenen „gesteigerten Aufklärungspflichten“ sind – für den Verkäufer: gefährlich – unscharf.582 Sachverhalte, die von der Rechtsprechung oder der Literatur als Fälle einer schuldhaften Aufklärungspflichtverletzung bewertet wurden, sind:
– die Nichtaufklärung über Fehlbeträge der vorangegangenen Jahre,583
– das Verschweigen einer erheblichen Schuld, etwa einer Steuerschuld,584
– das Nichtoffenlegen sämtlicher Verbindlichkeiten in einer angespannten finanziellen Lage der Zielgesellschaft,585
– das Verschweigen eines unmittelbar vor Vertragsschluss eingetretenen Umsatzrückgangs um 40 %,586
– das Verschweigen der desolaten wirtschaftlichen Situation der Zielgesellschaft,587 insbesondere eine drohende oder bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung,588
– unter Umständen das Verschweigen der charakterlichen Unzuverlässigkeit eines leitenden Angestellten,589
– das Verschweigen eines Geschäftsführervertrags, der die Gesellschaft über mehrere Jahre mit erheblichen Kosten belastet,590
– die bewusste Verheimlichung von Compliance-Verstößen, also etwa Verstößen gegen das Kartellrecht, das Datenschutzrecht, Außenwirtschaftsrecht sowie Korruptionsvorschriften, wenn daraus das Risiko empfindlicher Bußgelder, Reputationsschäden oder einer Gefährdung des Geschäftsmodells erwächst.591
288
Zahlreiche weitere Sachverhalte werden insbesondere in der Literatur zu M&A-Streitigkeiten vorgestellt.592
(d) Aufklärung durch Verschaffung der Gelegenheit zur Due Diligence?
289
Nach einer in der Literatur vertretenen Meinung593 bestehen Ansprüche wegen Verletzung vorvertraglicher Aufklärungspflichten nicht, wenn der Käufer Gelegenheit zur Informationsbeschaffung hatte. Insbesondere soll das dann gelten, wenn der Verkäufer dem Käufer die Möglichkeit eingeräumt hat, alle für die Bewertung des Kaufgegenstands (Unternehmens) erforderlichen Informationen einzusehen594 und sämtliche auftretenden Fragen mit qualifizierten Auskunftspersonen zu besprechen. Jedenfalls bei einem erfahrenen Käufer soll der Verkäufer durch solch ein Verfahren seine Aufklärungspflichten erfüllen. Der Käufer gebe, wenn er eine Due Diligence durchführt, dadurch zu erkennen, dass er die für ihn wichtigen Umstände selbst beurteilen könne und wolle. Der Verkäufer könne sich daher eher darauf verlassen, dass der Käufer die für ihn relevanten Umstände erkennen und beurteilen könne und gegebenenfalls Fragen stelle.595
290
Diese Auffassung übersieht, dass sich die Aufklärungspflicht ohnehin nur auf solche Umstände bezieht, die der Käufer nicht selbst ohne weiteres erkennen kann. Bei derartigen Umständen fehlen aber häufig auch im Rahmen einer Due Diligence Anhaltspunkte für eine gezielte Nachfrage.596 Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sensible Daten oft nicht offengelegt und Risiken oft nicht als solche gekennzeichnet werden.597 Nicht allein durch die Verschaffung zur Gelegenheit einer Due Diligence, sondern nur durch konkrete Aufklärung im Rahmen der Due Diligence, die den allgemeinen Anforderungen der Rechtsprechung genügt, erfüllt der Verkäufer daher etwaig bestehende Aufklärungspflichten. Der Verkäufer muss daher, will er seine Aufklärungspflichten erfüllen, dem Käufer im Rahmen der Due Diligence die Informationen auf eine Weise zur Verfügung stellen, die es einem durchschnittlich aufmerksamen Käufer ermöglicht, die für seine Kaufentscheidung erforderlichen Informationen aufzunehmen.598 Ist der offenzulegende Umstand in einer Fülle von Informationen enthalten und droht dort „unterzugehen“ oder ist er systematisch im Datenraum an falscher Stelle oder aus anderen Gründen in irreführender Weise eingeordnet, erfüllt der Verkäufer seine Aufklärungspflicht regelmäßig nicht.599 Dies gilt erst recht bei „Fluten“ des Datenraums kurz vor Signing.600 Sind solche Umstände umgekehrt angemessen und fair offengelegt (fair im Sinne von rechtzeitig, an der richtigen Stelle eines geordneten, transparenten Datenraums und in einer Prominenz, die der wirtschaftlichen Bedeutung des Umstands gerecht wird), ist es Sache des Käufers, nach weiteren Informationen zu fragen.601 Selbstverständlich müssen die im Datenraum offengelegten Informationen richtig sein. Sind sie falsch, macht sich der Verkäufer bei schuldhaftem Handeln (wenn die Haftung aus c.i.c. im Unternehmenskaufvertrag ausgeschlossen ist: bei zumindest bedingtem Vorsatz) schadensersatzpflichtig.602
291
Hat der Verkäufer seine Aufklärungspflichten im Rahmen der Due Diligence (also insbesondere durch angemessene und im oben beschriebenen Sinne faire Offenlegung im Datenraum) nicht erfüllt, muss sich der Käufer ggf. als Mitverschulden (§ 254 BGB) entgegen halten lassen, dass er die Due Diligence nicht sorgfältig durchgeführt hat. Dies ist dann anzunehmen, wenn es im Rahmen der Due Diligence konkrete Anhaltspunkte gegeben hat, die auf eine Wert- oder Brauchbarkeitsminderung der Zielgesellschaft schließen lassen, der Käufer diesen Anhaltspunkten aber nicht nachgeht.603
(e) Wissens- und Verhaltenszurechnung
(i) Wissenszurechnung
292
Brisant kann die Haftung aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen wegen der Verletzung von Aufklärungspflichten für den Verkäufer deshalb werden, weil im Hinblick auf aufklärungsbedürftige Umstände dem Verkäufer rechtsformunabhängig
– nicht nur die Kenntnis der gesetzlichen Vertreter (nach der Rechtsprechung § 166 BGB, nach anderer Ansicht § 31 BGB analog) und der rechtsgeschäftlichen Vertreter (nach § 166 BGB) des Verkäufers zugerechnet wird, sondern auch
– die Kenntnis der sog. Wissensvertreter (analog § 166 BGB) des Verkäufers,
– das üblicherweise aktenmäßig oder in elektronischen Dateien604 festgehaltene Wissen des Verkäufers (analog § 166 BGB) und
– unter Umständen sogar auf Wissen der Zielgesellschaft zugerechnet605 wird.
293
Zudem geht die herrschende Lehre606
– von einer horizontalen Wissenszusammenrechnung aus, sodass Teilwissen von verschiedenen Wissensträgern und in verschiedenen Unternehmensabteilungen, das isoliert noch keine rechtliche Relevanz hat, „gleichsam mosaikartig“607 zusammengezogen und der Verkäufergesellschaft als Gesamtwissen zugerechnet wird.608
294
Schließlich nimmt der BGH609 an,
– dass bei einer Verkäufergesellschaft, der nach den Grundsätzen der Zurechnung üblicherweise aktenmäßig oder in elektronischen Dateien610 festgehaltenen Wissens bestimmte Informationen zugerechnet werden, bei der gebotenen wertenden Betrachtung auch die übrigen Voraussetzungen einer Haftung für vorsätzliches Verhalten oder Arglist vorliegen, dass also in diesen Fällen der Verkäufer zugleich weiß oder doch mit der Möglichkeit rechnet und billigend in Kauf nimmt, dass der Vertragsgegner den Fehler nicht kennt und bei Offenbarung den Vertrag nicht oder nicht mit dem vereinbarten Inhalt abgeschlossen hätte,
– sodass sämtliche im Unternehmenskaufvertrag vereinbarten Haftungsausschlüsse und -begrenzungen wegen des Vorsatzes bzw. der Arglist des Verkäufers unbeachtlich sind.
295
Zusätzlich haftet der Verkäufer nach § 31 BGB (analog) für Verschulden seiner Organe und Repräsentanten und nach § 278 BGB für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.
296
Die Verbindung von (beim Unternehmenskauf gesteigerten) Aufklärungspflichten mit den Grundsätzen der Wissenszurechnung und Wissenszusammenrechnung wird deshalb zu Recht als „toxische[r] Haftungscocktail“ für den Verkäufer bezeichnet.611 Dieser toxische Haftungscocktail mag künftig noch gefährlicher dadurch werden, dass der BGH – an aus M&A-Sicht entlegener Stelle612 – zugunsten des Klägers, der das Wissen des Beklagten nicht nachweisen kann, dem Beklagten eine sekundäre Darlegungs- und Beweislast dafür auferlegt. Danach muss der Beklagte, nachdem der Kläger bestmöglich ein mögliches Wissen des Beklagten dargelegt hat, im Rahmen einer sekundären Darlegungs- und Beweislast konkrete Anhaltspunkte für ein Nichtwissen des Beklagten darlegen und beweisen, auch auf Grundlage eigener Ermittlungen und Untersuchungen.613 Unwohl ist dem vertragsgestaltenden und verhandelnden M&A-Juristen auch deshalb, weil ihm verlässliche Orientierungspunkte fehlen. Denn M&A-Streitigkeiten werden regelmäßig vor Schiedsgerichten ausgetragen. Ihre Entscheidungen werden grundsätzlich nicht veröffentlicht. Eine Klärung von Streitfragen und eine „fallinduzierte Rechtsfortbildung“,614 an denen sich der M&A-Jurist etwa im Hinblick auf eine mögliche Wissens(zusammen-)rechnung orientieren könnte, findet nicht statt.615 Nicht nur die Unsicherheit von Streitparteien ist daher groß,616 sondern auch die der vertragsgestaltenden Juristen, die ihren Parteien wirksame Regelungen zur Wissenszurechnung im Kaufvertrag anbieten wollen.
297
Dass „der Verkäufer selbst“ die offenzulegenden Informationen kennt, was ja denklogische Grundvoraussetzung einer Aufklärungspflicht ist (man kann nicht über etwas aufklären, das man selbst nicht weiß), ist im Rahmen der Aufklärungspflichten irrelevant. Denn Kenntnis ist nach der Rechtsprechung anzunehmen, wenn Wissen dem Verkäufer nach diesen Grundsätzen zuzurechnen ist.617
298
Dem Verkäufer wird darüber hinaus, wie gesehen, nicht „bloß“ aus normativen Gründen Wissen zugerechnet. Der BGH fingiert vielmehr das voluntative Vorsatzelement, dass nämlich der Verkäufer auch mit der Möglichkeit rechnet und billigend in Kauf nimmt, dass sein Vertragspartner den „Fehler“ nicht kennt und bei Offenbarung den Vertrag nicht oder nicht mit dem vereinbarten Inhalt abgeschlossen hätte.618
299
Im Rahmen deliktischer Ansprüche nach § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. § 263 StGB oder § 826 BGB findet eine solche Wissenszu(sammen-)rechnung richtigerweise nicht statt.619 Denn die Grundsätze der Wissenszu(sammen-)rechnung können weder den subjektiven Tatbestand des § 263 StGB noch die für § 826 BGB erforderliche Sittenwidrigkeit ersetzen.620 Regelmäßig dürften, neben einer Haftung nach den Grundsätzen des Verschuldens bei Vertragsverhandlungen, allerdings auch die Voraussetzungen einer Arglistanfechtung nach § 123 Abs. 1 Var. 1 BGB vorliegen.621
300
Nach der von der Rechtsprechung vertretenen „Organtheorie“622 muss sich eine juristische Person das Wissen ihrer vertretungsberechtigten Organmitglieder zurechnen lassen, auch wenn das betreffende Organmitglied an dem fraglichen Rechtsgeschäft nicht mitgewirkt hat.623 Dies gilt selbst dann, wenn es von dem Rechtsgeschäft nichts gewusst hat.624
301
Sie muss sich zudem das Wissen ihrer Wissensvertreter zurechnen lassen. Wissensvertreter ist jeder, der nach der Arbeitsorganisation des Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr als Repräsentant des Verkäufers bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledigen und die dabei anfallenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen bzw. weiterzuleiten.625 Dies dürften regelmäßig die Mitglieder des Verhandlungsteams des Verkäufers sein.626 Darüber hinaus dürften regelmäßig aber auch Mitglieder des Managements auf der Ebene unterhalb der Geschäftsleitung und Mitarbeiter in zentralen Führungspositionen darunter fallen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie (wenn auch nur punktuell627) als Informationslieferant in die Verhandlungen eingebunden sind.628 Regelmäßig nicht als Wissensvertreter dürften Sachbearbeiter oder Hilfspersonen in den entsprechenden Abteilungen angesehen werden. In Abhängigkeit davon, ob sie nach der Geschäftsorganisation eigenverantwortlich im Rechtsverkehr einen bestimmten Aufgabenbereich wahrnehmen, dürften Mitarbeiter unterhalb der Abteilungsleitung, Leiter von Unterabteilungen oder einzelnen Dezernaten regelmäßig ebenfalls als Wissensvertreter zu qualifizieren sein.629 Allerdings sind die Grenzen fließend.630 Die Beurteilung hängt stark vom Einzelfall, insbesondere der Größe und Organisationsform der Verkäufergesellschaft, ab. Unter Umständen kommt sogar eine Zurechnung externer Berater in Betracht, wenn sie bestimmte Aspekte einer Transaktion selbstständig und eigenverantwortlich betreuen.631
302
Üblicherweise aktenmäßig oder in elektronischen Dateien632 festgehaltenes Wissen wird dem Verkäufer ebenfalls seit einer Folge von BGH-Entscheidungen Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre zugerechnet.633 Das sind solche Informationen, die aufgrund ihrer Wichtigkeit und Rechtserheblichkeit gespeichert werden mussten und noch aufzubewahren sind, soweit es der Verkäufergesellschaft und deren Vertretern unter Berücksichtigung des Anlasses und dessen Bedeutung, des verstrichenen Zeitraums sowie der Schwierigkeit der Suche zumutbar ist, sich dieser Informationen zu vergewissern.634
303
Nach der Rechtsprechung erfolgt auch eine Wissenszusammenrechnung in Form einer „mosaikartigen Zusammenrechnung“ von Wissen Einzelner. Darunter wird ein Zusammenziehen des Teilwissens in verschiedenen Abteilungen oder bei verschiedenen Organen verstanden.635 Das Teilwissen hätte für sich noch keine rechtliche Relevanz, sondern zeitigt erst infolge des Zusammenrechnens Rechtsfolgen.636 Diese Zusammenrechnung von Wissen soll jedenfalls für solche Wissensträger gelten, die Verantwortung für das konkrete Geschäft haben.637 Die Rechtsprechung geht allerdings darüber hinaus und wendet die Grundsätze der Wissenszusammenrechnung selbst dann an, wenn der Informationsträger eine unbeteiligte Person ist.638
304
Wissen von Personen der Zielgesellschaft kann der Verkäufergesellschaft beim Anteilsverkauf (Share Deal; beim Asset Deal wird das Wissen der Geschäftsführer oder des Vorstands der Verkäufergesellschaft, die beim Asset Deal gleichzeitig Träger des zu verkaufenden Geschäftsbereichs ist, und damit der Zielgesellschaft ohne weiteres zugerechnet639) nur dann zugerechnet werden, wenn diese Personen nach den allgemeinen Grundsätzen im konkreten Fall deren Wissensvertreter sind (Übertragung bestimmter Aufgaben zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Wahrnehmung640). Per se sind die Geschäftsführer oder Vorstände der Zielgesellschaft grundsätzlich keine Wissensvertreter des Verkäufers.641 Etwas anderes kann dann anzunehmen sein, wenn ihnen der Verkäufer im konkreten Fall im Hinblick auf den Unternehmensverkauf eine Aufgabe zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Wahrnehmung zuweist.642 Soweit es zu einer Zurechnung des Wissens von Geschäftsleitern der Zielgesellschaft kommt, wird nur deren Wissen zugerechnet. Es kommt nicht zu einer Zurechnung des gesamten aktenmäßig oder in elektronischen Dateien verfügbaren Wissens der gesamten Zielgesellschaft gleichsam „in einem Schwall“.643 Keine Zurechnung beim Verkäufer, sondern umgekehrt beim Käufer hat das OLG Düsseldorf644 in einem Fall angenommen, in dem der Geschäftsführer der Zielgesellschaft bereits nach Abschluss und noch vor Vollzug des Unternehmenskaufvertrags zum Geschäftsführer des Käufers bestellt wurde, obwohl er bei Abschluss des Unternehmenskaufvertrags noch nicht Gesellschafter war. Im Geschäftsanteilskaufvertrag war eine aufschiebend bedingte Anteilsübertragung (One-Step-Modell645) vereinbart worden. Bereits am Tag des Vertragsschlusses erfolgte die Bestellung zum Geschäftsführer des Käufers. Das OLG Düsseldorf nahm deshalb eine vorwirkende Loyalitätspflicht des Geschäftsführers an und rechnete sein Wissen dem Käufer zu.