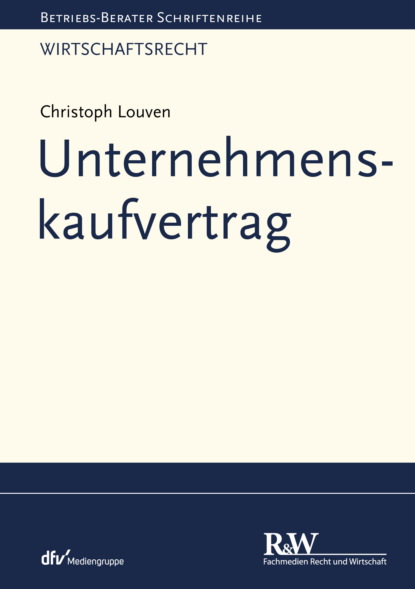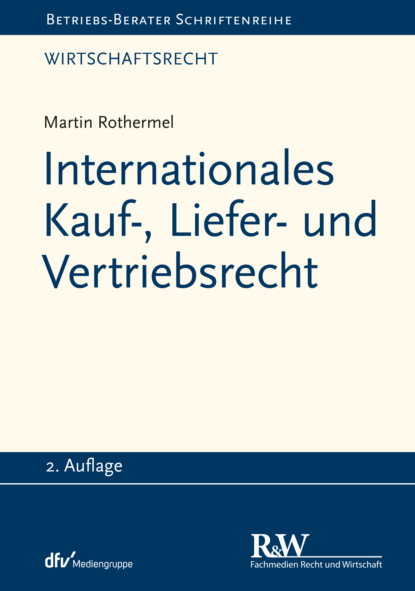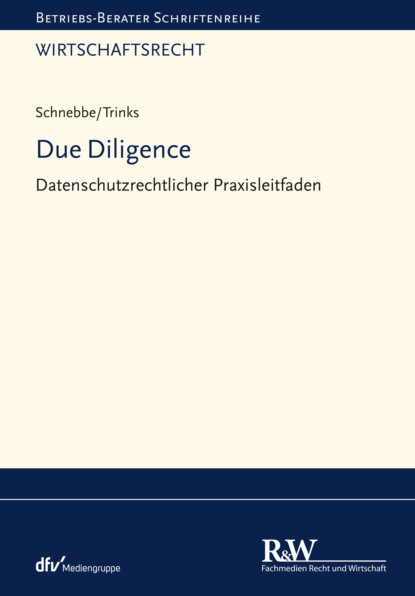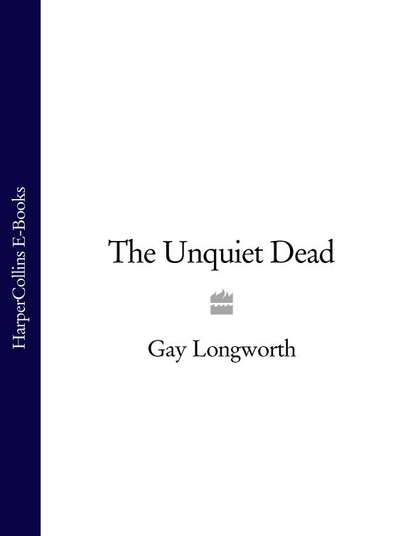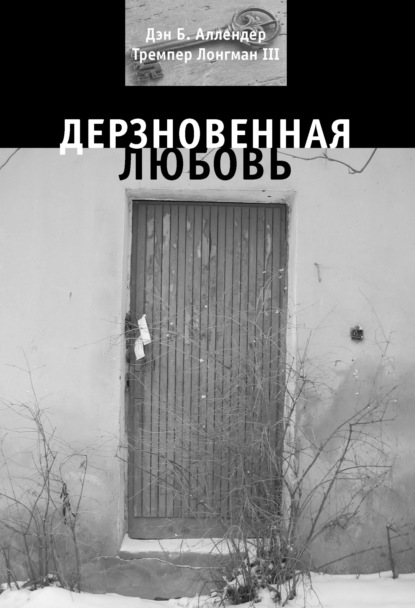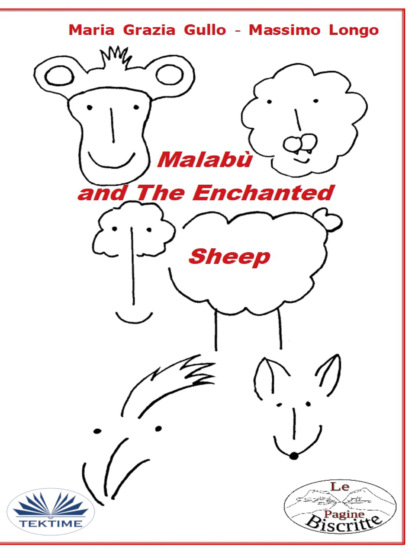- -
- 100%
- +
305
Darüber hinaus kommt eine Wissenszurechnung nach den Grundsätzen der Zurechnung üblicherweise aktenmäßig oder in elektronischen Dateien646 festgehaltenen Wissens auch sonstiger Mitarbeiter der Zielgesellschaft nach einer BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2011647 dann in Betracht, wenn zwischen der Verkäufergesellschaft und der Zielgesellschaft eine sog. aufgabenbezogene Handlungs- und Informationseinheit besteht.648 Eine solche Wissenszurechnung über Gesellschaftsgrenzen hinaus im Konzern ist aber besonders umstritten.649 Sie kommt etwa in Betracht, wenn die Zielgesellschaft auf Veranlassung der Verkäufergesellschaft die Unterlagen für die Bestückung des Datenraums zur Verfügung stellt.650 Eine Zurechnung kann, auf der Grundlage der BGH-Rechtsprechung, auch bei Konzernen relevant werden, die eine sog. Matrixorganisation etabliert haben. Als weiteres praktisch relevantes Beispiel wird die Zurechnung des Wissens zentraler Konzernabteilungen, im Kontext von M&A-Transaktionen etwa der zentralen Konzernsteuerabteilung, angenommen.651 Zu einer Zurechnung über die Gesellschaftsgrenzen hinaus soll es schließlich dann kommen können, wenn der Verkäufer etwa bei den Verhandlungen auf rechtssubjektübergreifende Teams zurückgreift.652 Die Zurechnung dürfte sich dann regelmäßig auf das in dieser Handlungs- und Organisationseinheit (auch bloß typischerweise aktenmäßig) vorhandene Wissen beschränken und nicht zu einer Zurechnung des gesamten (typischerweise aktenmäßig) vorhandenen Wissens der Zielgesellschaft führen.653 Eine über diese Fälle hinausgehende generelle Wissenszurechnung über die Gesellschaftsgrenzen hinaus im Konzern wird von Rechtsprechung und Literatur abgelehnt.654
306
Eine in der Praxis durchaus relevante Einschränkung der Grundsätze der Wissenszurechnung besteht bei Verschwiegenheitsverpflichtungen oder Offenlegungsverboten. Wissen, dass nur durch eine rechtsmissbräuchliche Weitergabe (also unter Verstoß gegen eine Verschwiegenheitsverpflichtungen oder ein Offenlegungsverbot) erlangt werden kann, ist nicht Gegenstand der Wissenszurechnung.655
(ii) Verhaltenszurechnung
307
Außerdem muss sich der Verkäufer nach § 278 BGB das Verhalten seiner Erfüllungsgehilfen zurechnen lassen. Eine Entlastung durch den Nachweis sorgfältiger Auswahl und Überwachung des Dritten sieht die Vorschrift (anders als § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB bei Verrichtungsgehilfen) nicht vor.656 Das hat im Kontext einer Haftung nach den Grundsätzen des Verschuldens bei Vertragsverhandlungen insbesondere bei Falschangaben große praktische Relevanz.
308
Für die Qualifikation als Erfüllungsgehilfe müssen zwei Voraussetzungen vorliegen:
– Zum einen muss sich der Schuldner, hier der Verkäufer, der Person als seine Hilfsperson bedienen. Dies setzt zwar weder eine ausdrückliche Beauftragung noch einen wirksamen Vertrag mit der Person voraus. Erforderlich für die Annahme solch eines Sich-Bedienens ist aber eine einseitige, rechtsgeschäftliche Willensbetätigung. Die Rechtsprechung stellt insoweit darauf ab, ob der Dritte mit Wissen und Wollen in dem Pflichtenkreis des Schuldners tätig wird.657 In der Literatur wird die rechtsgeschäftliche Willensbetätigung als eine Art „Widmung“658 der Person durch den Schuldner bezeichnet.659 Dass der Dritte weiß, dass er durch seine Tätigkeit eine Verpflichtung des Schuldners erfüllt, ist irrelevant.660 Damit ist es auch ohne Belang, ob der Dritte vom Verkaufsprozess Kenntnis hat.661 Irrelevant ist ebenso, ob sie im Rahmen des Verkaufsprozesses gegenüber dem Käufer auftreten oder nicht.662
– Zum anderen muss das Verhalten des Dritten pflichten- und widmungsnah sein.663 Der Verkäufer haftet, was durch das Kriterium der Pflichtennähe erreicht wird, für das Verhalten des Dritten nur, soweit auch sein eigener Pflichtenkreis reicht. Dieser Pflichtenkreis ist weit auszulegen, er umfasst sämtliche Haupt- und Nebenpflichten aus dem Vertrag, einschließlich Schutz- und Obhutspflichten.664 Zum anderen muss es zwischen dem Verhalten des Dritten und der erkennbaren Widmung einen inneren Zusammenhang geben.665 Damit werden bloße Tätigkeiten bei Gelegenheit ausgeschieden.
309
Praktische Anwendungsfälle, in denen die Frage nach einer Zurechnung relevant werden kann, sind etwa
– falsche Informationen, die im Rahmen einer Managementpräsentation erteilt werden,
– falsche Auskünfte im Rahmen des Q&A-Process,
– falsche Auskünfte in Expert Sessions,
– falsche Informationen, die während der Verhandlungen erteilt werden, oder auch
– falsche Informationen in Pausengesprächen bei Verhandlungen.
310
Für die Zurechnung nach § 278 BGB kommt es in jedem Einzelfall darauf an, wer sie erteilt hat, und ggf. zusätzlich zum einen auf die Pflichtennähe und den inneren Zusammenhang der Informations- oder Auskunftserteilung:
311
Eine eindeutige Zurechnung kann bei den Organmitgliedern des Verkäufers angenommen werden. Sie ergibt sich für Kapitalgesellschaften bereits aus § 31 BGB. Bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts und Personenhandelsgesellschaften folgt sie aus einer analogen Anwendung des § 31 BGB.666 Einer Zurechnung nach § 278 BGB bedarf es nicht. Die Vorschrift findet auch keine Anwendung.667
312
Dies soll nach der Rechtsprechung auch für Repräsentanten des Verkäufers gelten. Das sind Personen, denen bedeutsame, wesensmäßige Funktionen zur selbstständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind und die insoweit den Verkäufer repräsentieren.668
313
Nach der wohl herrschenden Lehre sollen dazu auch alle Mitglieder des Projektteams des Verkäufers zählen, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit den ihnen konkret zugewiesenen Aufgaben tätig werden.669 Die Widmung oder das Sich-Bedienen soll dadurch pauschal erfolgt sein, dass sie der Verkäufer in das Projektteam aufgenommen hat. Ist für den Käufer ohne weiteres erkennbar, dass ein Mitglied des Projektteams Auskünfte zu einem Bereich erteilt, für den er für den Käufer ersichtlich nicht zuständig ist, soll im Einzelfall eine Zurechnung nach § 242 BGB entfallen können.670 Stringenter dürfte es sein und auf der Linie der Rechtsprechung liegen, die Frage für jedes Mitglied des Projektteams im Einzelfall anhand der oben dargestellten Kriterien zu überprüfen.671 Das mag dazu führen, dass im Regelfall Mitglieder des Projektteams Erfüllungsgehilfen des Verkäufers sind. Fehlt es aber am inneren Zusammenhang oder an der Pflichtennähe, was für den Käufer regelmäßig erkennbar sein sollte, scheidet eine Zurechnung nach § 278 BGB aus. Je erkennbarer dies für den Käufer ist, umso weniger schutzbedürftig ist er.672 Eines Rückgriffs auf § 242 BGB bedarf es nicht. Neben Mitarbeitern aus dem Unternehmen des Verkäufers kommen beauftragte externe Investmentbanker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte oder andere externe Berater als Erfüllungsgehilfen in Betracht.673 Auch bei ihnen dürfte eine pauschale Zurechnung als Erfüllungsgehilfe zu weit gehen. Vielmehr sind auch bei ihnen die oben dargestellten Kriterien im Einzelfall zu prüfen. Erteilen sie, für den Käufer erkennbar, außerhalb der ihnen zugewiesenen Pflichtenkreise (konkret: der ihnen zugewiesenen Verhandlungs- oder Aufklärungshilfe) Auskünfte oder Informationen, kann im Einzelfall eine Zurechnung ausscheiden.674 Auch hier gilt: Je erkennbarer dies für den Käufer ist, umso weniger schutzbedürftig ist er.675
314
Setzt der Verkäufer LegalTech ein, um etwa im Rahmen einer Vendor’s Due Diligence Informationen aus einer Vielzahl ähnlicher Verträge zu ziehen, und werden dabei fehlerhafte oder unvollständige Informationen ausgeworfen,676 stellt sich nach dem derzeitigen Stand der Technik noch keine Frage der Zurechnung,677 sondern eines Eigenverschuldens. Denn derzeit werden solche Programme noch nicht so eingesetzt, dass ihre Ergebnisse völlig autonom verwendet werden. Sie sind entweder auf ein noch relativ enges Zusammenwirken mit ihren Nutzern angewiesen, die in einem iterativen Prozess in jedem neuen Anwendungsfall Vorgaben für die Informationskriterien vorgeben (so etwa bei der Nutzung von Kira678). Dort, wo umgekehrt die Suchkriterien bereits vollständig vorgegeben werden (etwa bei der Nutzung von Leverton679), wird der Nutzer dennoch regelmäßig eine manuelle Nachprüfung durchführen, bevor er die Ergebnisse verwendet.680 Daher kommt bei einem Einsatz von LegalTech-Tools derzeit nur Eigenverschulden des Programmierers oder des Nutzers in Betracht.681
315
Umstritten ist, unter welchen Voraussetzungen bei einem Share Deal Organmitglieder, Mitarbeiter oder Berater der Zielgesellschaft, die nicht in die Verhandlungen eingebunden sind, sondern insbesondere Informationsanfragen ihres Gesellschafters (= Verkäufers) beantworten, Erfüllungsgehilfen (und nicht bloße Auskunftspersonen682) sind. Von der Beantwortung dieser Frage hängt es insbesondere ab, ob Falschangaben des Verkäufers, die auf Fehlern oder Täuschungen des Managements der Zielgesellschaft basieren, dem Verkäufer zugerechnet werden oder nicht. Solche Informationsanfragen sind bei einem Share Deal regelmäßig in großem Umfang notwendig. Denn selbst bei gut integrierten Konzerngesellschaften ist der Informationsvorsprung des Verkäufers gegenüber dem Käufer oft nur gering.683 Der Verkäufer ist daher regelmäßig in großem Umfang auf Informationen und Unterstützung des Managements der Zielgesellschaft angewiesen. Dies gilt bis zum Vertragsschluss für die Erstellung des Informationsmemorandums, die Durchführung einer Vendor’s Due Diligence, die Erstellung daraus abgeleiteter Berichte oder Fact Books, die Managementpräsentation (Management Presentation), den vorvertraglichen Auskunftsprozess (Q&A-Process), Expertengespräche (Expert Sessions), die Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit des im Erstentwurf angebotenen und später verhandelten Garantiekatalogs und die Erstellung der Anlagen (Disclosure Schedules). Der Verkäufer muss nicht selten die gesellschafts- und konzernrechtlichen Voraussetzungen beachten, um an die für den Verkaufsprozess relevanten Informationen zu kommen und sich der Unterstützung der Zielgesellschaft zu versichern. Dabei mögen die Organmitglieder der Zielgesellschaft mehr oder weniger kooperativ sein.684 Ihre Loyalität gegenüber dem Verkäufer mag sukzessive schwinden.685
316
Das OLG Düsseldorf nimmt an, dass es sich bei Geschäftsführern und Mitarbeitern der Zielgesellschaft regelmäßig um Erfüllungsgehilfen handele.686 Das KG Berlin hat 1995 umgekehrt entschieden, die Einbeziehung des Geschäftsführers der Zielgesellschaft für Auskünfte an den Kaufinteressenten reiche nicht aus, wenn er nicht in die Verhandlungen eingebunden sei.687 Eine beachtliche Meinung im Schrifttum bejaht die Erfüllungsgehilfeneigenschaft grundsätzlich.688 Andere bejahen sie dann, wenn die oben dargestellten allgemeinen Kriterien des § 278 BGB aufgrund der Umstände des Einzelfalls, also insbesondere der Art und des Grades der Einbeziehung, dafür sprechen.689 Schließlich lehnen es einige Autoren grundsätzlich ab, sie als Erfüllungsgehilfen anzusehen,690 oder gehen von einer Vermutung aus, dass es sich lediglich um Auskunftspersonen handelt.691
317
Richtig dürfte auch hier sein, die Eigenschaft als Erfüllungsgehilfe und nicht bloßer Auskunftsperson in jedem Einzelfall nach den allgemeinen Kriterien zu prüfen. Macht der Verkäufer, wenn er etwa für ein Informationsmemorandum, die Due Diligence oder den vorvertraglichen Auskunftsprozess Anfragen stellt oder weiterleitet, lediglich von seinem Auskunftsanspruch nach § 51a GmbH Gebrauch und hat daher den Willen, die Geschäftsführung und Mitarbeiter der Zielgesellschaft lediglich als Auskunftspersonen zu „nutzen“, scheidet eine Anwendung des § 278 BGB aus. Bezieht er die Geschäftsführung der Zielgesellschaft in die Managementpräsentation oder Mitarbeiter der Zielgesellschaft in Expertengespräche ein, kommt es auf die Art der Einführung der Geschäftsführung und Mitarbeiter gegenüber dem Kaufinteressenten an: Will der Verkäufer, dass sie ihn dabei unterstützen, in den Expertengesprächen Aufklärungspflichten gegenüber dem Käufer zu erfüllen, können sie Erfüllungsgehilfen sein. Möchte er, wie zumeist, lediglich, dass die Mitarbeiter ohne den Umweg über den Verkäufer direkt mit dem Käufer sprechen und ihm die Auskünfte geben, die sie sonst (im Dreieck) zunächst dem Verkäufer erteilt hätten, sind sie keine Erfüllungsgehilfen.692 Deshalb ist einem Verkäufer zu raten, klar gegenüber Geschäftsführung und Mitarbeitern zu kommunizieren, welche Rolle sie haben sollen. Zudem sollte der Verkäufer dann, wenn Geschäftsführung und Mitarbeiter unmittelbaren Kontakt zum Käufer haben, auch gegenüber dem Käufer deutlich machen, dass es sich lediglich um Auskunftspersonen handelt, für deren Auskünfte er nicht haftet. Im Übrigen werden die Informationen oder Auskünfte, die die Geschäftsführung und Mitarbeiter dem Verkäufer oder, etwa bei Managementpräsentationen oder Expertengesprächen, direkt dem Käufer zur Verfügung stellen, nicht etwa in Erfüllung einer Aufklärungspflicht des Verkäufers erteilt, sondern in der vom Interesse an einem erfolgreichen Transaktionsprozess erfolgenden freiwilligen Erfüllung des heute in der M&A-Praxis erwarteten hohen Informationsniveaus erteilt.693
318
Für die Beratungspraxis wird man wegen der unklaren Rechtslage dennoch in Betracht ziehen müssen, dass ein Gericht die Geschäftsführung und Mitarbeiter der Zielgesellschaft im Streitfall als Erfüllungsgehilfen ansieht.
(f) Vertragsklauseln zur Zurechnung
319
Die sehr weitgehende Zurechnung von Wissen und Verhalten Dritter kann im Ergebnis (also befreit von juristischer Dogmatik) zu einer Vorsatz- oder Arglisthaftung für bloßes Kennenmüssen führen.694
320
Daher verwundert es nicht, dass die Parteien in den meisten Unternehmenskaufverträgen konkretisierende oder abweichende Regelungen dazu aufnehmen, wessen Wissen und Verhalten dem Verkäufer zugerechnet werden soll. Dabei ist zu empfehlen, zwischen der Verhaltens- und Wissenszurechnung zu unterscheiden:
321
Die Verhaltenszurechnung nach § 31 BGB oder § 31 BGB analog kann nur in den Grenzen des § 276 Abs. 3 BGB wirksam beschränkt werden.695 Die Verhaltenszurechnung nach § 278 Satz 1 BGB kann schon nach dem Gesetzeswortlaut vollständig ausgeschlossen werden, und zwar auch für Fälle des Vorsatzes des Erfüllungsgehilfen (§ 278 Satz 2 BGB).696 Dies kann auf der Grundlage der hier vertretenen Auffassung auch dadurch geschehen, dass Verkäufer und Käufer vereinbaren, die Geschäftsführung und Mitarbeiter der Zielgesellschaft nicht als Erfüllungsgehilfen anzusehen.697
322
Unklarer ist die Rechtslage in Bezug auf die Wissenszurechnung. Dies liegt auch an der sporadischen, einzelfallbezogenen Praxis der veröffentlichten Rechtsprechung und dem Mangel an veröffentlichten Schiedssprüchen zur Wissenszu(sammen-)rechnung.698
323
Hier ist (auch wenn die entsprechenden Klauseln nach ihrem Wortlaut danach regelmäßig nicht differenzieren) gedanklich zwischen der Wissenszurechnung
– in Bezug auf Garantieansprüche und
– in Bezug auf Falschangaben und Aufklärungspflichten
zu unterscheiden.
324
Eine die §§ 166, 278 BGB konkretisierende oder abweichende Regelung findet sich typischerweise in den sog. „Seller’s Best Knowledge“-Klauseln. Systematisch werden sie in Unternehmenskaufverträgen oft bei den Verkäufergarantien geregelt, etwa, wie im Mustervertrag,699 im unmittelbaren Anschluss an die letzte Verkäufergarantie. Ob sie dann die §§ 166, 278 BGB nur im Hinblick auf Garantien konkretisieren oder modifizieren, oder darüber hinaus auch im Kontext der gesetzlichen Aufklärungspflichten, ist eine Frage der Auslegung. Nach dem „Seller’s Best Knowledge“-Konzept gibt der Verkäufer bestimmte Garantien von vornherein nur qualifiziert ab, nämlich nach seinem „besten Wissen“. Dies gilt insbesondere (obgleich nicht zwingend) für Garantien, die sich auf Tatsachen und Umstände beziehen, die der Verkäufer oder die Zielgesellschaft nicht beeinflussen können oder die aus anderen Gründen außerhalb ihrer Sphäre liegen. Eine gesonderte Klausel definiert dann die konkreten Anforderungen an dieses beste Wissen. Beispiele für solche Klauseln enthält Kapitel 5.6.10 unten.
325
In welchen Grenzen solche Regelungen wirksam sind, ist unsicher. Hier wird man unterscheiden müssen:
326
Wenn sie sich, im Einklang mit ihrem typischen Wortlaut, (nur) auf die Garantien beziehen, erscheint es richtig, ihnen lediglich eine tatbestandlich konkretisierende Wirkung zuzusprechen. Im Zusammenspiel mit der Definition des „Best Knowledge“ wird der Umfang der vertraglichen Garantiezusage tatbestandlich konkretisiert. Eine darüber hinausgehende haftungsbeschränkende Wirkung, deren Inhalt unwirksam sein könnte, hat die Klausel nicht. Denn eine weitergehende Haftung (die eingeschränkt werden würde) hat der Verkäufer in seinem durch Garantien und Freistellungen ausgeprägten, mit dem Käufer vereinbarten Haftungsregime zu keinem Zeitpunkt übernommen.700 Die Parteien sind, folgt man dieser herrschenden Auffassung, frei, beispielsweise den Kreis der relevanten Personen, deren positives Wissen zugerechnet wird, zu definieren. Auch steht es ihnen frei, stattdessen oder darüber hinaus Nachforschungspflichten des Verkäufers oder weiterer Personen vertraglich zu begründen. Die Parteien könnten auch vereinbaren, dass dem Verkäufer gar das gesamte in der Zielgesellschaft vorhandene Wissen zuzurechnen ist. Oder sie könnten hinsichtlich der Wissenszurechnung zwischen verschiedenen Garantie(-themen) unterscheiden.701 Gab es also in Bezug auf die (Un-)Richtigkeit einer Garantie Wissen bei einer Person, deren Wissen sich der Verkäufer nach allgemeinen Grundsätzen zurechnen lassen muss, gehörte diese Person aber nicht zu dem Kreis der Wissensträger, deren Wissen sich der Verkäufer nach der mit dem Käufer vereinbarten Best-Knowledge-Klausel zurechnen lassen muss, wäre diese vertragliche Regelung auf Grundlage dieser herrschenden Auffassung mithin nicht nach § 276 Abs. 3 BGB unwirksam.
327
Wenn sie sich nach ihrem Wortlaut (ggf. nach Auslegung) auch auf gesetzliche Aufklärungspflichten bezieht, betritt man unsicheres Terrain.
328
Anders als in Bezug auf Garantieversprechen könnten hier derartige Klauseln eine haftungsbeschränkende Wirkung haben. Denn sollte eine Person, deren Wissen dem Verkäufer zuzurechnen ist, von einem aufklärungspflichtigen Umstand Kenntnis haben, aber nach der Definition des Best Knowledge nicht zu dem vertraglich vereinbarten Kreis von Wissensträgern zählen, schließt der Verkäufer damit praktisch seine Haftung in einem Fall aus, der nach allgemeinen Grundsätzen seine Haftung wegen vorsätzlichem Verschulden bei Vertragsverhandlungen begründen würde.702 Es sprechen zwar sehr gute Gründe dafür, die insoweit von der gesetzlichen Zurechnung abweichende und damit praktisch die Haftung beschränkende Klausel als wirksam anzusehen. Dafür spricht insbesondere der Vergleich mit § 278 Satz 2 BGB, der in Fällen der Verhaltenszurechnung einen Ausschluss der Haftung für vorsätzliches Verhalten eines Erfüllungsgehilfen gerade zulässt.703 Wäre dem Gesetzgeber des BGB die enorme Ausweitung der Wissenszurechnung (analog) § 166 BGB bekannt gewesen, hätte es nahegelegen, auch den § 166 BGB um eine mit § 278 Satz 2 BGB vergleichbare Regelung zu ergänzen.704 Zudem begründet die Rechtsprechung die weite Wissenszurechnung maßgeblich mit auf § 242 BGB gestützten Gesichtspunkten des Verkehrsschutzes.705 Solch eines Verkehrsschutzes bedarf es allerdings nicht, wenn Parteien eines Unternehmenskaufvertrags bewusst entscheiden, dem Verkäufer das Wissen Dritter (nur oder sogar) in vertraglich vereinbartem Umfang zuzurechnen und die damit verbundenen Risiken maßgeschneidert zuzuweisen.706
329
Höchstrichterliche Rechtsprechung zu dieser Frage gibt es allerdings nicht und das Meinungsbild in der Literatur ist uneinheitlich, wenngleich eine beachtliche Literaturmeinung abweichende Vereinbarungen für zulässig hält.707 In Bezug auf Aufklärungspflichten erreicht man die gewünschte Sicherheit mithin derzeit durch entsprechende vertragliche Begrenzungen nicht.
(g) Praxistipps
330
Dies alles zeigt aus Verkäuferperspektive:
– Allein das Angebot und die Verschaffung der Gelegenheit zur Durchführung einer Due Diligence entlastet den Verkäufer nicht von seinen gesetzlichen Aufklärungspflichten. Vielmehr ist dafür zumindest erforderlich, dass die eine Aufklärungspflicht begründenden Umstände im Datenraum in einer angemessenen und fairen Weise, d.h. auch zur rechten Zeit am rechten Ort des Datenraums, offengelegt werden.708
– Bei einem vom Verkäufer optimal gesteuerten Verkaufsprozess sollten von Anfang an wenige ausgewählte Auskunftspersonen bestimmt werden, die über die rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit unzutreffenden, unvollständigen oder „ins Blaue hinein“ vorgenommenen Auskünften aufgeklärt worden sein sollten. Auch das Projektteam, das die wesentlichen projektleitenden Entscheidungen trifft und die Vertragsverhandlungen führt, sollte auf einen möglichst kleinen Personenkreis begrenzt werden. Die Geschäftsleiter oder Mitarbeiter der Zielgesellschaft sollten in keinem Falle dazu gehören, sondern nur für die Bereitstellung von Informationen hinzugezogen werden. Ihre Rolle als bloße Auskunftspersonen sollte der Verkäufer ihnen gegenüber, bei Bedarf auch gegenüber dem Käufer, klar kommunizieren. Sie gehören nicht an den Verhandlungstisch.709
– Die Due Diligence und der vorvertragliche Auskunftsprozess (Q&A-Prozess)710 sollten aus Beweisgründen unbedingt schriftlich dokumentiert und mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Dies gilt auch für Expertengespräche (Expert Sessions) und, soweit möglich, Managementpräsentation (Management Presentations). Die Beantwortung der Fragen im Rahmen des vorvertraglichen Auskunftsprozesses (Q&A-Process) sollte innerhalb des Datenraums, nicht in gesonderten E-Mails erfolgen.711
– Der Vorbereitung des Datenraums sollte ausreichend Zeit und Sorgfalt gewidmet werden. Die in den Datenraum einzustellenden Informationen sollten unter Relevanzgesichtspunkten vorausgewählt werden.712 Die dort enthaltenen Informationen sind auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Ändern sich wesentliche Informationen (etwa bewertungsrelevante Daten), sind sie im Datenraum zu aktualisieren.713
– Oft ist einem Verkäufer, insbesondere einem Verkäufer, der die Zielgesellschaft mit Distanz geführt hat, eine Vendor’s Due Diligence zu empfehlen. Der Verkäufer sollte, wenn er von einer eigenen Due Diligence (Vendor’s Due Diligence) absieht, intern nach möglichen Risiken, über die er Aufklärung schulden könnte, intensive Nachforschungen anstellen, die auch die Bücher und Unterlagen des Unternehmens (also das üblicherweise aktenmäßig oder in elektronischen Dateien714 verfügbare Wissen) einschließen.