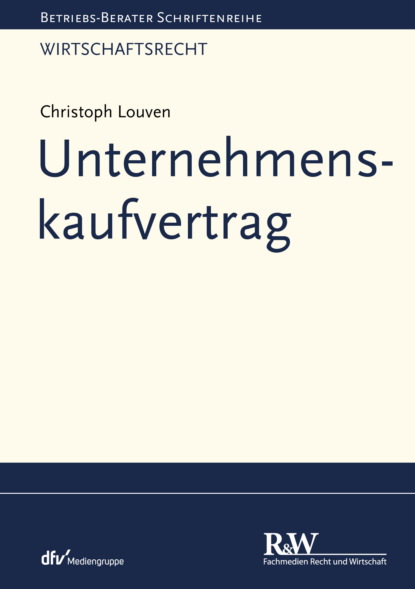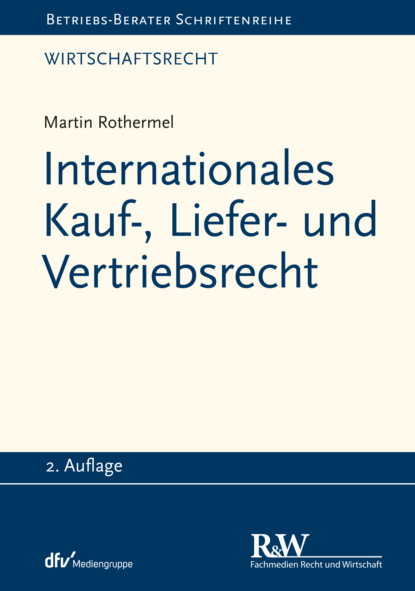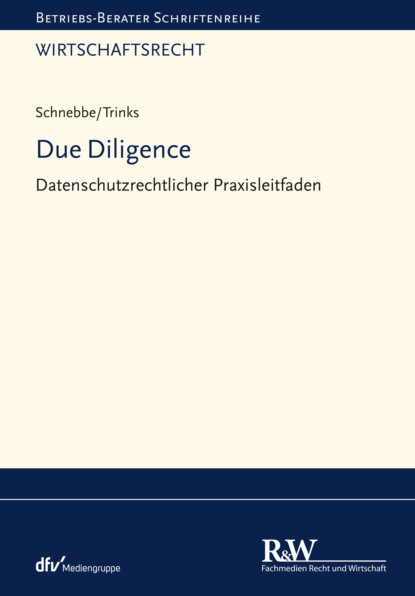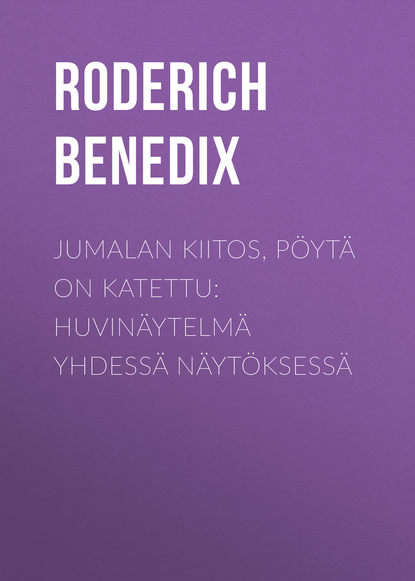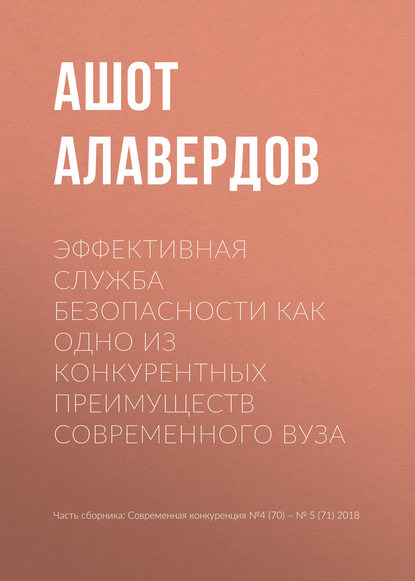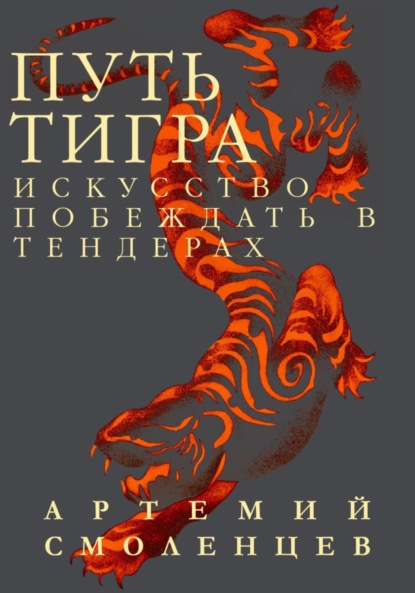- -
- 100%
- +
48
Für uns M&A-Vertragsjuristen werden diese Herausforderungen etwas abgemildert. Die Ermittlung der regelungsbedürftigen Punkte bei einem Unternehmenskauf (Problemdefinition) kann auf der Grundlage zahlreicher Bücher, Aufsätze und kommentierter Musterverträge im juristischen Schrifttum erfolgen, aus der sich mit der Zeit ein profundes Begleitwissen herausbildet. Daher kann sich der erfahrenere M&A-Anwalt auf dieser Stufe der Vertragskonzeptionierung auf die Frage konzentrieren, wo und in welchem Umfang der von „seiner“ Partei geplante Unternehmenskauf von der typischen Interessenlage abweicht. Beispiele für solche Abweichungen können etwa sein:
– außergewöhnlich kurzer Zeitrahmen, der für „normale“ Verhandlungen keinen Raum lässt,
– Kauf aus der Insolvenz,
– andere verkäuferseitige Besonderheiten, wie: fehlende Bereitschaft oder Möglichkeit, Garantieversprechen und Freistellungen einzuräumen bzw., etwa mangels ausreichender Solvenz, zu erfüllen,
– Zielunternehmen noch nicht oder erst seit kurzem eigenständig? (Insbesondere der Kauf und der Verkauf eines durch Carve-Out entstehenden oder entstandenen Unternehmens71 führt zu einer Vielzahl notwendiger Spezialregelungen.)
49
Gibt es solche Besonderheiten nicht, fällt die Grobbeurteilung leichter. Dass bereits das Gesetz kein passendes Auffangregelungsregime für den Unternehmenskauf bereithält, ist allgemein anerkannt.72 Die für einen Unternehmenskaufvertrag typischen Anforderungsprofile sind relativ offensichtlich, sie entsprechen im Grundsatz denen eines Kaufvertrags (allerdings bezogen auf einen immer komplexen und zumeist sehr werthaltigen Kaufgegenstand), der um Elemente eines Projektvertrags ergänzt wird, die den Ablauf der Transaktion zwischen Vertragsabschluss und Vollzug sowie nachlaufende Pflichten steuern.73 Jeder Unternehmenskaufvertrag hat eine typische Anatomie, die aus den Four Horsemen besteht.74 Typische Musterverträge für Unternehmenskäufe (solche aus veröffentlichten Formularbüchern, kanzleiweiten Formularsammlungen, individuellen Mustervertragssammlungen oder individuellen Vertragssammlungen (im Sinne abgeschlossener Verträge, die als Precedents gesammelt werden)) stehen zur Verfügung und helfen dem M&A-Juristen gemeinsam mit vorhandenen Precedents aus anderen Transaktionen, den schöpferischen Prozess der Vertragsgestaltung nicht vor einem leeren Blatt zu beginnen. Dabei ist mit Mustervertrag die Gliederungsstruktur eines Unternehmenskaufvertrags mit ausformulierten Elementen gemeint.75 Solch ein Mustervertrag entspricht den Prüfungsschemata der Dezisionsjuristen. Es handelt sich um unverzichtbare Algorithmen (im Sinne einer linearen Abfolge von Prozessschritten) für eine systematische und vor allem effiziente juristische Arbeit des Vertragsjuristen.76 Wenn ein Mustervertrag gut gepflegt wird, ist er das fortlaufend erneuerte kumulative oder individuelle Gedächtnis des Vertragsjuristen. Bei dem Gebrauch eines Mustervertrages ist selbstverständlich sicherzustellen, dass er auf die besonderen Bedürfnisse der Partei angepasst wird. Jede Transaktion hat ihren speziellen „Thumbprint“.77 Ein guter Mustervertrag ist ein guter Ausgangspunkt. Zu einem guten Vertragsentwurf wird er nur, wenn alle Besonderheiten der konkreten Transaktion berücksichtigt werden. Bei jeder Klausel des Mustervertrags ist zu fragen, ob die dort vorgeschlagene Formulierung auch bei der konkreten Transaktion passt.78 Jeder Mustervertrag ist ständig peinlich genau danach abzufragen, ob für die konkrete Transaktion erforderliche oder zweckmäßige Regelungen fehlen.79 Beim Gebrauch von Precedents ist zu bedenken, dass sie in der Regel Ergebnis eines abgeschlossenen Verhandlungsprozesses sind und sich deshalb für einen Erstentwurf selten eignen. Besser ist auf den Erstentwurf des Vertrags als Precendent zurückzugreifen.
50
Auf der Stufe der Grobbeurteilung kann der M&A-Jurist regelmäßig intuitiv eine Auswahl treffen, etwa nach folgenden typischen Anforderungen:
– Parteien und Beteiligte deutsch oder international? (Vertragssprache also Deutsch oder Englisch? Vertragsstil deutsch oder anglo-amerikanisch?)
– Erfahrungshorizont und Erwartungshaltung der Parteien an den Vertrag? (u.U. relevant für den Umfang des Vertrags und den Konkretisierungsgrad einzelner Klauseln)
– Kaufgegenstand Anteile (Share Deal), Geschäftsbereich (Asset Deal) oder beides (Kombinierter Share und Asset Deal)?
– Gestaltung für den Verkäufer oder den Käufer? Moderat oder hart?
– Entwurf für Bieterverfahren oder für bilaterale Verhandlungen?
– Zielunternehmen klein, mittel oder groß? (u.U. relevant für den Umfang des Vertrags und den Konkretisierungsgrad einzelner Klauseln)
– Vollzug bereits aufschiebend vereinbart (Einheitslösung, One-Step-Modell) oder aufgrund gesonderter Vereinbarung beim Closing (Trennungslösung, Two-Step-Modell)?
– Steuerrechtliche Vorgaben?
– Typische branchenspezifische Besonderheiten?
51
Auf der Stufe der Feinbeurteilung kann es ggf. zu einer Korrektur, zu Änderungen oder Ergänzungen der nach der Grobbeurteilung erwogenen Vertragsstruktur bzw. des nach der Grobbeurteilung ausgewählten Mustervertrags kommen. Anlass dafür kann jede Änderung des bislang festgestellten Sachverhalts sein, also etwa:
– Hinzutritt weiterer Parteien,
– inzwischen angestellte steuerliche Überlegungen,
– Sachverhaltsfeststellungen aus einer Due Diligence,
– Einbindung in Konzernfinanzierung und Cash Pool,
– Bestand von Unternehmensverträgen,
– spezielle branchenspezifische Besonderheiten.
52
Besonders intensiv ist die juristische Arbeit auf der Stufe der Ausarbeitung des Vertragsentwurfs/Detailarbeit am Vertragsentwurf. Neben den oben angesprochenen Punkten geht es hier insbesondere auch um die Detailgestaltung einzelner Klauseln. Dies ist die Phase, in der das Vertragsmuster, also die um Formulierungen angereicherte Gliederungsstruktur des Unternehmenskaufvertrags, ergänzt wird durch auf den konkreten Einzelfall am besten passende weitere Vertragsklauseln. Auch hier bedient sich der Vertragsjurist typischerweise aus einer Sammlung von Textbausteinen, die, wenn man so will, ebenfalls als Algorithmen oder Gedächtnis für einzelne Detailregelungsgegenstände bezeichnet werden könnten und die auf eine spezifische Interessenkonstellation des durch das Vertragsmuster statuierten Grundtypus zugeschnitten sind.80 Auch solche für eine Vielzahl von Interessenkonstellationen bei einem Unternehmenskauf relevanten Textbausteine stehen heute in veröffentlichten Formularbüchern, kanzleiweiten Musterklauselsammlungen oder individuellen Klauselsammlungen zur Verfügung. In der Literatur wurde kürzlich insoweit plastisch von einem „Panoptikum von Subdifferenzierungen“ gesprochen, „deren Konkretisierungsgrad sich rein nach Zweckmäßigkeitserwägungen richtet“.81 Zahlreiche solcher Subdifferenzierungen bei einzelnen typischen Regelungsgegenständen enthält auch das vorliegende Buch. Während der Detailarbeit am Vertragsentwurf klärt der M&A-Jurist sich ergebende Rechtsfragen (etwa nach der Formbedürftigkeit, zu beachtendem zwingendem Recht etc.) und feilt am Vertrag und seinen Klauseln, um die Interessen seiner Partei optimal im Rahmen des rechtlich Wirksamen umzusetzen.
53
Zu einer optimalen Umsetzung gehört es, den Vertrag so zu gestalten, dass er möglichst Rechtssicherheit zwischen den Parteien stiftet. Dazu bedarf es möglichst klarer und missverständnisfreier Formulierungen und eines übersichtlichen Aufbaus. Anders als der Schriftsteller bemüht sich der Vertragsjurist um die Verwendung gleicher Begriffe für den gleichen Vorgang. Der Gebrauch abwechselnder Synonyme ist ihm fremd. Er formuliert kurz und prägnant. Der Vertrag steht im Präsens, nicht im Futur.82 Er verwendet juristische Fachausdrücke präzise und richtig. Er vermeidet passivische Formulierungen. Denn sie benennen nicht das Subjekt und sind damit unpräzise. Sätze, die mehr als 25 Wörter haben, vermeidet er möglichst. Denn mehr als 25 Wörter kann der Leser nicht aufnehmen.83 Bei ab und an unvermeidbaren Aufzählungen mit mehr als 25 Wörtern in einem Satz untergliedert er den Satz. Verweise (Cross References) nimmt er immer konkret auf bestimmt bezeichnete Klauseln vor. Geschieht dies nicht, erfüllen die Verweise ihren Zweck nicht, sind regelmäßig unnötig und nur Ausdruck von Trägheit. Für die Vertragsgliederung sind arabische Ziffern oder Paragrafen (Clauses, Articles) empfehlenswert. Unterabschnitte sollten auf der nächsten Ebene mit 1.1, 1.2 etc., auf der Ebene darunter mit kleinen Buchstaben ((a), (b) etc.), auf der Ebene darunter, also in der Regel bei Aufzählungen, durch kleine römische Zahlen ((i), (ii) etc.) bezeichnet werden. Das vereinfacht genaue Verweise. Anlagen (Exhibits, Annexes) sollten nicht durchlaufend, sondern wie die Klausel nummeriert werden, in der sie das erste Mal in den Vertrag eingeführt werden. Andernfalls führte die Streichung oder Hinzunahme einer Anlage in den Vertragstext zu Folgeänderungen. Ob neben Aufzählungen, abgestimmten Entwürfen von bei Vollzug abzuschließenden Ausführungs- oder Nebenverträgen oder Offenlegungen (Disclosures) auch ganze Regelungsbereiche (etwa Steuer- bzw. Umweltrecht oder spezielle Freistellungen) in Anlagen ausgelagert werden, ist sorgfältig abzuwägen. Dabei besteht die Gefahr, dass die Konsistenz solcher in Anlagen ausgegliederter Regelungen mit dem Hauptteil des Vertrags leidet.84 Diese Gefahr wird dadurch nicht geringer, dass solche ausgelagerten Regelungen nicht selten in separaten „Work Streams“ verhandelt werden. Bei Vertragsüberarbeitungen (etwa in Folge von Verhandlungen) achtet der M&A-Jurist auf notwendige Folgeänderungen in anderen Klauseln. Mehrfach verwendete Begriffe, für die nicht bereits gesetzliche Definitionen vorliegen (wie etwa für „verbundene Unternehmen“ in §§ 15ff. AktG), werden definiert. Wie in englischsprachigen Verträgen üblich, wird der definierte Begriff mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben und damit als definierter Begriff gekennzeichnet. Dies ist zwar nicht sonderlich elegant,85 aber zweckmäßig. Zur besseren Lesbarkeit ist es empfehlenswert, Begriffe nach US-amerikanischem Vorbild im Vertragstext an der Stelle zu definieren, an der der jeweilige definierte Begriff das erste Mal relevant wird. Um sämtliche Definitionen gebündelt lesen zu können, empfiehlt sich die Erstellung eines Definitionsverzeichnisses. Änderungen von Definitionen sind besonders sorgfältig vorzunehmen und vor dem Hintergrund aller Klauseln, in der die Definition verwendet wird, zu prüfen. Dem Vertrag wird üblicherweise neben dem Definitionsverzeichnis auch ein Inhaltsverzeichnis und ein Anlagenverzeichnis vorangestellt. Das verbessert seine Lesbarkeit.
54
Entgegen einem verbreiteten Irrtum ist ein Vertragswortlaut nie eindeutig, sondern vielmehr Ausgangspunkt der Auslegung.86 Jede Klausel ist damit auslegungsbedürftig.87 Schon die – in der Rechtsprechung ab und an anzutreffende – Feststellung, eine bestimmte Klausel sei nach ihrem Wortlaut und Zweck eindeutig, setzt eine Auslegung voraus.88 Ein „klarer und eindeutiger“ Wortlaut einer Willenserklärung bildet daher auch keine Grenze für die Auslegung anhand der Gesamtumstände,89 wohl aber der noch mögliche Wortsinn.90 Ein übereinstimmender Parteiwille geht dem Wortlaut und jeder anderen Auslegung vor (falsa demonstratio non nocet91). Im Idealfall entfernt sich das Auslegungsergebnis nicht oder nicht weit vom Ausgangspunkt der Auslegung. Für Klauseln in Unternehmenskaufverträgen gilt der allgemeine Kanon von Auslegungsgrundsätzen.92 Klauseln in Unternehmenskaufverträgen sind danach nach §§ 133, 157 BGB auszulegen. Bei der deshalb maßgeblichen Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont kommt es darauf an, wie ein verständiger und mit den Umständen vertrauter objektiver Empfänger den Wortlaut einer Willenserklärung verstehen durfte.93 Die Auslegung erfolgt anhand des Wortlauts (als Ausgangspunkt und Grenze der Auslegung), der Grammatik und Systematik, der Begleitumstände (vor allem Entstehungsgeschichte), des Sinns und Zwecks (teleologische Auslegung) sowie von Treu und Glauben. Auch wenn es keine feste Rangfolge innerhalb dieses Auslegungskanons gibt, sind zumeist Wortlaut und Zweck für das Auslegungsergebnis maßgeblich.94 Bei regelmäßig intensiv verhandelten Unternehmenskaufverträgen hat zudem oft die historische Auslegung eine besondere Bedeutung.95 Dies gilt, wie auch die übrigen Ausführungen in dieser Ziffer 1.3, für Verträge, die deutschem Recht unterliegen (zu Besonderheiten anglo-amerikanischer Konzepte und der Auslegung englischsprachiger Verträge nachfolgend Ziffer 1.4).
55
Ziel des M&A-Vertragsjuristen ist daher, so eindeutig zu formulieren, dass unter Berücksichtigung des Auslegungskanons das von seiner Partei angestrebte Regelungsziel rechtssicher, d.h. ohne Streit über die Auslegung, erreicht wird. In diesem Zusammenhang ist es auch für den Vertragsjuristen wichtig, jedenfalls bei Klauseln, deren herausgehobene Bedeutung bei der Abwicklung des Vertrags wahrscheinlich ist, immer wieder die Perspektive eines Dezisionsjuristen in einem streitigen Fall einzunehmen, der einzelne Klauseln oder Regelungsbereiche seziert und Argumente aus der Systematik, den Vertragsverhandlungen, begleitenden E-Mails oder anderen Begleitumständen, dem von den Parteien verfolgten Zweck, ihrer Interessenlage oder Gesichtspunkten einer vernünftigen und gesetzeskonformen Auslegung sammelt.96 Verzichten die Parteien, wie in der Praxis nicht selten, im Interesse eines zügigen Verhandlungsfortschritts oder besserer Lesbarkeit des Vertrags darauf, einen bestimmten Punkt in einer Klausel, über den sie ein gemeinsames Verständnis haben, klarzustellen, empfiehlt es sich, dieses gemeinsame Verständnis schriftlich festzuhalten.97
56
Ein Irrtum wäre auch die Vorstellung, einen lückenlosen Vertrag gestalten zu können. Das ist unmöglich. Jede Regel ist notwendig lückenhaft.98 In der Literatur zur Vertragsgestaltung im Allgemeinen wird dieser Befund als eines der „Naturgesetze der Vertragsgestaltung“ bezeichnet.99 Möglich aber ist und Ziel sollte sein, für die für die Parteien und ihren Rechtsberater im Zeitpunkt des Vertragsschlusses für die Vertragsabwicklung als wahrscheinlich und in wirtschaftlich relevantem Umfang erkannten Ereignisse Regelungen vorzusehen. Daher sollte ein guter Unternehmenskaufvertrag neben den als wahrscheinlich angesehenen Ereignissen auch eine typische Bandbreite unwahrscheinlicher Ereignisse abbilden, die nach praktischer Erfahrung bei Abwicklung eines Unternehmenskaufvertrags abstrakt gelegentlich auftreten100 und eine gewisse wirtschaftliche Relevanz für die Parteien haben. Als Daumenregel wird man zudem sagen können, dass die der Erfüllungsplanung dienenden Regelungen detaillierter ausfallen sollten als die der Risikoplanung dienenden. Dies wird durch gute moderne und bewährte Vertragsmuster regelmäßig weitgehend geleistet. Sie haben, wenn sie wie regelmäßig anglo-amerikanischem Vorbild folgen, eine Tendenz zur Regelungstiefe. Gewisse, aufgrund der Besonderheiten der konkreten Transaktion denkbare atypische Ereignisse können, wenn möglich, ergänzend geregelt werden. Umgekehrt wird es regelmäßig weder möglich noch dem Verhandlungserfolg dienlich noch zweckmäßig sein, alle in der konkreten Transaktion möglichen Ereignisse zu regeln und die daraus erwachsenden Risiken den Parteien zuzuweisen.101 Dies führte oft nur zu Spekulationen über hypothetische Kausalverläufe und einer Fixierung auf hypothetische Szenarien, die einer Partei als besonders bedrohlich erscheinen,102 und fördert zunehmendes Misstrauen in den Vertragsverhandlungen. Die nach solchen Diskussionen gefundenen vertraglichen Regelungen sind selten besonders zweckmäßig.103 Verbleibende Lücken werden nach den allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen geschlossen (Treu und Glauben, ergänzende Vertragsauslegung) oder behandelt (Störung der Geschäftsgrundlage).
57
Das Buch und der anhängende Mustervertrag (S. 465ff.) folgen dem modernen anglo-amerikanischen Stil eines Unternehmenskaufvertrags. Die Grobgliederung für einen Vertrag über einen Share Deal wird unter Rn. 30ff. vorgestellt. Sie kann im soeben beschriebenen Sinne als erster, grober „Algorithmus“ für den Leser verstanden werden, der einen Unternehmenskaufvertrag entwirft. Die Darstellung dieses Buchs folgt dem durch die Grobgliederung des Unternehmenskaufvertrags vorgegebenen Ablauf. Zu fast jedem der behandelten Regelungsabschnitte folgt im soeben beschriebenen Sinne ein „Panoptikum“ an Musterformulierungen einzelner Klauseln. Entsprechend der eher US-amerikanischen Gestaltung erfolgen die Definitionen innerhalb des Vertragstextes. Das vorangestellte Definitionsverzeichnis dient nur der besseren Lesbarkeit des Vertrags. Kaufgegenstand sind Geschäftsanteile an einer GmbH (Share Deal). Das Muster ist tendenziell käuferfreundlich. Es eignet sich daher als Erstentwurf eines Käufers bei bilateralen Verhandlungen. Weder Verkäufer noch Zielgesellschaft sind in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Es ist zu erwarten, dass der Verkäufer zur Abgabe von Garantien und Freistellungen bereit ist und daraus erwachsende Ansprüche auch erfüllen könnte. Die Zielgesellschaft besteht seit mehr als zehn Jahren selbstständig. Sie ist ein mittelgroßes Unternehmen ohne Tochtergesellschaften. Sie war nicht in konzerninternen Finanzierungen oder Cash Pools eingebunden, es bestand kein Unternehmensvertrag mit der Verkäuferin. Für die Parteien sind Unternehmenskäufe Teil ihrer Unternehmensstrategie.
53 Zu seinem gesamten Aufgabenspektrum unten Rn. 67f. 54 Rehbinder, AcP 174 (1974), 265, 266. 55 Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 1. 56 Dazu Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 1; Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 1. 57 Dazu Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 1; Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 1. 58 Vgl. Fleischer, RabelsZ 82, 239, 241 m.w.N. 59 Fleischer, RabelsZ 82, 239, 245 m.w.N. 60 Fleischer, RabelsZ 82, 239, 245f. m.w.N. 61 Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 2. 62 Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 3. 63 Dazu Moes, Vertragsgestaltung, 2020, Rn. 92ff. 64 Dazu Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 18ff. 65 Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 18f. 66 Zur Klassifizierung von Verträgen im Rahmen der Vertragsgestaltung Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 28ff. 67 Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 19. 68 Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 19. 69 Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 19. 70 Rehbinder, Vertragsgestaltung, S. 19. 71 Zum Carve-Out siehe Rn. 82. 72 Dazu Rn. 26ff., 262ff., 1030ff. 73 Meyer-Sparenberg, in: Meyer-Sparenberg/Jäckle, Beck’sches M&A-Handbuch, § 40 Rn. 2. 74 Freund, Anatomy of a Merger, 5.3.1, S. 153ff.; dazu auch Rn. 31. 75 So auch Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 136. 76 Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 22. 77 Freund, Anatomy of a Merger, 5.1.2, S. 141. 78 Freund, Anatomy of a Merger, 5.1.2, S. 141. 79 Freund, Anatomy of a Merger, 5.1.2, S. 141. 80 Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 97. 81 Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 97. 82 Triebel/Vogenauer, Englisch als Vertragssprache, Rn. 183; dazu auch Rn. 61. 83 Möllers, Juristische Arbeitstechnik, § 4 Rn. 5. 84 Meyer-Sparenberg, in: Meyer-Sparenberg/Jäckle, Beck’sches M&A-Handbuch, § 40 Rn. 29. 85 So zu Recht Meyer-Sparenberg, in: Meyer-Sparenberg/Jäckle, Beck’sches M&A-Handbuch, § 40 Rn. 34. 86 Vgl. Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Kap. 4, 2 a) und f), S. 143 und 163f. 87 Vgl. Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Kap. 1, 7, S. 66. 88 BGH, Urt. v. 19.12.2001 – XII ZR 281/99, NJW 2002, 1260, 1261. 89 BGH, Urt. v. 19.12.2001 – XII ZR 281/99, NJW 2002, 1260, 1261. 90 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Kap. 4, 2 a), S. 143. 91 RG, Urt. v. 8.6.1920 – Rep. II. 549/19, RGZ 99, 147, 148 („Haaksjöringsköd“); Busche, in: MüKo-BGB, 8. Aufl. 2018, § 155 Rn. 7. 92 Zu ihnen im Kontext von Unternehmenskaufverträgen ausführlich Mehrbrey, in: Mehrbrey, Handbuch Streitigkeiten beim Unternehmenskauf, § 2 Rn. 289ff.; im Allgemeinen Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Kap. 4, 2 a) und f), S. 141ff. 93 Busche, in: MüKo-BGB, 8. Aufl. 2018, § 133 Rn. 29. 94 Mehrbrey, in: Mehrbrey, Handbuch Streitigkeiten beim Unternehmenskauf, § 2 Rn. 292. 95 Meyer-Sparenberg, in: Meyer-Sparenberg/Jäckle, Beck’sches M&A-Handbuch, § 40 Rn. 39. 96 Dazu ausführlich Mehrbrey, in: Mehrbrey, Handbuch Streitigkeiten beim Unternehmenskauf, § 2 Rn. 296–339. 97 Meyer-Sparenberg, in: Meyer-Sparenberg/Jäckle, Beck’sches M&A-Handbuch, § 40 Rn. 39. 98 Larenz/Canaris Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Kap. 1, 7, S. 66. 99 Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 334. 100 Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 348. 101 Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 348. 102 Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 348. 103 So auch Moes, Vertragsgestaltung, Rn. 348.
1.4 Anglo-amerikanische Vertragstechnik und Konzepte; Englisch als Vertragssprache
58
Der wachsende Einfluss anglo-amerikanischer Vertragstechnik und Konzepte sowie der zunehmende Gebrauch der englischen Sprache für dem deutschen Recht unterliegende Unternehmenskaufverträge ist allerdings auch mit Gefahren verbunden, denen sich der vertragsgestaltende deutsche Jurist bewusst sein sollte.
59
Die Verwendung der englischen Sprache bei Anwendung deutschen Rechts kann besondere Unsicherheiten verursachen. Die in einem Vertrag verwendeten Begriffe werden selten isoliert und autonom verwendet, sondern regelmäßig vor dem Hintergrund der – eigenen – Rechtsordnung. Fremde Rechtstermini sind in der Regel Funktionsbegriffe, die sich aus dem Kontext ihres Heimatrechts nicht ohne weiteres lösen lassen, ohne Bedeutungsveränderungen zu unterliegen.104 Drei banale Beispiele mögen dies verdeutlichen: Spricht ein deutscher Jurist vom „Kauf“, meint er regelmäßig nur das schuldrechtliche Rechtsgeschäft, nicht auch die dingliche Einigung. Spricht er von der „Veräußerung“, meint er das dingliche Rechtsgeschäft.105 Verwendet er das Wort „unverzüglich“, so wird er auch außerhalb des Anfechtungsrechts (dort legal definiert in § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB) damit „ohne schuldhaftes Zögern“ meinen. Der deutsche Vertragsjurist denkt in die von ihm verwendeten Begriffe den ihm geläufigen „Begriffshimmel“ hinein. Ein Jurist aus einer Common-Law-Jurisdiktion verfährt ähnlich, nur eben aus anderer, seiner Perspektive und unter seinem „Begriffshimmel“. Um sicher zu sein, dass sich die vom deutschen Juristen gewünschte Interpretation als maßgeblich durchsetzt, ist dringend zu empfehlen, hinter bestimmten englischen Begriffen in Klammerzusätzen die deutschen Fachtermini zu nennen und ausdrücklich vertraglich zu vereinbaren, dass im Zweifel die deutschen Fachtermini maßgeblich sind.
60
Im Common Law besteht die Notwendigkeit, Verträge detaillierter auszuarbeiten. Dort gibt es kein dem deutschen Recht entsprechendes nachgiebiges Recht als Auffangnetz und keine „typischen Schuldverhältnisse“ als Auffangregelung, die eingreifen, wenn der Vertrag schweigt.106 Gebote wie das von „Treu und Glauben“ (§ 242 BGB) sind jedenfalls dem englischen materiellen Recht fremd. Die angloamerikanischen Auslegungsregeln sind starr und wortgläubiger als die deutschen. Grundsätzlich kommt es auf den Vertragswortlaut an, Sinn und Zweck treten dahinter zurück.107 Die Verhandlungsgeschichte darf z.B. nach englischem Prozessrecht bei der Vertragsauslegung nicht berücksichtigt werden, wenn dies zur Änderung, Ergänzung oder Widerlegung des schriftlichen Vertragstextes führt. US-amerikanische und englische Parteien scheuen Auseinandersetzungen vor staatlichen Gerichten. Denn das anglo-amerikanische Prozessrecht ist in besonderem Maße zeit- und kostenaufwendig. Die dadurch verursachte Tendenz zur detaillierten, genauen und präzisen (dafür aber auch längeren, auf „enzyklopädische Vollständigkeit“108 bedachten) Vertragsgestaltung birgt auch Risiken: Der Rückgriff auf deutsches nachgiebiges Recht kann dadurch – oft auch unbewusst – aus den Angeln gehoben werden. Denn man kann aus der detaillierten vertraglichen Regelung u.U. den Umkehrschluss ziehen, dass der gesamte Regelungsbereich nun abschließend durch die detaillierte vertragliche Klausel geregelt werden, ergänzendes deutsches nachgiebiges Gesetzesrecht also abbedungen sein soll. Zudem verleitet die Länge und Komplexität in Verbindung mit Textverarbeitungsprogrammen zu einem gedankenlosen „Copy and Paste“ sowie oberflächlicher Textanalyse.109 Dabei versteht es sich von selbst, dass es gerade bei detaillierten Vertragsklauseln und Vertragsdokumentationen auf jedes einzelne Wort sowie die Systematik besonders ankommt. (Nur) Wenn man sich dessen bewusst ist und danach handelt, erweist sich die Verwendung anglo-amerikanischer Dokumentationsstandards und der englischen Sprache als sachgerecht.