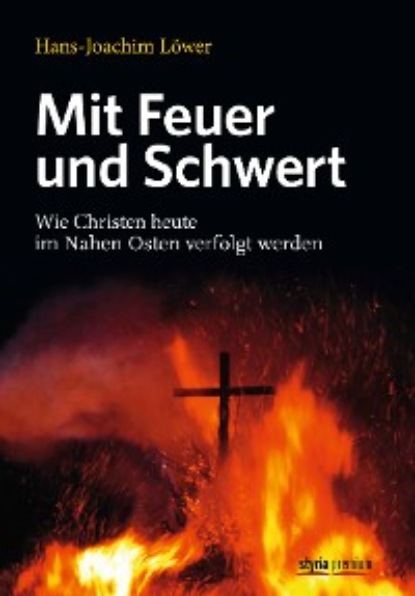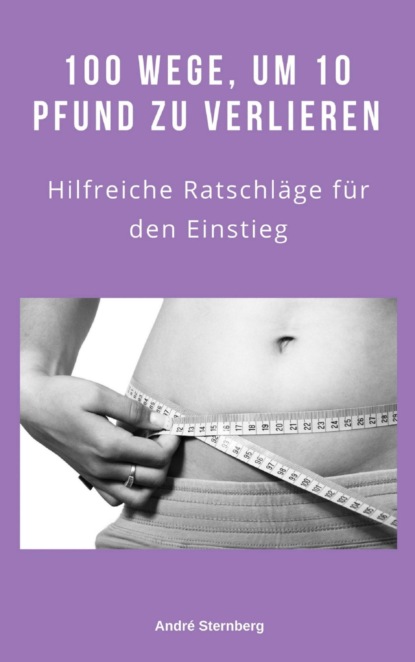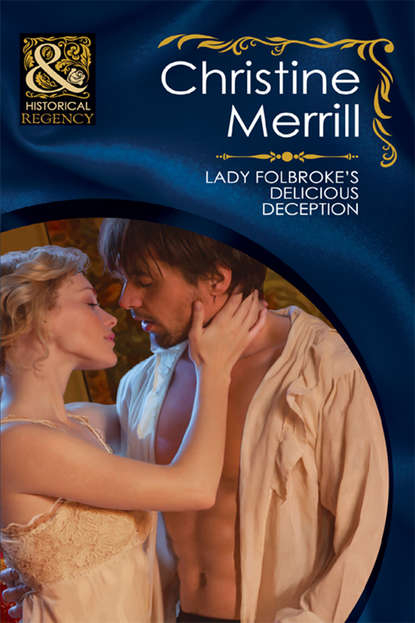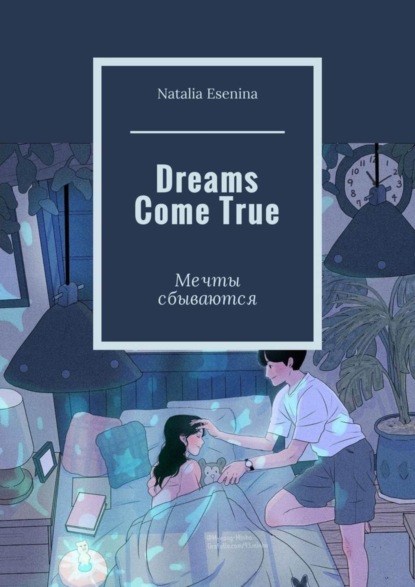- -
- 100%
- +
„Tja, wo war unser Gott, das frage ich mich auch“, antwortet er. „Als Kinder hatten wir immer Angst vor seinen Strafen. Warum nur hat er die daesh nicht bestraft? Wo war er, als sie unsere Häuser zerstörten? Wo war er, als sie unsere Kirchen zerstörten?“
„Die daesh haben auch die Kirchen zerstört?“, frage ich.
„Neun Kirchen“, entgegnet er. „Neun Kirchen allein auf der Südseite des Flusses. Fahren Sie hin, schauen Sie es sich an. Es gibt hier kein einziges Gotteshaus mehr, das unversehrt geblieben ist.“
Wir machen uns auf den traurigen Weg. Die Kirche von Tel Shamiran stand etwas abseits des Ortskerns, wir finden nur noch ein Meer aus Steinen und ein paar Säulen, die einst das Dach trugen. In Tel Telaa (aramäisch: Sara) steht noch eine Art Betongerippe, das die einstige Form ahnen lässt, aber kein Dach und keine Wände mehr hat. Wir sammeln ein paar Scherben mit aramäischen Schriftzeichen auf und setzen die Bruchstücke zusammen, es sind Reste einer Tafel mit den Gründungsdaten, die am Haupteingang hing. In Tel Baloua (Diznayeh) saßen die islamischen Gotteskrieger auf dem Dach der Kirche und nahmen den Feind unter Feuer.

IS-Parolen auf zerstörten Wänden. Ein „Sutoro“-Kämpfer zeigt, wie die „Gotteskrieger“ sich in Häusern verschanzten.
„Sutoro“- und YPG-Kämpfer schossen von einem Hügel auf der Nordseite des Flusses zurück.
Das Resultat mutet an wie ein Symbolbild für den Untergang des Christentums in einer Region, wo vor 2.000 Jahren sein Aufstieg begann: Die Kirche ist zernarbt von schweren Granattreffern. Von ihren Mauern sind die meisten Steinkacheln abgefallen, so liegt der nackte Beton darunter frei. Die Glocke hängt verloren in ihrem Gebälk, der Läutestrick sinnlos in der Luft. Das vierarmige orthodoxe Kreuz, das nicht nur von allen Seiten, sondern auch von oben als solches erkennbar sein soll, baumelt verkehrt herum auf dem Glockenturm; vermutlich wird es nicht mehr lange dauern, bis es endgültig herunterfällt.
Ein letztes Dorf tun wir uns noch an, bevor die Sonne untergeht. In Tel Tal (Talnayeh) ragt aus einem riesigen Schutthaufen der ganze obere Teil eines Kirchturms. Es neigt sich schräg zur Seite wie ein sinkendes Schiff.
„Soll bloß niemand sagen, dieser Bau sei durch Bomben aus der Luft zerstört worden“, sagen die Assyrer. „Schauen Sie genau hin! Das Dach ist völlig ganz geblieben. Nein, die Bombe kam nicht von oben, sondern von unten. Die daesh haben die Kirche in die Luft gesprengt.“ Ich streife leicht benommen durch den Ort. Hier sind kaum Kampfspuren zu sehen, das stärkt die Vermutung von purer Zerstörungswut. Nun aber sehe ich, dass etwas in aramäischen Schriftzeichen auf eine Hauswand gesprüht wurde. Die Assyrer übersetzen es für mich. Es ist eine überraschende Nachricht, die einzig gute an diesem Tag. „Wir kommen zurück in unser geliebtes Tel Tal.“ Wer hat das nur geschrieben?
Ein Bursche namens Baribal taucht auf und sagt voller Stolz, das sei er gewesen. Er winkt uns, ihm zu folgen, und führt uns in ein Haus, das tatsächlich wieder bewohnt ist. Wir gehen durch einen Garten, rot schimmernde Granatäpfel hängen an den Bäumen. Da steht Elias Antar, der Vater des jungen Mannes, auf der Veranda und streckt uns strahlend die Hand entgegen. Er war sein ganzes Leben lang in diesem Dorf als Lehrer tätig und ist als Erster schon eine Woche nach der Rückeroberung wieder in sein Haus eingezogen. „Vor dem Krieg lebten in Tel Tal 55 Familien“, sagt er. „Jetzt sind immerhin schon zwölf wieder da. Wir sind ständig dabei, weitere Familien zur Rückkehr zu ermuntern.“ Seine Frau zögere noch, aber sie komme immerhin schon ein- bis zweimal pro Woche zu Besuch, und sie verspreche die vollständige Rückkehr für den Fall, dass Shadadeh, die nächstgrößere Stadt weiter im Süden, aus den Händen des IS befreit wird.
„Meine Kindheit, meine Jugend, meine Frau, meine Vergangenheit und meine Zukunft – alles ist von hier“, sagt der 68-Jährige. „Warum soll ich von hier weg?“
Er geht in den Keller und holt eine Flasche hausgemachten Rotwein. So ein Tag und so ein Besuch – das muss gefeiert werden. Dann aber schaut er mich durchdringend an, während er die Flasche öffnet. „Sie kommen aus Deutschland, sagten Sie?“ Ich nicke und er hält für einen Moment inne mit dem Korkenziehen.
„Ich hasse Deutschland“, sagt er mit einem Lächeln, dem man ansieht, dass es von Schmerz verzerrt ist.
„Sie werden Gründe dafür haben“, entgegne ich.
Er füllt die Gläser und reicht mir eines zum ersten Schluck.
„Zwei meiner Töchter sind nach Deutschland gegangen“, erzählt er. „Sie selber wollten es eigentlich nicht. Aber letztlich haben sie ihren Männern nachgegeben. Sie waren beide Lehrerinnen in der Stadt Hassaka gewesen. Mein Gott, sie hatten doch alles, was sie brauchten. Jetzt arbeiten sie in einem Restaurant.“ Er habe gebrochen mit ihnen, fügt er hinzu, so groß sei seine Enttäuschung gewesen.
Ich kann nachvollziehen, was die Gründe gewesen sein mögen, die Familie, das Haus und das Dorf zu verlassen. Der Fluss Khabur ist zum Rinnsal geworden, von seinen 300 Quellen sprudelt nur noch eine einzige, und deren Menge wird durch einen Kanal zur Versorgung von Hassaka geleitet. Die Türkei hat mit ihren Staudammprojekten den syrischen Nachbarn das Wasser abgegraben. Die Dorfbewohner können kein Obst mehr anbauen, weil der Grundwasserspiegel so stark gesunken ist. Das Trinkwasser, das die Leute einst aus Brunnen holten, ist so salzig geworden, dass sie ihren Bedarf in Plastikflaschen kaufen müssen. Und zu all dem ist dann noch der Krieg mit all seiner Zerstörung und die Angst vor den daesh gekommen.
„Wer glaubt denn noch ernsthaft daran, dass viele Auswanderer je wieder zurückkommen werden?“, frage ich in die Runde.
Sie zucken stumm mit den Schultern. Es hänge halt alles davon ab, was aus diesem Land Syrien werde.
„Getreide und Baumwolle lassen sich hier immer noch anbauen“, beharrt Elias Antar, als wir uns verabschieden. Ich spüre, wie ohnmächtig er gegen den Gang der Zeit kämpft. Er drückt mir, obwohl ich aus Deutschland komme, einen reifen Granatapfel in die Hand.
KAPITEL 6 · KIRKUK – IRAK
„Sie wissen nichts von ihren Wunden“
Wie Albträume den Alltag von Flüchtlingen beherrschen
Eine Nacht kann ein ganzes Leben verändern. Eine einzige Nacht. In ihr bricht alles zusammen, was Menschen Halt gegeben hat. Der sanfte Rhythmus des Arbeitstages. Der Schutz durch die eigenen vier Wände. Das Vertrauen in die eigenen Kräfte. Die Gemeinschaft mit den Nachbarn. Mounir Hanna und seine Familie haben das alles am eigenen Leib erfahren, und je länger er darüber spricht, desto größer wird der Abgrund, vor dem er nun steht.
Bis zum letzten Moment krallten sie sich fest an einem Leben, das ihnen zwar keine Reichtümer, aber Geborgenheit bescherte. Bis zuletzt weigerten sie sich, das Undenkbare zu denken. Selbst als der Donner von Geschützen dem Städtchen Bartella immer näher kam, hielten sie aus und glaubten fest daran, dass sie nicht im Stich gelassen würden. Es gab in der Ebene von Niniveh Tausende von irakischen Soldaten. Es gab Tausende von kurdischen peshmerga, „die dem Tod ins Auge sehen“, wie ihr stolzer Name sagt. Es gab 500 ehrenamtliche Kirchenschützer, von denen jeder immerhin eine Kalaschnikow hatte. Wozu waren denn diese Bewaffneten da? Sie würden doch die daesh in die Flucht schlagen, oder? Wenn nicht jetzt – wann dann?
Dann aber sahen Mounir und seine Familie fassungslos, dass all diese Uniformierten selber die Flucht ergriffen. Die vermeintlichen Verteidiger spürten ganz offenbar, dass sie der Waffentechnik und dem fanatischen Kampfgeist der islamistischen „Gotteskrieger“ nicht gewachsen waren. Es war die Nacht vom 6. zum 7. August 2014, in der die kleine, scheinbar gesicherte Welt der Familie von Mounir Hanna binnen weniger Stunden unterging.
Sie sahen, dass alle Christen, bis dahin die Mehrheit der Einwohner, in wilder Angst ihre Sachen packten. Selbst die Kirchenschützer rannten davon und gaben die ihnen anvertrauten Gebäude auf, die seit Jahrhunderten das Gesicht von Bartella geprägt hatten: Gotteshäuser der Assyrischen Kirche des Ostens, der Syrisch-Katholischen und der Syrisch-Orthodoxen Kirche. „In diesem Moment wurde uns klar, dass uns niemand mehr schützen würde“, sagt Mounir. „Wir gehörten zu den Letzten, die ihr Haus aufgaben. Aber uns blieb keine andere Wahl. Nur einen Tag mehr, und wir wären verloren gewesen.“ Sie rafften gerade mal das Allernötigste zusammen: Ausweise, Schmuck, ein paar Kleidungsstücke. „Wir hatten gar keine Zeit, um noch mehr einzupacken“, sagt der 55-Jährige. „Wir hätten auch gar keinen Platz gehabt, um viele Sachen zu transportieren.“ Fünf Menschen zwängten sich mit Beuteln und Taschen in Mounirs Auto. Sie wollten nach Erbil, in die Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, wo sie sich die Rettung erhofften. So wie sie dachten in jener Nacht Tausende christliche Familien, die in der Niniveh-Ebene lebten, jener biblischen Region, in der laut Überlieferung der heilige Judas Thaddäus das Evangelium gepredigt hatte.
Ein endlos langer, chaotischer Blechwurm wälzte sich durch die Dunkelheit. Peshmerga, die ihn eskortierten, schossen ab und zu Salven in die Luft, um den Weg frei zu machen. „Nach Erbil haben wir normalerweise nicht mehr als eine Stunde gebraucht“, sagt Mounir. „Diesmal aber waren es neun Stunden.“
TRAUMA
Traumatische Erlebnisse, die von Menschen verursacht werden, sind viel schwerer zu behandeln als traumatische Erlebnisse als Folge von Naturkatastrophen. Den Opfern wurde das Grundvertrauen tief erschüttert oder ganz genommen, das für einen erfolgreichen Umgang mit anderen Personen nötig ist. Opfer von Krieg und Terror leiden in der Regel an Schlafstörungen, Nervosität und Gereiztheit; sie müssen oft erst durch Medikamente stabilisiert werden, ehe sie überhaupt behandlungsfähig sind. Traumatisierte gehen mit ihrem Leid sehr unterschiedlich um: Die einen suchen Zurückgezogenheit und Ruhe, andere möchten möglichst viel darüber sprechen. Erfahrungen zeigen, dass Traumata sehr lange nachwirken – ja sich im höheren Alter meist wieder verschlimmern.
An der Grenze zu Kurdistan mussten sie den Wagen stehen lassen, denn die peshmerga hatten Angst, dass in dem Treck auch Autobomben eingeschmuggelt würden. Kurdische Helfer luden sie auf Pick-ups und brachten sie endgültig außer Reichweite der Kanonen. In Ankawa, der christlichen Vorstadt von Erbil, campten die Flüchtlinge in Parks und auf offener Straße. Nun sind sie in Kirkuk gelandet, in einem Notquartier, das Bischof Faris Mansour Yacoub von der Syrisch-Katholischen Kirche zur Verfügung gestellt hat.
Mounir versucht sich zusammenzureißen. Sabirha, seine 53-jährige Frau, bricht bei jeder Station des Leidenswegs, den er erzählt, aufs Neue in Tränen aus. Shama, seine 85-jährige Mutter, starrt die ganze Zeit stumm vor sich hin. Sabina, seine 61-jährige Schwester, und Nur, seine 18-jährige Tochter, nicken ab und zu mit den Köpfen.
Fast zwei Millionen Menschen – Christen, Jesiden und Muslime – sind seit 2014 in die Gebiete unter kurdischer Kontrolle geströmt. Im Raum Dohuk kamen schätzungsweise 600.000, im Raum Erbil 400.000, im Raum Kirkuk 500.000 Flüchtlinge unter. Sie leben zusammengepfercht bei Freunden und Verwandten, in Wohncontainern und angemieteten Häuserblocks, manchmal sogar in zweckentfremdeten Kirchenräumen. Wie viele halten auf Dauer dieses Dasein aus?
Ich bin mit Yousif Salih, einem Psychotherapeuten, in Kirkuk unterwegs. Die Stadt gehört nicht zur Autonomen Region, wird aber von den Kurden beansprucht und derzeit kontrolliert. Die IS-Front ist ziemlich nahe, die Ölfelder sind ständig in Gefahr. Das äußere Elend der Flüchtlinge, das wir sehen, ist nur die Oberfläche des Problems. Viel schwerer ist es, ins innere Elend zu blicken. Salih hat versprochen, mir ein wenig zu helfen.
„Die meisten Flüchtlinge wissen nicht, dass jeder und jede ein Trauma hat“, sagt Salih. „Väter prügeln ihre Kinder, Brüder und Schwestern schreien sich an – ohne zu wissen, welche Wunden sie in der Seele tragen.“ „Gibt es ein Entrinnen aus einem Trauma?“, frage ich ihn.
„Es ist ein langer und schwerer Weg“, antwortet er. „Wir Therapeuten dürfen nie versuchen, solche Menschen zum Reden zu bringen. Wir müssen Geduld haben. Es muss aus ihnen selber herauskommen.“
Salih leitet in Kirkuk das lokale Büro der Stiftung „Jiyan“ (Leben). Sie wurde 2003, nach dem Sturz des Diktators Saddam Hussein, gegründet. „Das war die Zeit, in der radikale Muslime anfingen, die Dolmetscher umzubringen, die für die US-Invasoren arbeiteten. Wir wagten es damals nicht einmal, uns irgendein Symbol zuzulegen. Wir wollten überparteilich arbeiten und es uns mit keiner Seite verderben.“ Heute betreiben sie im Irak neun Behandlungszentren mit 75 Therapeuten, 12 davon sind in Kirkuk tätig.
Die christlichen Assyrer, sagt er, seien anders als die muslimischen Kurden; im Gegensatz zu denen seien sie keine Kämpfertypen und hätten sich meist wehrlos in ihr Schicksal ergeben. Eine Gruppentherapie wie etwa mit den Jesiden funktioniere mit Christen nicht. „Im Irak waren sie so etwas wie eine geschlossene Gesellschaft“, sagt Salih, „offen zeigten sie sich nur in Richtung Westen. Sie fühlten sich immer bedroht, so haben sie sich eingebunkert im Lauf der Geschichte.“
Jahrhundertelang haben im Orient Stammesbindungen das Leben der Araber geprägt. Bei den Assyrern, die immer mehr zur Minderheit wurden, war es der Zusammenhalt im Dorf oder im christlichen Viertel einer Stadt. „Man war nie allein, wenn etwas Schlimmes passierte“, sagt Salih. „Immer kam die ganze Gemeinschaft zu dir: Nachbarn, Freunde und Verwandte, um das Leid mit dir zu teilen.“ Jetzt, nach Flucht und Vertreibung, zeige sich die Kehrseite dieser Medaille. „Die Menschen treffen sich in ihren Notquartieren, um gemeinsam ihr Schicksal zu beklagen. Durch dieses ständige Jammern ziehen sie sich gegenseitig aber noch mehr runter. Traumatisiert, wie sie sind, machen sie ihr Drama immer größer und immer schmerzlicher – und meist sind halt keine Psychotherapeuten da, um gegenzusteuern.“
Die Leute von „Jiyan“ liefen selber Gefahr, vom Ausmaß des Leids erdrückt zu werden, fährt Salih fort. „Wir halten zwar Distanz zu unseren Patienten, das ist ja die Grundvoraussetzung, um ihnen helfen zu können. Aber stellen Sie sich einmal vor, wie viel sich da in jedem von uns ballt. Manchmal drohen auch wir unter dem Druck zu kollabieren. Ja, wir haben selber ein Trauma-Risiko.“ Das Gegenmittel sei die Gruppentherapie, die sie sich auferlegen. „Wir setzen uns zusammen und reden, so laden wir unsere Last voreinander ab. Nur so werden wir wieder innerlich frei für die nächsten Sitzungen. Es ist wie bei einem Chirurgen, der sich vor der Operation die Hände wäscht. Wir müssen uns reinigen von allem, was stört.“

Flüchtlinge aus dem Städtchen Bartella. Für Zehntausende Christen in der Niniveh-Ebene brach 2014 eine Welt zusammen.
Salih, ein muslimischer Kurde, ist Jahrgang 1975. „Leute in meinem Alter“, meint er, „haben ohnehin eine schier endlose Traumakette.“ Er hat die Diktatur von Saddam Hussein erlebt, die Aufstände der Kurden und die chemischen Waffen, die zu deren Bekämpfung eingesetzt wurden. Er hat nach Saddams Sturz die blutigen Auseinandersetzungen erlebt, die zwischen Schiiten und Sunniten ausbrachen. Einst war es die Angst vor der Folter, die ihn und seinesgleichen beherrschte, nun ist es die Angst vor Terroristen, die Menschen vor laufender Kamera die Köpfe abschlagen. „Als Zwölfjähriger musste ich mit ansehen, wie ein 15-Jähriger exekutiert wurde“, erzählt Salih. „Uns wurde damals gesagt, das sei ein Feind der Baath-Partei gewesen, so etwas war damals ein ganz normaler Teil der Erziehung. Seit ich für ‚Jiyan‘ arbeite, habe ich erlebt, dass vor unseren Büros in Bagdad und Kirkuk Autobomben hochgingen. Ich habe Attentatsopfer gesehen und gerettet, die manchmal nur noch halbe Menschen waren.“ Durch die moderne Technologie – Fernsehen, Handys, soziale Medien – rückt das Unheil so nahe wie nie zuvor an die Menschen heran. In einer Frontstadt wie Kirkuk hört man den dumpfen Schlachtenlärm oft sogar mit den eigenen Ohren. „So kommt die Gefahr schon gedanklich auf uns zu“, sagt Salih. „Du beginnst dir auszumalen, was mit dir passieren könnte. Solche Gedanken sind die ersten Auslöser eines Traumas. Es ist das Anfangsstadium eines Schneeballs, der ins Rollen kommt und immer größer wird.“ Kirkuk hatte eineinhalb Millionen Einwohner, im Zuge der Flüchtlingswelle sind es mittlerweile zwei Millionen geworden. „Wie viele Menschen in dieser Stadt haben wohl ein Trauma?“, frage ich den Psychotherapeuten. „Das kann ich Ihnen ganz genau sagen“, lautet die Antwort. „Zwei Millionen.“
Zu der Fülle an seelischen Ängsten, setzt er hinzu, komme eine große, geistige Leere. „Unser ganzes Leben lang haben wir Iraker erfahren, dass Ideen, Slogans und Programme immer nur missbraucht wurden. Die Folge ist, dass wir an keine Idee, keinen Slogan, kein Programm mehr glauben. Wie soll da aus dem Inneren des Volkes eine neue moralische Kraft wachsen?“
Aus der puren Verzweiflung heraus bildet sich stattdessen eine neue, trügerische Hoffnung. Die Rettung könne nur aus dem Ausland kommen: von Europa, von den Vereinten Nationen, von einer internationalen Streitmacht. Vor allem die Minderheit der Christen glaubt nur dann an eine Zukunft in diesem Land, wenn eine Macht von außerhalb im Irak interveniere. Das ist aber, wie man seit der US-Invasion weiß, schon einmal gründlich schiefgegangen.
So brüten sie in ihrem Elend vor sich hin und mit jedem Tag ohne Licht im Tunnel wächst die Lethargie. „Es ist wie mit einem Schiffbrüchigen weit draußen im Meer“, sagt Salih. „Die erste Stunde schwimmt er noch um sein Leben, vielleicht auch noch die zweite. Doch mit der Zeit wird er immer schwächer – und irgendwann gibt er auf.“
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.