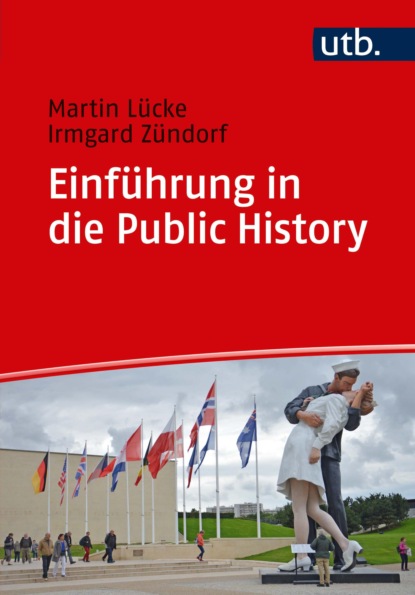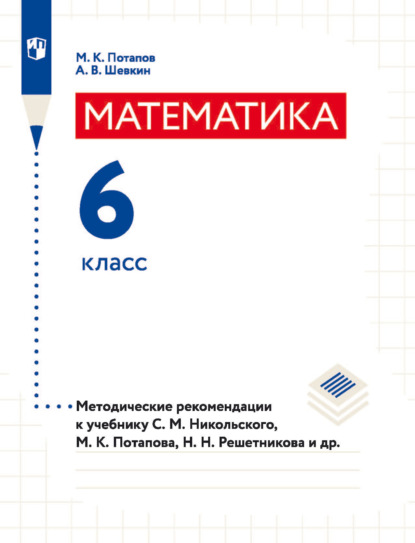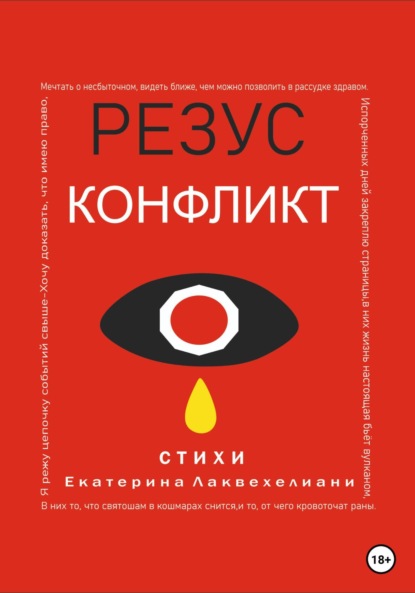- -
- 100%
- +
Eine erste internationale Public History-Konferenz fand 2005 in Oxford unter dem Titel „People and their Pasts“7 statt. Hier referierten vor allem Vertreter aus den USA, Australien und Großbritannien. Eine für alle Beteiligten konsensfähige Definition der Public History wurde hier ebenso wenig gefunden wie die Entscheidung, ob Public Historians in erster Linie studierte Historiker*innen sein sollten oder auch Laienhistoriker*innen sein können. Ziel der Tagung war vielmehr, möglichst vielfältige Sichtweisen zuzulassen und damit neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit zu gewinnen.
2010 wurde schließlich die International Federation for Public History (IFPH)8 gegründet. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, im Bereich der Lehre und in der Forschung internationale Kontakte zu vermitteln und den transnationalen Austausch zu unterstützen. Zu diesem Zweck wird jährlich eine große internationale Tagung durchgeführt. Die erste fand 2014 in Amsterdam statt, die zweite 2015 in Jinan, die dritte 2016 in Bogotá und die vierte 2017 in Ravenna. Innerhalb des IFPH wurde eine Untergruppe für den wissenschaftlichen Nachwuchs gebildet. Sie nennt sich Student and New Professional Committee9 und soll Public History-Studierende und Absolvent*innen miteinander in Kontakt bringen.
1.1.2Public History in Deutschland
Auch in Deutschland stieg seit den 1970er Jahren die Zahl der Absolvent*innen historischer Studiengänge, und spätestens in den 1980er Jahren wurde der Geschichtsboom deutlich spürbar. Immer mehr Historiker*innen wechselten nach dem Studium in Arbeitsfelder außerhalb der Universitäten oder der Schule, waren jedoch, wie in den USA, kaum auf diese Tätigkeiten vorbereitet. Vielmehr ließ sich sogar eine gewisse Ratlosigkeit in den Universitäten beobachten, wie mit dem sogenannten Geschichtsboom umgegangen werden sollte. Auch wenn die Fachdidaktik die Fachhistoriker*innen zu stärkerer Präsenz in der Öffentlichkeit aufrief, blieb unklar, wie diese aussehen sollte.
Außerhalb der Universitäten nahmen die in den 1980er Jahren gegründeten Geschichtswerkstätten unter dem Motto „Grabe, wo Du stehst“10 die Regional- und Alltagsgeschichte in den Blick und verfassten entsprechende Publikationen. Sie kritisierten die universitäre Geschichtswissenschaft für ihre Fokussierung auf die Politik- und Ideengeschichte, auch die zwischenzeitig erfolgte Aufwertung der Struktur- und Sozialgeschichte reichte ihnen nicht aus. Die Geschichtswerkstätten forderten eine demokratische Aneignung der Geschichte durch die Betroffenen selbst. Einerseits sollten die wissenschaftlich ausgebildeten Historiker*innen mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten und andererseits sollte das alltägliche Leben in den verschiedenen politischen Systemen und damit die „Geschichte von unten“ in den Mittelpunkt des Interesses gerückt werden.11
Abseits der Geschichtswerkstätten und Universitäten ließ sich zudem in den 1990er Jahren in Folge des Geschichtsbooms eine „Institutionalisierung der öffentlichen Geschichtsdarstellung“ beobachten.12 So konnten sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeitgeschichtliche Redaktionen mit festen Sendeplätzen etablieren, Verlage publizierten verstärkt populärwissenschaftliche Buchreihen und populäre Geschichtszeitschriften wurden entwickelt. Gedenkstätten erhielten eine stärkere institutionelle öffentliche Förderung, Stiftungen zur Aufarbeitung der deutschen Diktaturvergangenheit entstanden und in den Bundes- und Länderverwaltungen wurden Referate eingerichtet, die sich konkret mit der Förderung von öffentlichkeitswirksamen Geschichtsprojekten auseinandersetzen sollten. Damit erweiterte sich das potentielle Arbeitsfeld von Absolvent*innen der Geschichtswissenschaften. Es dauerte jedoch noch einige Zeit, bis auch die Studiengänge diese veränderte Situation widerspiegelten.
Einen Vorreiter im Bereich der Geschichtsstudiengänge mit Praxisbezug stellt der 1985 an der Universität in Gießen eingerichtete Magisterstudiengang Fachjournalistik Geschichte dar, der als das erste deutsche Pendant zu den amerikanischen Public History-Curricula gesehen werden kann. Allerdings ist er ganz auf die journalistische Vermittlung von Geschichte in Film-, Funk- und Druckerzeugnissen bezogen. Weitere Studienangebote dieser Art ließen lange auf sich warten.
Mit der Einführung des Bachelor- und Mastersystems seit 2000 wurden in den Bachelorstudiengängen im Fach Geschichte Praktika verpflichtend eingeführt und facheigene Übungen oder Seminare mit Praxisrelevanz angeboten. Diese Angebote waren aber zunächst kaum konkret in den Lehrplänen verankert, sondern beruhten auf dem Engagement einzelner Dozierender. Ein Beispiel für ein innovatives Public History-Seminar ist das inzwischen über die Grenzen der Universität Bremen bekannte Theaterprojekt „Aus den Akten auf die Bühne“. Darüber hinaus gibt es an verschiedenen Universitäten Public History-Arbeitsbereiche, die Beratungsleistungen und/oder einzelne Praxis-Seminare anbieten. Dazu zählt der 2013/2014 an der Universität Hamburg eingerichtete Arbeitsbereich Public History, der Seminarangebote unterschiedlichster Art rund um Fragen der (Re-)Präsentation von Geschichte im Bachelorstudiengang Geschichte organisiert. Ähnliche Bereiche gibt es beispielsweise an der Universität Münster mit der „Schnittstelle Geschichte und Beruf“ und an der Universität Bielefeld mit dem „Arbeitsbereich Geschichte als Beruf“, die sowohl berufsvorbereitende Informationen vermitteln als auch eigene Praxisseminare durchführen. Eigenständige Public History-Studiengänge werden hier allerdings nicht angeboten. Auch der an der Universität Zürich angesiedelte Weiterbildungsmaster Applied History stellt keinen Studiengang im Sinne der Public History dar. Er bietet vielmehr in erster Linie klassische geschichtswissenschaftliche Seminare für Nicht-Historiker*innen an.
Erst seit 2008 gibt es mit dem konsekutiven Masterstudiengang „Public History“ an der Freien Universität (FU) Berlin ein Angebot, das sich explizit der Public History in all ihren Formen widmet und eine Alternative zu sonstigen Geschichtsmaster-Programmen bietet. Der Studiengang wird gemeinsam von der Universität bzw. dem Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der FU sowie dem Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) angeboten. Aufgrund dieser Kombination ist er inhaltlich stark auf das 20. Jahrhundert ausgerichtet. Die Grundidee des Studienganges liegt in der Vermittlung von theoretisch und methodisch fundierter Geschichtswissenschaft einerseits sowie Praxisfragen der öffentlich wirksamen Geschichtsvermittlung andererseits. Daher werden sowohl klassische historische Seminare angeboten als auch Module rund um Fragen der (Re-)Präsentation, der Geschichtsdidaktik, der Mediengeschichte und des Kulturmanagements. Neben geschichtswissenschaftlichen Methoden werden den Studierenden die Grundlagen des Historischen Lernens, der Oral History, der Material Culture und der Visual History sowie Sound History vermittelt. Auf dieser Basis sollen sie in die Lage versetzt werden, sowohl eigene Geschichtsprodukte zu konzipieren als auch vorhandene Angebote zu analysieren. Die Einsichten in die Praxisarbeit sollen zum einen durch Hausarbeiten in Form von Praxisprojekten gewährleistet werden, zum anderen über die Einbindung von Dozierenden und Gästen aus der außeruniversitären Praxis sowie durch die verpflichtende Teilnahme an Praktika.
Inzwischen gibt es in Deutschland weitere Public History-Studienangebote. So wurde 2012 an der Universität Heidelberg die Professur für Angewandte Geschichtswissenschaft und Public History eingerichtet. 2015 startete an der Universität Köln der zweite Public History-Studiengang. Weitere Programme sind zum Beispiel an der Ruhr-Universität Bochum in Planung. Darüber hinaus gibt es aber auch Studiengänge ähnlichen Inhaltes, jedoch gänzlich anderen Namens wie die Masterstudiengänge „Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften – mediating culture“ an der Universität Augsburg, „Kulturvermittlung“ an der Universität Hildesheim, „Kunst- und Kulturvermittlung“ an der Universität Bremen oder „Empirische Kulturwissenschaft“ mit der Profillinie „Museum & Sammlungen“ an der Universität Tübingen. Die Angebote sind denen der genannten Public History-Studiengänge relativ ähnlich, auch wenn das Feld ‚Geschichte‘ hier jeweils auf ‚Kultur‘ erweitert wird. Hinzu kommt ab 2017 der weiterbildende Studiengang „Politisch-Historische Studien“ an der Universität Bonn, der berufsbegleitend absolviert werden soll und sich an Interessenten wendet, die im Bereich der Vermittlung von Politik und/oder Zeitgeschichte tätig sind.
Auch wenn die Programme sich unterscheiden, ist doch allen gemein, dass sie sich mit Geschichtspräsentationen im öffentlichen Raum auseinandersetzen. Zudem sind Projektseminare und Praktika integrale Bestandteile der jeweiligen Studienangebote. Die Verknüpfung mit der beruflichen Praxis steht im Mittelpunkt der Studiengänge. Darüber hinaus sind sowohl Fachwissenschaftler*innen als auch Fachdidaktiker*innen in die Lehre eingebunden, sodass sowohl Grundwissen vertieft als auch Vermittlungsfragen behandelt werden.
Trotz dieser durchaus bemerkenswerten Entwicklung kann im deutschsprachigen Raum nicht von einer Public History-Bewegung gesprochen werden und auch noch nicht von einer eigenständigen Disziplin im universitären Bereich. Die Angebote variieren von einzelnen Seminaren und Übungen über Weiterbildungsstudiengänge bis hin zum Masterstudiengang. Noch fehlt es auch an entsprechenden Graduiertenschulen, auch wenn die Anzahl der Promotionen über Themen der Erinnerungskultur deutlich zunimmt.
Public History wird aber nicht nur an den Universitäten gelehrt, sondern auch und vor allem außerhalb dieser Einrichtungen umgesetzt. Gerade die Historiker*innen, die nicht in die institutionellen akademischen Bereiche eingebunden sind, haben in der Vergangenheit auf die Gründung einer eigenen Interessenvertretung gedrängt. 2012 wurde schließlich auf dem Historikertag in Mainz die Arbeitsgruppe Angewandte Geschichte/Public History13 innerhalb des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands gegründet. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der innerhalb und außerhalb der etablierten Geschichtswissenschaft tätigen Historiker*innen zu verstärken. Daher sieht sich die AG vor allem als Kommunikationsplattform. Dafür werden regelmäßig Workshops zu Themen der Public History durchgeführt, zu denen alle Mitglieder, aber auch weitere Interessierte eingeladen sind. Seit März 2015 gibt es mit den Studierenden und Young Professionals (SYP)14 innerhalb der AG eine Gruppe, die sich aus Studierenden und Absolvent*innen der unterschiedlichen Studiengänge in Deutschland zusammensetzt. Die AG verfügt über kein eigenes Publikationsorgan. Seit 2013 gibt es jedoch das wissenschaftlich ausgerichtete Blog-Journal Public History Weekly15, das wöchentlich kürzere Beiträge zu Themen der Public History mit einem Fokus auf Fragen der Geschichtsdidaktik publiziert, die jeweils mit Kommentaren versehen werden können.
Public History ist somit auch in Deutschland inzwischen auf dem Weg zur Fachdisziplin. Als solche setzt sie sich nicht nur mit populären Darstellungen geschichtswissenschaftlicher Erkenntnisse auseinander, sondern liefert mit ihren Präsentationen auch Impulse für die Forschung. Sie trägt somit nicht nur zur Rekonstruktion von Geschichte bei, sondern wird Teil der Geschichtskultur. Einen mittlerweile selbst längst historischen Impuls dieser Art lieferte der Fernsehmehrteiler „Holocaust“, der 1979 in Deutschland ausgestrahlt wurde und zu einem „Paradigmenwechsel in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und den NS-Verbrechen“16 führte. Ein weiteres Beispiel stellt die erste Ausstellung über „Verbrechen der Wehrmacht“ dar, die Ende der 1990er Jahre präsentiert wurde und einen neuen Umgang der Geschichtswissenschaft mit Bildern und hier vor allem mit Fotografien einleitete. Der Blick in die Entwicklung populärer Geschichtspräsentationen bietet somit sowohl Einblicke in Tätigkeitsfelder für Absolvent*innen historischer Studiengänge als auch in Forschungsfelder für die Geschichtswissenschaft und besonders für die Public History.
Literatur
Ashton, Paul/Kean, Hilda (Hg.): People and their Pasts. Public History Today, Basingstoke 2009.
Horn, Sabine/Sauer, Michael (Hg.): Geschichte und Öffentlichkeit. Orte – Medien – Institutionen, Göttingen 2009.
Kean, Hilda/Martin, Paul/Morgan, Sally J.: Seeing History. Public History in Britain Now, London 2000.
Korte, Barbara/Paletschek, Sylvia: History goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres, Bielefeld 2009.
Meringolo, Denise D.: Museums, Monuments, and National Parks. Toward a New Genealogy of Public History, Amherst 2012.
Rauthe, Simone: Public History in den USA und der Bundesrepublik Deutschland, Essen 2001.
1.2Programmatische und begriffliche Annäherung an Public History
Der Begriff „Public History“ entstand in den USA, ist aber auch dort nicht eindeutig definiert. Geprägt wurde er von dem bereits erwähnten Robert Kelly, Professor an der University of California in Santa Barbara. Seine in den 1970er Jahren formulierte Definition lautet:
„Public History refers to the employment of historians and the historical method outside the academia: in government, private corporations, the media, historical societies and museums, even in private practice.“17
Damit verweist Kelly darauf, dass Public History außerhalb der Universitäten stattfindet, und zwar in Politik und Wirtschaft, in Medien, Museen und Geschichtsvereinen sowie im „privaten Bereich“ und dort insbesondere in der Ahnenforschung. Trotz dieser Aufzählung von Arbeitsfeldern bleibt die Definition unpräzise, was die Inhalte und Methoden der Public History angeht. So bezog sich Kellys Begriff Public History nicht auf die Geschichtsvermittlung in der Öffentlichkeit, sondern allein auf die Beschäftigung von Historiker*innen mit ihren ganz spezifischen Fähigkeiten in den Bereichen Recherche, Analyse und Interpretation außerhalb der Universitäten.18
Gegner dieser Definition sahen darin eine simple, verkürzende Aufspaltung der Historikerzunft nach ihrer Beschäftigung an oder außerhalb der Universitäten. Sie forderten stattdessen eine Einbindung der Fachhistoriker*innen und weiterer Akteur*innen sowie gleichzeitig eine Ausweitung der Definition auf die Ziele und Inhalte der Public History. Diese sei somit, wie der Historiker Charles Cole in den 1990er Jahren formulierte,
„history for the public, about the public, and by the public“19.
Damit wurde die Öffentlichkeit nicht nur zur Zielgruppe, sondern auch zum Thema und zur Produzentin von Geschichtsschreibung erklärt. Dies implizierte, dass die entsprechenden Aktivitäten aller irgendwie an Geschichte interessierten Menschen zur Public History gezählt werden konnten. Diese Ausweitung auf jede Form der Laien-Geschichtsschreibung fand wiederum nicht überall Zuspruch.
Die amerikanische Vereinigung der Public Historians (National Council on Public History, NCPH) definierte 2007 Public History wie folgt:
„Public history is a movement, methodology, and approach that promotes the collaborative study and practice of history; its practitioners embrace a mission to make their special insights accessible and useful to the public.“20
Aber auch diese Definition stieß auf Kritik, da Public History zu diesem Zeitpunkt keine Bewegung, sondern bereits in den Institutionen angekommen sei und trotzdem keine eigenständige Methode entwickelt habe. Übereinstimmung herrschte inzwischen jedoch darüber, dass unter Public History mehr verstanden wurde als nur die Arbeit von Historikern außerhalb der Universitäten. Die überarbeitete Definition des NCPH lautet daher:
„public history describes the many and diverse ways in which history is put to work in the world. In this sense, it is history that is applied to real-world issues. In fact, applied history was a term used synonymously and interchangeably with public history for a number of years. Although public history has gained ascendance in recent years as the preferred nomenclature especially in the academic world, applied history probably remains the more intuitive and self-defining term.“21
Auch diese Definition bleibt eher vage und der Hinweis auf die begriffliche Ähnlichkeit zur Angewandten Geschichte (Applied History) erscheint nicht unbedingt hilfreich. Hier findet sich allerdings eine Ähnlichkeit zur deutschen Diskussion, in der ebenfalls kaum zwischen Angewandter Geschichte und Public History unterschieden wird. Ein Unterscheidungsmerkmal könnte höchstens darin gesehen werden, dass die Angewandte Geschichte22 dezidiert alle Geschichtsinteressierten einbinden will und Public History eher auf universitär ausgebildete Historiker*innen zurückgreift.23 So betont Thomas Cauvin, Vorstandsmitglied der internationalen Vereinigung der Public History, dass Public Historians keine Historiker*innen zweiter Klasse seien, sondern ihre Vorgehensweise wie bei allen Historiker*innen auf geschichtswissenschaftlichen Standards beruhe.24
In einer Zwischenbilanz kann festgehalten werden, dass es zwar viele Merkmale gibt, die Public History ausmachen, aber eine konkrete, von allen Public Historians anerkannte Definition nicht existiert. Der frühere Präsident des NCPH erklärt daher auch, Public History sei „easier to describe than define, and you know it when you see it“25. Auf diese vielleicht unvermeidliche begriffliche Unschärfe verweist auch die Formulierung eines Vertreters der australischen Public History-Gemeinschaft. Danach ist Public History
„an elastic, nuanced und contentious term. Its meaning has changed over time and across cultures in different local, regional, national and international contexts.“26
Ziel dieser verschiedenen Definitionsansätze scheint vor allem zu sein, möglichst viele Akteur*innen und viele Formen des Umganges mit Geschichte zu integrieren und daher möglichst offen zu bleiben. So erklärt ein Mitglied der International Federation for Public History (IFPH) nur, dass Public History sich auseinandersetzt mit der
„Gegenwärtigkeit der Vergangenheit – und mit dem Konstruktionscharakter von Geschichte – außerhalb akademischer Gegebenheiten“.27
Wer die Akteur*innen des Faches sind, bleibt dabei ebenso unscharf wie seine methodischen Grundlagen. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es keine eindeutigen Definitionen, sondern eher Umschreibungen. So wird Public History auch als Schirm begriffen, unter dem Konzepte wie Geschichts- oder Erinnerungskultur zusammengefasst werden können.28 Es finden sich jedoch auch konkretere Erklärungen. So verstehen Frank Bösch und Constantin Goschler Public History als
„zunächst jede Form von öffentlicher Geschichtsdarstellung, die außerhalb von wissenschaftlichen Institutionen, Versammlungen oder Publikationen aufgebracht wird“.29
Diese Erklärung verweist sehr schön auf die große Bandbreite der Public History, bezieht jedoch den wissenschaftlichen Blick auf öffentliche Geschichtsdarstellungen nicht mit ein. Die zweite Definition des Historikers Habbo Knoch versteht Public History dagegen dezidiert als
„Teildisziplin der Geschichtswissenschaft […], die öffentliche Repräsentationen von Vergangenheit außerhalb von Fachwissenschaft, Schule und Familie sowie die damit einhergehenden Deutungen zusammen mit ihren Akteuren, Medien, performativen Praktiken und materiellen Objekten daraufhin untersucht, was für wen, wie, mit welcher Bedeutung und zu welchem Zweck als ‚Geschichte‘ konstituiert und verhandelt wird“.30
Diese Perspektive wiederum betont die universitäre Public History. Beide Seiten verbindet folgende, hier verwendete Definition:
Public History wird sowohl als jede Form der öffentlichen Geschichtsdarstellung verstanden, die sich an eine breite, nicht geschichtswissenschaftliche Öffentlichkeit richtet, als auch als eine Teildisziplin der Geschichtswissenschaft, die sich der Erforschung von Geschichtspräsentationen widmet.31
Damit wird der Bezug zur Geschichtswissenschaft und zur Geschichtsdidaktik herausgestellt und die Erforschung aber auch die Entwicklung außeruniversitärer Präsentationen von Geschichte betont. Public History ist somit sowohl Forschungsdisziplin als auch Forschungsgegenstand. In diesem Punkt grenzen sich deutsche Studienangebote von den Public History-Studiengängen in den USA ab, da letztere vor allem eine praxisnahe Ausbildung vermitteln, um die künftigen Absolvent*innen auf den Arbeitsmarkt außerhalb der Universitäten vorzubereiten. Public History in unserem Verständnis setzt sich jedoch darüber hinaus mit öffentlichen (Re-)Präsentationen von Geschichte auseinander, analysiert diese und dekonstruiert darin zum Ausdruck kommende Geschichtsbilder, um den öffentlichen Gebrauch und Missbrauch der Historie zu untersuchen.
In diesem Sinne können auch konkrete Aufgaben der universitären Public History formuliert werden. Danach analysiert sie sowohl Geschichtsdarstellungen als auch entsprechende Diskurse und deren Wirkungen, um das Verständnis des Konstruktionscharakters von Geschichte zu erhöhen. Dabei sollten die medialen, ökonomischen und politischen Einflüsse auf die Darstellung der Vergangenheit herausgearbeitet werden. In diesem Zusammenhang ist zudem die Instrumentalisierung von Geschichte zu reflektieren. Auf diese Weise können die Funktionen der Geschichtsbilder in den jeweiligen Darstellungen entschlüsselt werden, was wiederum deren Wirkung relativieren kann.32 Public History leistet somit sowohl Beiträge zur Geschichtswissenschaft als auch zur Erinnerungs- bzw. Geschichtskultur (siehe Kapitel 1.3).
Die universitäre Public History ist in Deutschland institutionell bislang vor allem an zeithistorischen Professuren angesiedelt. In jüngster Zeit streben aber auch geschichtsdidaktische Lehrstühle ausdrücklich ihre Berücksichtigung an. Zudem wird ebenso die Nähe zu den Kulturwissenschaften betont.33 Letztendlich verbindet Public History geschichtswissenschaftliche, didaktische und kulturwissenschaftliche Methoden und Ansätze miteinander und geht daher in keinem der Fächer allein auf.
Die Fokussierung auf die Zeitgeschichte lässt sich wesentlich darauf zurückführen, dass es innerhalb der Geschichtswissenschaft, aber vor allem auch im gesellschaftlichen Interesse ein „zeitgeschichtliches Gravitationszentrum“34 zu geben scheint, das sich in den vielfältigen Darstellungen zum 20. Jahrhundert als „Zeitalter der Extreme“ (Eric Hobsbawm) ausdrückt. Das besondere Interesse an der Zeitgeschichte lässt sich weiterhin mit ihrem Konfliktpotential als „Streitgeschichte“35 erklären. Dies wiederum kann darauf zurückgeführt werden, dass wir es hier mit einer „Epoche der Mitlebenden“ (Hans Rothfels), die jeweils ihre Sicht auf ihre Geschichte einbringen, zu tun haben. Darüber hinaus ist die Zeitgeschichte für die Public History besonders interessant, weil sie hier in besonderem Maße Audio- und Video-Quellen einbinden kann, die gerade in der Vermittlung größere Aufmerksamkeit erzielen. Gleichzeitig sind diese medialen Geschichtsdarstellungen wiederum Quellen für die Analyse zeithistorischer Vermittlungsstrategien. Besondere Herausforderungen stellen dabei die relativ schnelllebigen Präsentationen im Internet dar, für deren Untersuchung bisher noch kaum Ansätze entwickelt wurden.
Geschichtspräsentationen, die von Public Historians erstellt werden, unterliegen besonderen Anforderungen. Sie sind Geschichte für die Öffentlichkeit und in der Öffentlichkeit. Als solche wiederum können sie auch als „popular history“36 verstanden werden. Damit wird darauf verwiesen, dass Public History Geschichte für ein Nicht-Fachpublikum in einer populären Art aufbereitet. Sie soll jedoch nicht nur unterhalten, sondern auch historische Prozesse veranschaulichen. Dafür benötigen Public Historians die Fähigkeit, den bereits vorhandenen geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisstand aufzuarbeiten und gegebenenfalls auch selbst zu forschen, um in einem zweiten Schritt die Ergebnisse für ein nicht fachwissenschaftlich vorgebildetes Publikum verständlich und anschaulich in verschiedenen Medien aufzubereiten. Somit kann Public History originäre Beiträge zur Geschichtsschreibung und Geschichtskultur leisten.
Public Historians sollten daher fachwissenschaftlich mit Texten, Bildern, Filmen, Tondokumenten und Objekten als Quellen umgehen können. Sie sollten die Quellen aber auch professionell als Vermittlungselemente in Präsentationen wie einem Film, einer Radiosendung, einer Ausstellung, einem Buch oder einer Website einsetzen können. Dafür wiederum werden die geschichtswissenschaftlichen Methoden der Textanalyse, aber auch der Oral History, Visual History, Material Culture und auch der Sound History benötigt. In diesem Buch ist diesen Zugängen jeweils ein eigenes Unterkapitel gewidmet (siehe Kapitel 3). Darüber hinaus wird die Geschichtsdidaktik hier im konkreten Bezug zur Public History einbezogen (siehe Kapitel 2). Public History verknüpft somit verschiedenste Methoden, sowohl in der Forschung als auch in der Konzeption neuer Geschichtsdarstellungen.