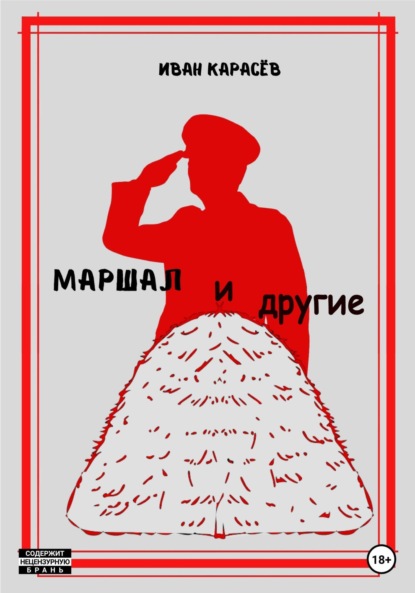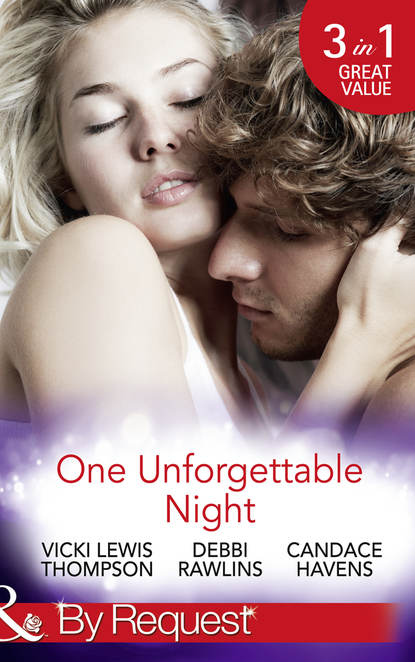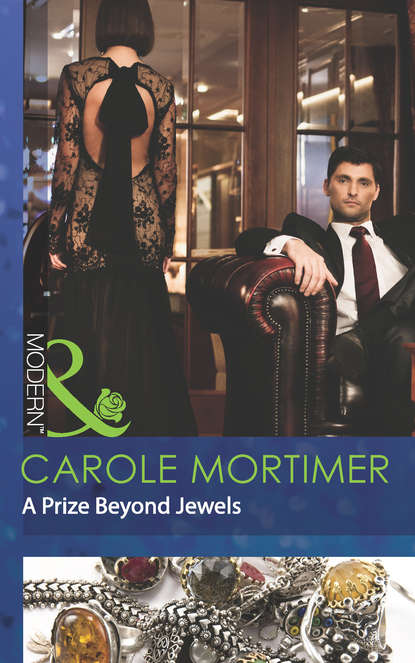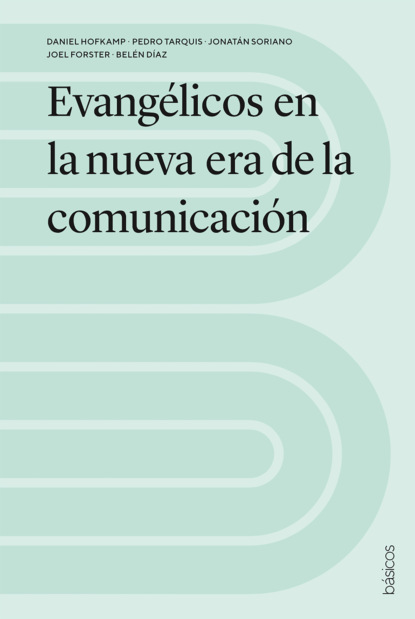- -
- 100%
- +
V. 9-13: Die Überlieferung konkretisiert V. 5-8 und ist deswegen genauso ungeschichtlich wie das Stück V. 5-8 selbst.
V. 15: Das Logion ist rätselhaft, denn es begründet im Kontext des MkEv, warum die Jünger mit unreinen Händen Brot essen dürfen (Mk 7,5). Das ist verwunderlich, da das Wort selbst Speisegesetze kritisiert und nicht Reinheitsgesetze. Reinheitsvorschriften haben, modern gesprochen, mit Hygiene zu tun und betreffen z.B. menstruierende Frauen, Aussätzige sowie Ausfluß am männlichen Geschlechtsorgan (vgl. Lev 12-15). Speisegesetze beziehen sich auf die Ernährung und regeln den Verzehr von reinen und unreinen Tieren (Lev 11). Das Wort Mk 7,15 dürfte daher von Haus aus isoliert überliefert und erst nachträglich von Mk in das Textstück eingefügt worden sein. Er wurde dazu wohl durch die Überlegung veranlaßt, das Essen mit unreinen Händen mache den Pharisäern und Schriftgelehrten zufolge den Menschen ebenfalls unrein, so daß das Logion im weiten Sinn als Kritik auch an den Reinheitsgesetzen gelten könne.
Die Radikalität dieses Wortes ist eng mit der von Mk 2,27 verwandt, insofern es ebenfalls eine trotzige Reduktion des Gesetzes (diesmal des Speisegesetzes) vornimmt. Für die Echtheit des Wortes spricht zunächst das Differenzkriterium, da die Speisegesetze im Urchristentum, wie zahlreiche Belege zeigen (Gal 2,11-15; Apg 10,9-16; Apg 15,20 u.ö.), uneingeschränkt galten. Sodann ist das Seltenheitskriterium zur Stützung der Echtheit des Wortes in Anschlag zu bringen. Da sich auch andere Äußerungen Jesu durch Radikalität auszeichnen, entspricht das Wort zusätzlich dem Kohärenzkriterium.
V. 18b-19: Diese Überlieferung zieht die Konsequenz aus dem echten Wort Jesu in V. 15 und geht vielleicht selbst auf ihn zurück.
Mk 7,24-30: Die Syrophönizierin
(24) Und von dort brach er auf und ging in das Gebiet von Tyrus. Und er kam in ein Haus und wollte, daß es niemand erfährt, und er konnte nicht verborgen bleiben.
(25) Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Sie kam und warf sich zu seinen Füßen. (26) Die Frau aber war Griechin, der Herkunft nach Syrophönizierin. Und sie bat ihn, daß er den Dämon aus ihrer Tochter austreibe. (27) Und er sagte ihr: »Laßt zuerst die Kinder satt werden! Denn es ist nicht gut, den Kindern das Brot zu nehmen und den Hündlein vorzuwerfen.«
(28) Sie aber antwortete und sagt ihm: »Herr, auch die Hündlein unter dem Tisch essen von den Brotkrümeln der Kinder.«
(29) Und er sagte ihr: »Um dieses Wortes willen geh! Ausgefahren aus deiner Tochter ist der Dämon.«
(30) Und sie ging fort in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren.
Redaktion
Vorbemerkung: Die Perikope gehört zusammen mit Mt 8,5-13/Lk 7,1-10 und Lk 17,11-19 zu den Berichten über Fernheilungen an Heiden. Vielleicht entstand die Gattung der Fernheilungsgeschichten, weil Jesus in Wirklichkeit niemals Heiden geheilt hat. In dieser Gattung käme dann zum Ausdruck, daß Jesus erst als der erhöhte Herr Heiden kuriert. Die Gattung »Fernheilung« wäre in diesem Fall der Versuch, das rein jüdische Wunderwirken Jesu mit der alle Menschen umfassenden Wundertätigkeit des erhöhten Herrn auszugleichen.
V. 24: Redaktionell ist die Verknüpfung mit dem Kontext und überhaupt die ganze Tyrus-Reise (vgl. V. 31). Dabei mag die Ortsangabe von Mk aus V. 26 erschlossen worden sein. Die Aussage, Jesus habe, damit ihn niemand erkenne, ein Haus betreten, sei aber trotzdem nicht unbemerkt geblieben, ist typisch markinisch (vgl. 1,45; 5,43; 9,30).
V. 27: Das mk »zuerst« schwächt die Logik von Jesu Argumentation. Denn der nachfolgende Begründungssatz billigt den Hunden überhaupt kein Brot zu. In der Gesamtkonzeption des MkEv deutet sich die Hinwendung der Evangeliumspredigt zu den Heiden an.
V. 28: Die Anrede Jesu als „Herr“ kommt nur hier im MkEv vor und spiegelt Jesu Verehrung in heidenchristlichen Gemeinden wider.
Ertrag: An der Geschichte zeigt Mk, daß die Wunderkraft Jesu auch für heidnische Gemeinden gilt, ja, die Erzählung bekommt – sowohl für die Tradition als auch für Mk selbst (vgl. 13,10) – Paradigmacharakter für die Hinwendung der Gemeinde Jesu zu den Heiden. Die Pointe der Erzählung ist, daß Jesus durch den Glauben der Frau überwunden wird. Zwar wird ihr Glaube nicht explizit so genannt, doch liegt er als Phänomen innerhalb der Geschichte vor.
Tradition
V. 25-30 enthalten die einheitliche Komposition eines mit einem Wunder verbundenen Streitgesprächs. »Das Wunder wird hier ja nicht um seiner selbst willen erzählt, sondern Jesu im Gespräch sich entwickelndes Verhalten ist die Hauptsache. Und zwar liegt eine Art Streitgespräch vor, in dem diesmal aber Jesus – ohne daß dies einen Schatten auf ihn würfe – der Überwundene ist« (Bultmann, 38). Dazu kommen die üblichen Kennzeichen einer Wundergeschichte: Darstellung des Unglücks und Ansuchen um Hilfe (V. 25f), Heilung durch Jesus (V. 29) und Feststellung der Tatsache des Wunders (V. 30). Das Streitgespräch (zwischen Jesus und der Frau) und das Wunder gehören ursprünglich zusammen. Der Dialog ist durch die außergewöhnliche Tatsache bedingt, daß Jesus von einer Heidin um Hilfe gebeten wird.
Der Tradition dürften urgemeindliche Debatten über den Zugang der Heiden zur Gemeinde zugrunde liegen. Aus der Härte der Debatte erklärt sich die scharf ablehnende Antwort Jesu. Doch der Erfolg der Heidenmission innerhalb des frühen Christentums führte schließlich auch zu einem versöhnlichen Schluß innerhalb der Erzählung.
Historisches
Der geschichtliche Ertrag ist gleich Null, da die Erzählung aus Debatten der frühchristlichen Gemeinde abgeleitet werden muß. Der manchmal unternommene Versuch, einen historischen Rest bzw. einen historischen Kern der Tradition zu retten, besteht zumeist in der Annahme, Jesus habe manchmal eben auch Heiden geheilt (vgl. 5,1-20) und damit letztlich die Offenheit der von ihm begründeten Bewegung auch für Heiden dokumentiert. Doch wo ein Kern vorausgesetzt wird, muß er auch faßbar sein. Das ist jedoch in der vorliegenden Geschichte nirgends der Fall. Vgl. weiter zu Mt 15,21-28.
Mk 7,31-37: Der Taubstumme
(31) Und wieder zog er aus dem Gebiet von Tyrus weg und kam durch Sidon an den See von Galiläa mitten in das Gebiet der Dekapolis.
(32) Und sie bringen zu ihm einen Taubstummen und bitten ihn, daß er ihm die Hand auflege. (33) Und er nahm ihn von der Volksmenge weg abseits und legte seine Finger in seine Ohren, spuckte und berührte seine Zunge. (34) Und indem er hinauf in den Himmel blickte, seufzte er und sagt zu ihm: »Ephata«, was heißt: sei geöffnet. (35) Und seine Ohren öffneten sich, und sogleich wurde die Fessel seiner Zunge gelöst und er redete richtig.
(36) Und er befahl ihnen, daß sie es niemandem sagten. Je mehr er es aber ihnen befahl, desto mehr verkündeten sie es.
(37) Und über die Maßen erregten sie sich und sagten: »Gut hat er alles gemacht, auch die Tauben macht er hören und die Stummen reden.«
Redaktion
V. 31: Dieser Vers gehört eng mit dem redaktionellen V. 24 der vorigen Geschichte zusammen.
V. 34: Wahrscheinlich geht die griechische Übersetzung des Zauberwortes ebenso wie die Übersetzungen an anderen Stellen (vgl. 5,41; 15,22.34) auf Mk zurück.
V. 36 enthält ein typisch mk Geheimhaltungsgebot (vgl. 1,44f; 5,43a), das nur gegeben wird, um übertreten zu werden.
V. 37: Der jubelnde Ausruf der Menge könnte redaktionell sein. Aus dem einmaligen Vorfall macht er ein sich immer wiederholendes Ereignis. Zugleich klingt mit ihm wiederum die Frage nach der Identität Jesu an (vgl. 4,41 und 5,7; 6,3.14b.15.50).
Tradition
V. 32-35: Die vorliegende Geschichte kennt verschiedene Heiltechniken, die von Magie geprägt sind. Typisch dafür ist: a) die Absonderung des Taubstummen vom Volke, b) das Verfahren, die Finger in die Ohren zu legen, c) die Berührung der Zunge mit dem Speichel, d) das Aussprechen eines Zauberworts (ephata).
Gegebenenfalls könnte man auch noch hinter V. 37, der oben als vielleicht redaktionell bezeichnet wurde, einen traditionellen Chorschluß sehen. Zum Hintergrund vgl. noch Gen 1,31; Jes 29,18; 35,5.
Eine Variante der Erzählung findet sich später 8,22-26 (ohne Zauberwort).
Historisches
Zur Frage der Heilung eines Taubstummen ist zunächst ähnliches zu bemerken wie zu den Heilungen Jesu, die sich auf Besessene und dergleichen beziehen. Einzelne Heilungen sind geschehen, jedoch wohl nicht in der Häufigkeit, wie das die neutestamentlichen Evangelien voraussetzen. Allerdings dürfte die vorliegende Erzählung wegen ihrer Detailliertheit einen hohen Anspruch auf Echtheit besitzen.
Mk 8,1-9: Die Speisung der Viertausend
(1) In jenen Tagen, als wiederum eine große Volksmenge anwesend war und sie nichts zu essen hatten, rief er die Jünger und sagt ihnen: (2) »Ich habe Erbarmen mit dem Volk, denn sie harren schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. (3) Und wenn ich sie nüchtern in ihr Haus entlasse, werden sie unterwegs ermatten. Und manche von ihnen sind von weither gekommen.«
(4) Und seine Jünger antworteten ihm: »Wie kann jemand diese hier mit Broten in der Wüste sättigen?« (5) Und er fragte sie: »Wieviel Brote habt ihr?« Sie aber antworteten: »Sieben.«
(6) Und er befiehlt der Volksmenge, sich auf die Erde zu setzen. Und er nahm die sieben Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie vorsetzten, und sie gaben (sie) dem Volk. (7) Und sie hatten wenige Fischlein. Und er sprach über sie das Dankgebet und sagte, auch diese vorzusetzen.
(8) Und sie aßen und wurden satt, und sie nahmen die übriggebliebenen Brocken, sieben Körbe.
(9a) Es waren aber ungefähr viertausend.
(9b) Und er entließ sie.
Redaktion
Mk erzählt die Speisungsgeschichte zweimal; die zuerst erzählte in 6,34-44 spielt auf jüdischem, die hier plazierte auf heidnischem Boden. Daraus geht sein Interesse an ihr unzweideutig hervor, sosehr er auch in beiden Fällen im Anschluß an Tradition formuliert. Die wichtigsten Unterschiede der vorliegenden Speisungsgeschichte zur vorigen sind folgende: a) Ihr Stil ist knapper. b) Jesus – nicht die Jünger – wird auf die Not der Massen aufmerksam. c) Die Jünger haben sieben (und nicht fünf) Brote. d) 4000 (und nicht 5000) werden gespeist, und sieben Körbe bleiben übrig (und nicht 12 Körbe). e) Jesus hilft ausschließlich aus der leiblichen Not – das Volk hat seit drei Tagen nichts mehr zu essen, und deswegen erbarmt sich Jesus über es. In der vorigen Geschichte klang demgegenüber in Jesu Erbarmen über die Herde, die keinen Hirten hat, auch die geistliche Not an. f) Die Rolle der Jünger ist blasser geworden.
In 8,17-21 führt Mk dann unter ausdrücklichem Bezug auf die beiden Speisungsgeschichten aus, wie er sie verstanden wissen will.
Tradition
Die beiden Fassungen der Speisungsgeschichte sind nicht zwei selbständige Überlieferungen, sondern Ausgestaltungen einer gemeinsamen Urtradition. Gegenüber der Überlieferung hinter 6,34-44 ist die vorliegende Tradition möglicherweise darin ursprünglicher, daß sie etwas knapper erzählt ist. Beispielsweise fehlt in ihr die Notiz über die Ausführung des Befehls Jesu zum Hinsetzen (vgl. 8,6a mit 6,39-40).
Gleichwohl ist 8,1-9 gegenüber 6,34-44 sekundär; denn die Handlung setzt hier mit der Initiative Jesu (V. 1f) ein; aus der Schilderung »Er hatte Erbarmen« (6,34) ist die direkte Rede »Ich habe Erbarmen« (8,2) und aus dem Verlangen der Jünger (6,36) eine Überlegung Jesu (8,3) geworden.
Historisches
Vgl. die Bemerkungen zu 6,34-44. Der geschichtliche Ertrag ist auch bezüglich dieses Wunders gleich Null.
Mk 8,10-21: Gegen die Zeichenforderung der Pharisäer. Das Unverständnis der Jünger
(10) Und sogleich stieg er in ein Boot mit seinen Jüngern und kam in das Gebiet von Dalmanutha.
(11) Und die Pharisäer zogen aus und begannen mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten und ihn versuchten. (12) Und er seufzte in seinem Geist und sagt: »Was fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Amen, ich sage euch: Keinesfalls wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden.«
(13) Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr weg an das andere Ufer.
(14) Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen, und hatten nur ein einziges Brot mit sich im Boot. (15) Und er schärfte ihnen ein und sagte: »Seht, nehmt euch in acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes!«
(16) Und sie überlegten untereinander, daß sie keine Brote hätten. (17) Und er erkennt es und sagt ihnen: »Was überlegt ihr untereinander, daß ihr keine Brote habt? Begreift und versteht ihr nicht? Ihr habt ein verstocktes Herz.
(18) Obwohl ihr Augen habt, seht ihr nicht,
und obwohl ihr Ohren habt, hört ihr nicht.
[Vgl. Jer 5,21]
Und erinnert ihr euch nicht, (19) als ich die fünf Brote für die Fünftausend brach, wieviel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt?« Sie sagen ihm: »Zwölf«. (20) »Als (ich) die sieben für die Viertausend (brach), wieviel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben?« Und sie sagen: »Sieben«.
(21) Und er sagte ihnen: »Versteht ihr noch nicht?«
Redaktion
V. 10a ist eine von Mk geschaffene Überleitung, außer der Ortsangabe Dalmanutha. Man beachte, wie der Evangelist wiederum das Bootsmotiv einbringt (vgl. 4,1.36 u.ö.).
V. 11: Die Einleitung der Zeichenforderung ist von Mk gestaltet. Denn die Pharisäer bevorzugt Mk als Gegner Jesu. Zudem verengt Mk mit ihnen den Kreis der Adressaten seiner Antwort: »dieses Geschlecht« (V. 12).
V. 12: „Jesu Antwort wird mit einem Hinweis auf seine Gefühle eingeleitet (vgl. 3,5) und ist dann auch entsprechend emphatisch“ (Lührmann, 136). Man vgl. 7,34.
V. 13 nimmt das Bootsmotiv wieder auf und stammt von Mk (vgl. zu V. 10a).
V. 14-21 sind voller mk Motive und – mit der möglichen Ausnahme von V. 15, dessen Sinn dunkel ist – in toto redaktionell. Das aus der Speisungsgeschichte stammende Brotmotiv durchzieht den ganzen Abschnitt (V. 14.16.17.19). V. 14 nimmt V. 4 auf. V. 15: »die Pharisäer« bezieht sich auf V. 11 zurück. V. 16f: Das Unverständnismotiv durchzieht das MkEv. V. 19 nimmt 6,41-44 auf, desgleichen bezieht sich V. 20 auf 8,6-9 zurück. V. 21 steigert das Unverständnismotiv.
Tradition
V. 11-12 haben eine Parallele in Q (Mt 12,38-42; Lk 11,29-32). Ob die Form in Q, in der dieses Geschlecht auf das Jona-Zeichen hingewiesen wird, eine sekundäre Erweiterung gegenüber Mk ist oder ob umgekehrt Mk 8,11f eine Kürzung darstellt, ist kaum zu entscheiden.
Historisches
V. 12 dürfte auf Jesus zurückgehen, denn das Wort atmet einen charakteristisch-individuellen Geist. Jesus verweigert eine Beglaubigung für sein Auftreten. Offenbar war für Jesus selbst seine Wunderkraft eine evidente Tatsache. Den Beweis dafür hat er aber anderen, die eine Beglaubigung forderten, verweigert. Vgl. weiter zu Lk 11,29-32.
Mk 8,22-26: Der Blinde
(22) Und sie kommen nach Bethsaida.
Und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, daß er ihn berühre. (23) Und er nahm die Hand des Blinden und führte ihn aus dem Dorf hinaus und spuckte auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: »Siehst du etwas?« (24) Und aufsehend sagte er: »Ich sehe die Menschen, denn wie Bäume herumwandelnd schaue ich sie.« (25) Darauf legte er wiederum die Hände auf seine Augen, und er sah scharf und war wiederhergestellt und sah alles deutlich.
(26) Und er schickte ihn in sein Haus und sagte: »Geh nicht in das Dorf hinein!«
Redaktion
Der redaktionelle Sinn ergibt sich vor allem aus der Stellung der Perikope im Gesamtrahmen des MkEv. Sie weist einerseits auf das Verstehen des Jüngers Petrus in 8,29 voraus. Andererseits nimmt sie die von den Jüngern ausgesagte Blindheit (und Taubheit) in 8,18 auf. Wie bereits die Heilung des Taubstummen in 7,31-37 hat auch die Öffnung der Augen des Blinden teilweise symbolische Bedeutung.
Tradition
Mk hat an dieser Stelle eine Erzählung überliefert, die demselben Typ wie die Geschichte vom Taubstummen in Mk 7,32-35 entspricht. Sie enthält ähnliche Merkmale wie die Geschiche vom Taubstummen. a) Man bringt zu Jesus einen Kranken mit der Bitte um Heilung, b) Jesus nimmt ihn von den Zuschauern abseits, c) er heilt ihn mittels Speichel und Handauflegung. Daher ist die Geschichte als Variante von 7,32-35 zu beurteilen. Eigentümlich ist an der Geschichte im Verhältnis zu 7,32-35 nur, daß keine Zauberformel vorkommt and daß die Heilung in Stufen vonstatten geht.
Historisches
Der Wunderbericht Mk 8,22-26 mag auf eine geschichtliche Begebenheit zurückgehen. Die Verwendung von Speichel als Augenheilmittel war bereits zur Zeit Jesu im antiken Judentum üblich. Eine solch abstruse Geschichte wie die vorliegende läßt sich schwerlich aus der Gemeinde ableiten.
Mk 8,27-33: Das Messiasbekenntnis und das Versagen des Petrus
(27) Und Jesus ging weg und seine Jünger in die Dörfer von Cäsarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sagte ihnen: »Wer, sagen die Menschen, sei ich?« (28) Sie aber sagten ihm und sprachen: »Johannes der Täufer‹, und andere: ›Elia‹, und andere: ›einer der Propheten‹.« (29) Und er fragte sie: »Ihr aber, wer sagt ihr, daß ich sei?« Petrus aber antwortete und sagt ihm: »Du bist der Christus.«
(30) Und er bedrohte sie, daß sie niemandem über ihn erzählen.
(31) Und er begann sie zu lehren: »Der Menschensohn muß viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen.« (32) Und mit Freimut sagte er das Wort.
Und Petrus nahm ihn zur Seite und begann ihn zu bedrohen. (33) Er aber wandte sich um, sah seine Jünger und bedrohte Petrus und sagt: »Tritt hinter mich, Satan, denn du hast nicht Gottes Sache im Sinn, sondern des Menschen Sache!«
Redaktion
Mit 8,27 beginnt ein neuer Teil des MkEv. Den Jüngern gegenüber eröffnet Jesus, wer er wirklich ist, korrigiert aber sofort das Mißverständnis des Petrus.
V. 27 ist in seinem ersten Teil ganz von Mk geschaffen; vgl. bes. das Wegmotiv (9,33f; 10,17; 10,32; 10,52).
V. 28 erinnert stark an 6,14f. Dabei ist 6,14f offensichtlich von der vorliegenden Stelle abhängig.
V. 30 enthält das mk Motiv des Messiasgeheimnisses.
V. 31 ist die erste Leidens- und Auferstehungsankündigung, die ebenso wie die zweite (9,31) und dritte (10,32b-34) von Mk eingefügt wurde. Dies ergibt sich zwingend aus ihrem sprachlich überwiegend mk Charakter und ihrer planmäßigen Verteilung auf Mk 8-10.
V. 32a: »Freimut« erscheint nur an dieser Stelle bei den Synoptikern, ist aber beim vierten Evangelisten häufig: 7,13.26; 10,24 u.ö. Vgl. auch Apg 2,29; 4,13.29 u.ö. Gleichwohl dürfte V. 32a redaktionell sein, um so mehr, als er, wie andere mk Stellen auch, die klare Voraussicht Jesu über sein Schicksal zeigt.
V. 32b: Petrus widersetzt sich dem Gedanken, daß der Menschensohn Jesus leiden muß. Doch kann er auch die Aussage der Auferstehung nicht verstehen. Man beachte, daß für Mk »Christus« und »Menschensohn« identisch sind (vgl. zu Mk 14,61-62).
Tradition
Ausgangspunkt der Traditionsanalyse ist, daß die Anrede des Petrus als Satan auf historisch zuverlässige Überlieferung zurückgehen muß. Denn diese »Verteufelung« des angesehenen Jüngers läßt sich nicht aus der Gemeinde ableiten.
Unter Abzug der redaktionellen V. 30-32 ergibt sich ein Anschluß von V. 33 an V. 29. Der Gedankengang der rekonstruierten Tradition verläuft dann wie folgt: Jesus weist die Erwartung, er sei der Messias, die von Petrus an ihn herangetragen wird, als satanische Anfechtung zurück.
Historisches
Die Gründe, die für die historische Wahrscheinlichkeit der Anrede Petri als Satan durch Jesus sprechen, wurden bereits im vorigen Abschnitt genannt. Und auch der Anlaß zu dieser Anrede, die Messiaserwartung Petri, dürfte historisch sein. Eine andere Frage ist natürlich, ob der Zeitpunkt des in der Tradition widergespiegelten Streites zwischen Jesus und seinem ersten Jünger von Mk richtig bestimmt ist. Hier will ich mich nicht festlegen. Jedenfalls fand eine Kontroverse darüber statt, ob Jesus der politische Messias sei (der die Römer aus dem Land jagt und das Reich Davids wiedererrichtet (vgl. Psalmen Salomos 17). Jesus weist diese Erwartung des Petrus entschieden zurück und dämonisiert seinen ersten Jünger. Der Satan, dessen Sturz Jesus bereits geschaut hat (Lk 10,18), kommt ihm ausgerechnet in der Erwartung seines engsten Vertrauten in die Quere. Als Satan redet Jesus Petrus an und belegt ihn mit dem Bann.
Mk 8,34-38: Von der Nachfolge Jesu
(34) Und er rief die Volksmenge mit seinen Jüngern zusammen und sagte ihnen:
»Wenn jemand hinter mir herfolgen, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. (35) Wer nämlich sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten.
(36) Was nützt es nämlich dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben einbüßt? (37) Denn was wird ein Mensch als Tausch für sein Leben geben?
(38) Wer sich nämlich meiner und meiner Worte in diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit des Vaters mit den heiligen Engeln.«
Redaktion
Die Stellung der Nachfolgerede im unmittelbaren Anschluß an Jesu Zurückweisung der Einrede Petri läßt bezüglich der Intention des Mk den Schluß zu: Mk gibt seiner Gemeinde eine Belehrung darüber, wie Nachfolge in der Gegenwart aussehen kann. Man vgl. ähnliche Belehrungen im Anschluß an die zweite und dritte Leidensweissagung jeweils nach einem Unverständnis der Jünger (9,32-50; 10,35-45).
V. 34a: Die Einleitung ist redaktionell (vgl. 7,14; 8,1 u.ö.).
V. 35: Mk fügt ähnlich wie in 10,29 »um des Evangeliums willen« hinzu. Das „Evangelium ist der von den Aposteln gepredigte Christus“ (Wellhausen, 387). Vgl. auch oben, S. 19.
Tradition
In diesem Abschnitt sind verschiedene Jesuslogien zusammengestellt:
V. 34b: Dies ist ein Spruch eines nachösterlichen Propheten, denn bei dem Kreuz kann nur an das Kreuz Jesu gedacht werden; die Jünger sollen wie er das Martyrium willig über sich ergehen lassen. Das Kreuz tritt hier schon als Symbol des Christentums auf. Vgl. auch zu Mt 10,38/Lk 14,27.
V. 35: Die Q-Fassung dieses Wortes (Lk 17,33/Mt 10,39) ist älter, da sie in ihrer ursprünglichen Form (Lk) noch nicht den Bezug auf Jesus enthält.
V. 36-37: Hier liegen zwei weisheitlich geprägte Fragen vor, die beide negativ zu beantworten sind. Der Gewinn der ganzen Welt nützt nichts. Vgl. Ps 49,8-10; Koh 1,3; Lk 12,16-20.
V. 38: Dies ist ein Jesuswort, das über die anderen hinaus noch den zukünftigen Menschensohn ins Spiel bringt und eine deutlich apokalyptische Perspektive zeigt. Vgl. die Q-Parallele Lk 12,8f/Mt 10,32f und die zu Lk 12,8f gegebenen Erläuterungen.