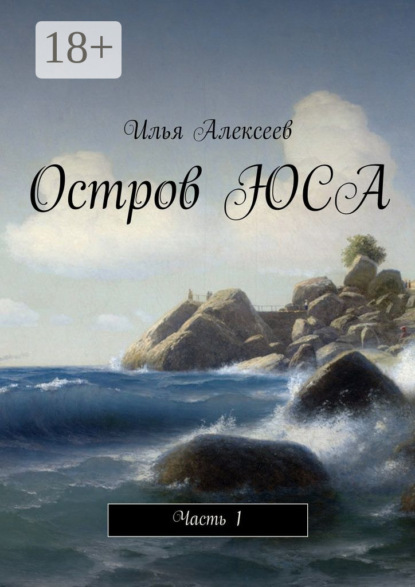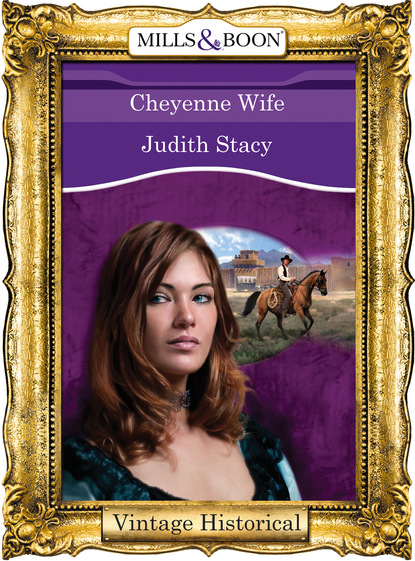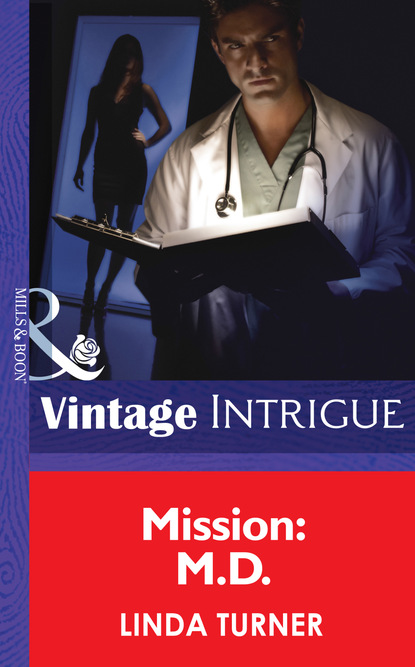- -
- 100%
- +
Historisches
V. 34b: Dieses Wort ist in der vorliegenden Form, aber auch in der Q-Fassung unecht, da es auf den »Erhöhten« zurückgeht. Daß Jesus selber seiner Kreuzigung im vorhinein einen metaphorischen Sinn abgewonnen habe, scheint abwegig.
V. 35: Die Echtheit dieses profanen Sprichwortes ist auch ohne mk Hinzufügungen und ohne Bezug auf Jesus höchst unsicher.
V. 36-37 tragen weisheitliche Prägung und gehen nur vielleicht auf Jesus zurück.
V. 38 ist unecht.
Mk 9,1-13: Jesu Verklärung und Gespräch beim Abstieg vom Berg
(1) Und er sagte ihnen: »Amen, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes in Kraft gekommen sehen.«
(2) Und nach sechs Tagen nahm Jesus Petrus und Jakobus und Johannes und führt sie allein beiseite hinauf auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. (3) Und seine Kleider wurden ganz glänzend weiß, wie sie kein Walker auf der Erde so weißen kann.
(4) Und ihnen erschien Elia mit Mose, und sie führten ein Gespräch mit Jesus.
(5) Und Petrus antwortete und sagt zu Jesus: »Rabbi, gut ist es für uns, hier zu sein. Und wir wollen drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine.« (6) Denn er wußte nicht, was er antwortete, sie waren nämlich von Furcht ergriffen. (7) Und es entstand eine Wolke, die sie überschattete. Und eine Stimme geschah aus der Wolke: »Dieser ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn!« (8) Und plötzlich, als sie um sich blickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus allein bei ihnen.
(9) Und als sie vom Berg herabstiegen, befahl er ihnen, daß sie niemandem von dem, was sie gesehen hatten, erzählten, außer wenn der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. (10) Und sie griffen das Wort auf und stritten untereinander, was es sei, von den Toten aufzuerstehen. (11) Und sie fragten ihn und sprachen: »Warum sagen die Schriftgelehrten, Elia müsse zuerst kommen?«
(12) Er aber sagte ihnen: »Kommt Elia zuerst, um alles wieder herzustellen? Wieso steht dann geschrieben über den Menschensohn, daß er vieles leiden und verachtet werden wird? (13) Aber ich sage euch: Elia ist gekommen, und sie taten ihm, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht.«
Redaktion
V. 1: Mk kann den überlieferten Satz hier übernehmen, da er selbst, wie 13,30 zeigt, eine zeitlich bestimmte Naherwartung besaß.
Gleichwohl interpretiert die anschließend erzählte Geschichte den traditionellen V. 1. Sie steht, indem sie Jesu Herrlichkeit zeigt, in Kontrast zu 8,27-38, wo das Leiden Jesu und der Jünger behandelt wurde. Gleichzeitig ist die Perikope die göttliche Bestätigung des Petrusbekenntnisses, wenn es recht verstanden wird: Jesus ist der Christus und Menschensohn, muß aber zuvor leiden.
Die Erzählung V. 2-8 ist im Kontext fest verankert. Folgende Motive in der Geschichte sind nämlich bereits aus dem Vorhergehenden bekannt:
V. 2: Bergmotiv (vgl. 3,13; 6,46); die drei Jünger Petrus, Jakobus, Johannes (vgl. 1,16-20; 3,16f; 5,37 – im Anschluß an die Perikope: 13,3; 14,33).
V. 4: Elia (vgl. 8,28 und 9,11).
V. 5: Petrus als Sprecher der Jünger (vgl. unmittelbar vorher 8,29).
V. 6: Zum Unverständnis der Jünger vgl. 4,13; 8,14-21 und im unmittelbaren Kontext 9,10. Zur Formulierung vgl. später 14,40b.
V. 7: Die Proklamation Jesu als Sohn Gottes nimmt 1,11 auf und weist auf 15,39 voraus. (Man vgl. dazu weiter 3,11; 5,7.)
V. 9-13 bestehen aus zwei Szenen:
a) V. 9-10: Hier erscheint der »Menschensohn«, der in der Verklärungsgeschichte nicht vorkam. Das Wort nimmt denselben Ausdruck aus 8,31 auf. V. 9 enthält einen Schweigebefehl an die Jünger, den sie aber mit Unverständnis (V. 10) quittieren. Dieses Schweigegebot ist wegen seiner ausdrücklichen zeitlichen Befristung singulär. Es besagt: Eine Verkündigung dessen, was Jesus wirklich ist, wird erst nach Ostern möglich sein. Diese hermeneutische Richtschnur gilt in gleicher Weise für sämtliche anderen Schweigegebote, und auch in allen drei Leidens- und Auferstehungsvoraussagen (8,31; 9,31; 10,32-34) wird klar, daß das Geheimnis Jesu erst nach seiner Auferstehung gelüftet werden wird.
b) V. 11-13 enthalten eine schriftgelehrte Zuordnung von Elia (äußerer Anlaß ist V. 4) zum Menschensohn. Der Hinweis auf das Leiden des Menschensohnes (V. 12) greift auf 8,31 zurück. Mk sieht in Johannes dem Täufer den wiedergekommenen Elia, der aber bereits getötet wurde (6,14-29).
Tradition
V. 1: Der Vers bezieht sich auf die Erwartung des Weltendes, dem positiv der Anbruch des Reiches Gottes entspricht. Das Wort entstand in der Zeit nach dem Tode und der »Auferstehung« Jesu, als die Erwartung des Kommens Jesu vom Himmel zwar noch lebendig war, etliche seiner Jünger jedoch unverhofft gestorben waren. Den noch lebenden Jüngern sichert das Wort Jesu als Trost zu: Wenigstens ein kleiner Rest der ersten Generation wird den Anbruch des Reiches Gottes noch erleben. Ihr könnt euch darauf verlassen.
Einen Einblick in das Problem der »Parusieverzögerung«, um das es hier geht, liefern die Briefe eines Augenzeugen der ersten urchristlichen Generation, Paulus. 1Kor 15,51 berichtet er von einem ihm widerfahrenen »Geheimnis«, d.h. einem ihm als Propheten zuteil gewordenen Wort des Herrn, das Probleme in der Gemeinde lösen soll. Er schreibt:
»Alle werden wir nicht entschlafen,
alle aber werden wir verwandelt werden.«
Darauf folgt eine Beschreibung des Endes, die seinen plötzlichen Eintritt betont, die Gerichtsposaune hervorhebt und die Totenerweckung konstatiert (1Kor 15,52).
Dieses Wort bewegt sich im Horizont der urchristlichen Erwartung, das Ende der Welt und damit die Ankunft des Herrn Jesus vom Himmel stünden unmittelbar bevor. Der Spruch verändert die Erwartung dahingehend, daß zuvor die meisten sterben würden, einige aber bis zum Ende mit ihrem Überleben rechnen könnten (so auch Mk 9,1).
Eine Vorstufe für diese veränderte Zukunftserwartung finden wir im ältesten Brief des Paulus, dem an die Thessalonicher (1Thess 4,15-17), wo das dem Propheten Paulus zuteil gewordene Wort des »Herrn« wie folgt lautet:
»(15) Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. (16) Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. (17) Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.«
Zum Zeitpunkt der Abfassung des ersten Thessalonicherbriefs setzt Paulus offenbar voraus, daß die Mehrheit der Christen, seine Person eingeschlossen, mit einem Überleben bis zur Ankunft Jesu vom Himmel rechnen könne, während eine Minderheit versterbe.
Aus dieser Rekonstruktion folgt, daß Paulus vor der Abfassung des ersten Thessalonicherbriefs davon ausgegangen war, alle Christen würden bis zum Kommen Jesu vom Himmel überleben; und in dieser Erwartung dürfte er die christliche Durchschnittsmeinung der ersten Jahre nach Tod und »Auferstehung« Jesu vertreten haben.
V. 2-8: Die Tradition ist relativ einheitlich. Man beachte aber, daß am Anfang Jesus Subjekt ist, am Ende die Jünger. Die Tradition wurzelt im jüdischen Milieu. Sie hat mancherlei Parallelen mit Ex 24: Mose steigt auf den Berg, begleitet von drei namentlich genannten Männern (V. 9). Eine Wolke bedeckt den Berg (V. 15), und zwar 6 Tage lang, und Gott redet schließlich mit Mose aus ihr (V. 16). Die Tradition begründet, allgemein gesagt, Jesu Legitimität durch seine Entrückung in die himmlische Sphäre selbst.
Die Mk als literarische Einheit vorgegebene Tradition läßt sich in drei Teile gliedern:
1. Verklärung Jesu auf dem Berg und das Erscheinen von Elia und Mose;
2. Vorschlag des Petrus, drei Hütten zu bauen;
3. Wolke und Wolkenstimme (»Inthronisationsformel«) als Pointe.
Man kann die Tradition mit guten Gründen als Ostergeschichte identifizieren, und zwar wegen des Licht- und des Bergmotivs. So sieht Paulus den himmlischen Christus in einem verklärten Lichtleib (1Kor 15,42-49), und der Auferstandene erscheint seinen Jüngern auf dem Berg: Mt 28,16-20. Die Aufnahme der Verklärungsgeschichte in 2Petr 1,16-18 verankert sie offenbar in einem österlichen Kontext.
Die vorliegende Überlieferung mag die aus Gal 2,9 bekannte Trias »Petrus, Jakobus, Johannes« in ihrem Säulenamt legitimiert haben.
Historisches
V. 1: Die Rekonstruktion der Entstehung des Wortes beweist seine Unechtheit. Doch macht es, zusammen mit den angeführten Belegen aus den Briefen des Apostels Paulus, die brennende Naherwartung der ersten christlichen Generation deutlich, die am besten verstehbar ist, wenn Jesus selbst mit dem Kommen des Reiches Gottes in allernächster Zukunft gerechnet hat.
V. 2-8: Ist die Tradition ursprünglich eine Ostergeschichte, scheidet ihre Historizität von vornherein aus.
Mk 9,14-29: Der epileptische Knabe
(14) Und als sie zu den Jüngern kamen, sah er eine große Volksmenge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. (15) Und sogleich sah ihn das ganze Volk und erschrak und lief herbei, um ihn zu begrüßen. (16) Und er fragte sie: »Was streitet ihr mit ihnen?«
(17) Und es antwortete ihm einer aus dem Volk: »Lehrer, ich brachte meinen Sohn zu dir, der einen stummen Geist hat. (18) Und wenn er ihn packt, wirft er ihn auf den Boden; und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, daß sie ihn austrieben, und sie vermochten es nicht.«
(19) Er aber antwortete ihnen und sagt: »Oh ungläubiges Geschlecht, wie lange werde ich noch bei euch sein? Wie lange werde ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir!« (20) Und sie brachten ihn zu ihm.
Und als der Geist ihn sah, riß er ihn sogleich zusammen, und er fiel auf den Boden und wälzte sich schäumend. (21) Und er fragte seinen Vater: »Wie lange Zeit ist ihm dieses geschehen?« Er aber sagte: »Von Kindheit an. (22) Und oft warf er ihn auch in das Feuer oder in Wasser, damit er ihn vernichte. Aber wenn du kannst, hilf uns und hab Erbarmen über uns.«
(23) Jesus aber sagte ihm: »Was das betrifft, sage ich dir: Alles ist möglich dem, der glaubt.« (24) Sogleich schrie der Vater des Knaben auf und sagte: »Ich glaube, hilf meinem Unglauben!«
(25) Als aber Jesus sah, daß das Volk zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist, und sagte ihm: »Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir: Fahre von ihm aus und kehre nicht mehr in ihn zurück!« (26) Und er schrie, riß ihn heftig zusammen und fuhr aus. Und er war wie tot, so daß viele sagten: »Er starb.« (27) Jesus aber nahm seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf.
(28) Und als er in das Haus eintritt, fragten ihn seine Jünger für sich: »Warum konnten wir ihn nicht austreiben?« (29) Und er sagte ihnen: »Diese Art kann durch nichts anderes ausfahren als durch Gebet.«
Redaktion
V. 14-16 sind redaktionell. Die Rückkehr Jesu und seiner drei Begleiter zu den Jüngern (V. 14) schließt an V. 2 an. »Schriftgelehrte« (V. 14) nimmt dieselbe Gruppe aus V. 11 auf. Wenn sie vorher genannt wurden, ging es immer um die Vollmacht Jesu (vgl. 1,22 u.ö.). Hier diskutieren sie mit den Jüngern.
V. 19 steht innerhalb des MkEv in einer langen Reihe von Stellen, die die Unfähigkeit der Jünger, zu verstehen, schlagend belegen (vgl. vorher 8,16-21).
V. 23-24 tragen das mk Glaubensmotiv ausdrücklich in die Geschichte ein. Der beispielhaft dargestellte Glaube des Vaters steht dabei in einem starken Gegensatz zur hilflosen Haltung der Jünger, die in V. 19 als ungläubiges Geschlecht bezeichnet werden.
V. 28-29 sind gleichfalls markinisch: Durch V. 28b versucht Mk vielleicht das Problem seiner Gemeinde zu bewältigen, daß sie sich der eigenen exorzistischen Fähigkeit unsicher geworden ist.
Tradition
Die doppelte Krankheitsbeschreibung (V. 17b-18; V. 21f) und die Tatsache, daß die Jünger nur am Anfang von Bedeutung sind, lassen darauf schließen, daß die von Mk aufgenommene Erzählung eine sekundäre Kombination zweier einander ähnlicher Wundergeschichten ist. Dabei scheint die zweite (etwa V. 21ff) ganz auf den Exorzismus konzentriert gewesen zu sein, während die Pointe der ersten (etwa V. 17ff) »die Gegenüberstellung des Meisters und der Zauberlehrlinge« war, »deren Unfähigkeit die Folie für die Kraft des Meisters bildet« (Bultmann, 225).
Historisches
Zuweilen wird in der Tradition die historisch zuverlässige Erinnerung an ein Jüngerversagen wiedergefunden. Doch kann man nur deswegen, weil das Jüngerversagen in anderen Wundergeschichten kein Thema ist, schwerlich auf historische Erinnerungen schließen. Zudem mag das Jüngerversagen aus der nachösterlichen Situation eingetragen worden sein, denn für sie ist es an anderen Stellen bezeugt (4,13-20; Lk 22,31f).
Zur Exorzismustätigkeit Jesu sei auch auf die Ausführungen zu Lk 11,20 verwiesen.
Zur Frage, ob das erst von Mk in die Geschichte eingebrachte Glaubensmotiv für Jesus bedeutsam war, vgl. zu 11,23.
Mk 9,30-41: Zweite Leidensweissagung. Rangstreit unter den Jüngern. Der fremde Exorzist
(30) Und von dort gingen sie hinaus und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, daß es jemand erfährt. (31) Er lehrte nämlich seine Jünger und sagte ihnen: »Der Sohn des Menschen wird in die Hände von Menschen übergeben und sie werden ihn töten und, getötet, wird er nach drei Tagen auferstehen.«
(32) Sie aber verstanden das Wort nicht, und sie fürchteten sich, ihn zu fragen.
(33) Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Haus war, fragte er sie: »Worüber habt ihr auf dem Weg gestritten?« (34) Sie aber schwiegen. Miteinander hatten sie nämlich auf dem Weg überlegt, wer der größte sei.
(35) Und er setzte sich und rief die Zwölf und sagt ihnen: »Wenn jemand erster sein will, soll er letzter von allen und der Diener von allen sein.« (36) Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte, umarmte es und sagte ihnen: (37) »Wer eines von diesen Kindern in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.«
(38) Es sagte zu ihm Johannes: »Lehrer, wir sahen jemanden in deinem Namen Dämonen austreiben und wir haben ihn daran gehindert, weil er uns nicht nachfolgte.« (39) Jesus aber sprach: »Hindert ihn nicht! Denn es gibt keinen, der in meinem Namen ein Wunder tun wird und bald darauf schlecht über mich reden kann. (40) Wer nämlich nicht gegen uns ist, ist für uns. (41) Wer nämlich euch einen Becher Wasser zu trinken gibt im Namen, daß ihr zu Christus gehört, amen, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht einbüßen.«
Redaktion
V. 30-32: Die Leidens- und Auferstehungsvoraussage entspricht 8,31. Das Motiv der Geheimhaltung findet sich auch 5,43. Das Jüngerunverständnis erscheint bereits 8,32 (vgl. 10,32).
V. 33-34 sind mk Einleitung der folgenden Szene.
V. 35: Mk hat die Zwölf in den Text eingetragen.
V. 36-37: Mk hat V. 36 unter Einwirkung von 10,16 fingiert. V. 37 »gibt eine Regel für die Zeit, wo Jesus nicht mehr selber auf Erden weilt, sondern nur vertretungsweise Beweise der Liebe empfangen kann, da sein Name unter seinen Anhängern fortlebt« (Wellhausen, 396).
V. 38-40 ist ein Traditionsstück, das Mk hier anfügte, um den Gedanken vom unverständigen Jünger weiter einzuschärfen. Gleichzeitig mag der Stichwortanschluß »in deinem Namen« (V. 38) an »in meinem Namen« (V. 37) eine Rolle gespielt haben. Das Erscheinen des Johannes in V. 38 dürfte aus 10,35-45 zu erklären sein, wo Johannes (samt seinem Bruder Jakobus) ebenfalls mit einem Anliegen an Jesus herantritt.
Tradition
V. 35b und V. 37: Mk fand beide Sprüche schon in einer sekundären, paränetisch ausgerichteten Fassung vor (zu V. 37 vgl. Lk 10,16/Mt 10,40; Joh 13,20).
V. 38-40: Die Jüngerschaft tritt als eigene Gruppe auf. V. 38 ist ein singulärer Beleg für die Aussage, daß jemand anders den Jüngern nicht nachfolgt. Also geht es um ein Problem der Gemeinde. V. 39-40: Eine profane Parallele zu V. 40 findet sich bei Cicero, Reden 41: »Für uns sind alle Gegner, außer denen, die mit uns sind, für Cäsar sind alle die Seinen, soweit sie nicht gegen ihn sind.«
V. 41 knüpft an V. 37 an und bildete mit ihm vielleicht traditionell eine Einheit.
Historisches
V. 35b und V. 37a: In beiden Sprüchen wird zuweilen der Geist Jesu wiederentdeckt. »Gibt das erste einen Blick frei auf den Geist, der in der Jüngerschaft herrschen soll, so deutet das zweite nur noch die Stellung Jesu zu den sozial schwachen Kindern an« (Gnilka, Mk I, 57). Doch muß das unbefriedigend bleiben.
V. 38-40: Die Episode ist unhistorisch, da eine Gemeindesituation zugrunde liegt. Außerdem erscheint es als ausgeschlossen, daß bereits zu Lebzeiten Jesu Menschen außerhalb seiner Jünger sich auf seinen wundersamen Namen berufen haben könnten. In V. 40 handelt sich überdies um einen Spruch, der nachträglich christianisiert worden ist. Man vgl. als Analogie das Jesus in den Mund gelegte Wort »Geben ist seliger als nehmen« (Apg 20,35), das als persischer Grundsatz bei Thukydides II 97,4 erscheint.
V. 41: Die Zugehörigkeit zu Christus weist auf die Gemeinde und nicht auf das Leben Jesu. Das Wort ist daher unecht.
Mk 9,42-43.45.47-50: Von der Verführung zur Sünde. Sprüche vom Salz
(42) »Und wer einem dieser Kleinen, die glauben, Ärgernis gibt, es wäre besser für ihn, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt wird und er ins Meer geworfen würde.
(43) Und wenn dir deine Hand Ärgernis gibt, haue sie ab! Es wäre besser für dich, verstümmelt in das Leben einzugehen als zwei Hände zu haben und in die Gehenna, in das unauslöschliche Feuer, wegzugehen.
(45) Und wenn dir dein Fuß Ärgernis gibt, haue ihn ab! Es wäre besser für dich, lahm in das Leben einzugehen, als mit zwei Füßen in die Gehenna geworfen zu werden.
(47) Und wenn dein Auge dir Ärgernis gibt, reiß es aus! Es wäre besser für dich, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in die Gehenna geworfen zu werden, (48) wo ihr Wurm nicht verendet und das Feuer nicht erlischt.
(49) Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. (50) Gut ist das Salz. Wenn aber das Salz schal geworden ist, womit würzt ihr es? Habt Salz in euch und bewahrt Frieden untereinander!«
Textkritische Vorbemerkung: V. 44 und V. 46 gehören nicht zum ursprünglichen Text.
Redaktion
V. 42-48: Mk setzt mit dieser aus der Überlieferung geschöpften Spruchfolge die mit V. 33 beginnende Belehrung der Jünger fort. V. 42: »Kleine(n)« nimmt »Kind(er)« in V. 36-37 auf. V. 48 schließt die Einheit mit einem Zitat aus Jes 66,24 ab.
V. 49 ist mk Überleitung zum nächsten Vers.
V. 50: Mit der Aufforderung zum Frieden lenkt Mk zum Ausgangspunkt des Jüngerstreites in V. 33-34 zurück und formuliert den Ertrag des eingeschobenen Traditionsstückes, nämlich Frieden miteinander zu bewahren.
Tradition
»Das Geröll isolierter und paradoxer Aussprüche Jesu in 9,33-50, die sich da ausnehmen wie unverdaute Brocken, ist höchst charakteristisch und ohne allen Zweifel das literarisch Primäre. Wie hätte Mc dazu kommen sollen, dieselben aus dem Zusammenhange zu reißen und dadurch unverständlich zu machen?« (Wellhausen, 397). Zu V. 43 und V. 47 finden sich unabhängig von Mk Parallelen in Mt 5,30 und 5,29.
V. 42-48 dürften Teil eines in 9,33-50 eingeflossenen vormk Gemeindekatechismus sein. V. 42 greift (zusammen mit V. 41) in formaler Hinsicht auf V. 37 zurück. Auf das Stichwort »Ärgernis geben« (V. 42), das hier immer die Verführung zum Abfall vom Christentum bedeutet, folgen in V. 43.45.47f drei parallel gebaute Sätze. Es fällt auf, daß im Nachsatz das Eingehen in das Leben (V. 43.45) bzw. in das Reich Gottes (V. 47) jeweils mit dem Geworfen-Werden in die Gehenna kontrastiert wird. (Die Gehenna ist eine Talschlucht südlich von Jerusalem, in der nach jüdischem Volksglauben das Endgericht stattfinden soll.) Zuvor spricht Jesus in radikaler Weise jeweils die Aufforderung aus, im Falle eines Ärgernisses die dieses verursachenden Körperteile zu zerstören.
Offene Fragen: a) Wie verhält sich »Leben« zu »Reich Gottes«? b) Wie ist die Metaphorik zu deuten? Ich setze voraus, daß die Zerstörung der Ärgernis erregenden Gliedmaßen nicht wörtlich zu nehmen ist. Gehört das zur mk Gemeinde, in der auch andere metaphorische Interpretationen festzustellen sind? S. nur 8,14-21. Vgl. zur Metaphorik noch die Ausführungen zu Mt 5,29-30.
Daß allgemein eine Gemeindesituation zugrunde liegt, belegt eindeutig V. 42, der in technischer Terminologie von den Kleinen, die glauben, spricht.
V. 50: Vgl.Mt 5,13/Lk 14,34f. Die dort vorliegende Q-Fassung des Salzwortes ist traditionsgeschichtlich älter.
Historisches
V. 42-48: Auch der Grundbestand dieser Worte geht nicht auf Jesus zurück. Denn für alle ist eine Gemeindesituation vorauszusetzen. Zur Unechtheit der Worte Jesu in V. 43 und V. 47 vgl. die Ausführungen zu Mt 5,29-30.
Zu V. 50 vgl. das Urteil zu der traditionsgeschichtlich älteren Fassung Mt 5,13/Lk 14,34-35.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.