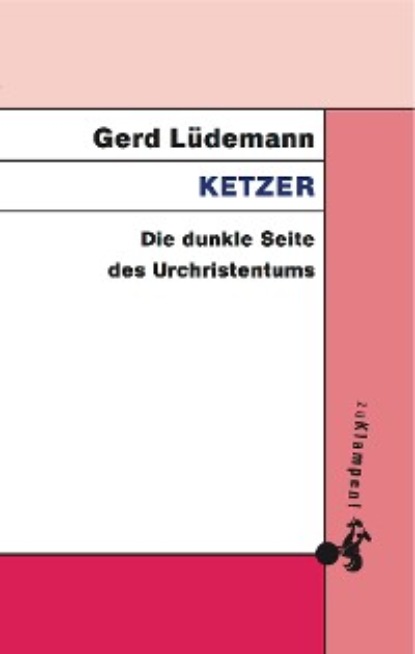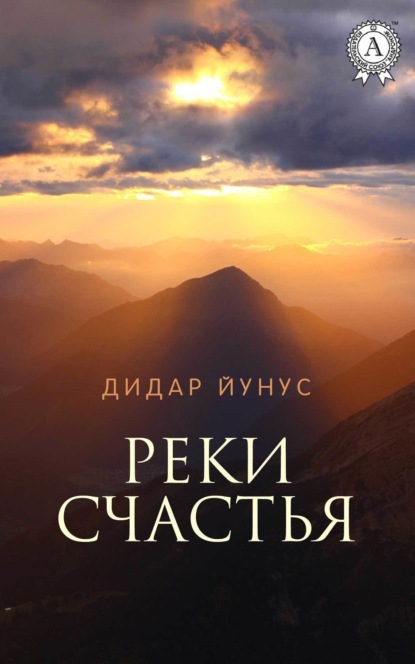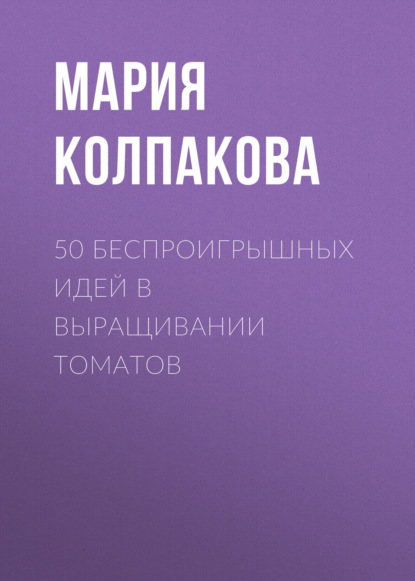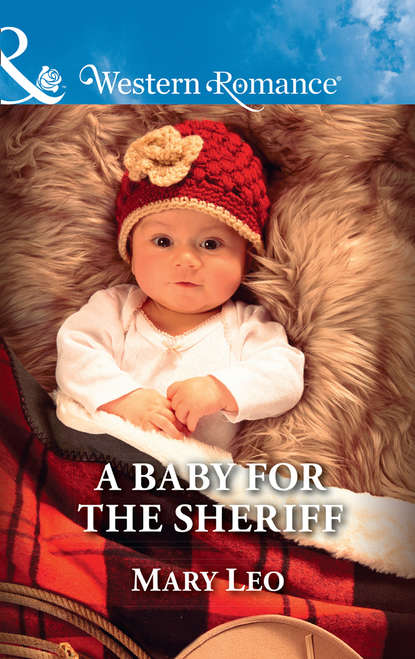- -
- 100%
- +
In seinem ersten Buch hatte er offenbar ein älteres antiketzerisches Werk verarbeitet, das alle Häretiker von Simon Magus ableitet (vgl. Haer I 23,1: Simon, »von dem alle Ketzereien abstammen«). In dem von Irenäus benutzten Werk eines Vorgängers folgen auf Simon sein Schüler Menander, dann Saturnin, Basilides, Karpokrates, Kerinth, Ebioniten, Nikolaiten, Kerdon, Markion. Da der Apologet Justin um 150 n. Chr. in I Apol 26 auf ein nicht erhaltenes antiketzerisches Werk verweist und dort die Reihenfolge Simon – Menander – Markion erscheint, wird vielfach Justins verlorene Schrift für die Vorlage von Irenäus, Haer I 23 ff gehalten. Doch ist sogleich einschränkend zu bemerken, dass in keinem Fall die Ebioniten Teil einer antihäretischen Schrift Justins gewesen sein können, da die meisten von ihnen in den Augen des aus Palästina (Neapolis) gebürtigen Apologeten Justin noch keine Ketzer waren (Dial 46 f. – zu diesem Text s. unten S. 86 – 90). Außerdem dürften die Nikolaiten, von denen wir Apk 2,14 – 15 hören – sie aßen Götzenopferfleich und »trieben Unzucht« –, hinzugewachsen sein, da sie entgegen der »Überschrift« des vorirenäischen Ketzerwerkes nicht von Simon, sondern von Nikolaos abgeleitet werden: »Die Nikolaiten haben Nikolaos als ihren Lehrer (also nicht Simon, Vf.), einen von den Sieben, die von den Aposteln als die ersten Diakone eingesetzt wurden.«. (Haer I 26,3)
Der antiketzerische Abschnitt bei Irenäus, Haer I 23 – 28 ist so aufgebaut, dass die meisten Ketzer zumindest eine Einzelheit von dem vertreten, was Simon bereits gelehrt hat.16 Besonders auffällig sind die Übereinstimmungen zwischen Simon Magus (I 23,1 – 4) und den Basilidianern (I 24,3 – 7) sowie den Karpokratianern (I 25,1 – 6)17:
1 Schöpfung der Welt durch rebellische Engel (I 23,5; 24,1 f.; 25,3);
2 Fehlen eines einzelnen Schöpfers;
3 Unkenntnis des Urwesens durch die feindlichen Mächte (vgl. zusätzlich I 26,1);
4 Seelenwanderung;
5 Kriegsmotiv;
6 Scheinkreuzigung (vgl. zusätzlich I 26,1);
7 Propheten als Gesandte der Engel;
8 paulinisch-kyrenäische Gesetzeslehre;
9 Libertinismus (vgl. zusätzlich I 26,3; 27,3 [?]; 28,2 – ferner I 6,3; 13,6 f; 31,2);
10 Magie und Idolatrie (vgl. außerdem I 13,5);
11 Gleichgestalt der Anhänger mit dem Meister.
Damit wird förmlich historisch »bewiesen«, dass sie wirklich von Simon abstammen. Trifft das zu, dann sind die fraglichen Lehren schon daraus als Ketzereien ersichtlich, dass eben jener Simon eine Abfuhr durch Petrus erhalten hat. Dies zeige unzweifelhaft der Bericht der kanonischen Apg (Kap. 8), den Irenäus selbst vor dem Ketzerkatalog ausschreibt (Haer I 23,1), freilich ohne die Bitte Simons an die Apostel zu erwähnen, sie mögen für ihn beten, Apg 8,24: »Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt!«
Der Vf. der Apg war also gegenüber dem Erzhäretiker Simon noch milder als 100 Jahre später Irenäus. Der Grund dafür liegt vor allem in der verschiedenen kirchenhistorischen Lage. Irenäus setzt strikt die Trennung von Orthodoxie und Ketzerei voraus, beim Vf. der Apg ist die Lage noch nicht so verfestigt. Er führt einen begrenzten Dialog mit konkurrierenden synkretistischen Gruppen. Dies zeigt sich nicht nur an der Simon-Perikope (Apg 8), sondern auch an der relativ offenen Gestaltung der Abschnitte über Elymas (Apg 13,6 – 12) und die Söhne des Skeuas (Apg 19,13 – 17). Elymas’ Blindheit ist nur begrenzt (13,11), und die Söhne des Skeuas flohen nackt (19,16). Der Autor »vermag … die Kritik des Synkretismus durchzuführen, ohne dessen Repräsentanten schon prinzipiell preiszugeben.«18
Irenäus beschreibt mit einer technisch zu nennenden Terminologie die Abhängigkeit der verschiedenen Häretiker untereinander. Simon hat in Menander einen Nachfolger, Markion ist der Nachfolger des Kerdon. Alle referierten Gnostiker, die auch Simonianer genannt werden (Haer I 29,1), sind Schüler und Nachfolger Simons (Haer I 27,4). Im Vorwort zu Buch II heißt es: »Wir haben die Lehre ihres Stifters Simon und aller jener, die ihm nachfolgten, aufgezeigt.«
Norbert Brox hat aus dem Vorkommen dieser technischen Terminologie geschlossen, dass es bei den Gnostikern »eine feste Vorstellung … von Lehrtradition«19 gebe. Demgegenüber wird man umgekehrt damit rechnen müssen, dass diese Ausdrucksweise aus dem Kampf des Irenäus bzw. seiner Vorgänger gegen »die fälschlich so genannte Gnosis« zu begreifen ist. Man übertrug das eigene Traditionsprinzip auf die Gegner und führte ebenso wie die eigenen kirchlichen Lehren auch alle gnostischen Phänomene auf Personen in der apostolischen Zeit zurück. So fand man den Ursprung der gegnerischen Lehren in der Verkündigung des Apg 8 bezeugten Simon Magus, und der zeitgenössische Konflikt konnte in der normativen Zeit der Apostel als schon längst entschieden gelten, hatte doch der Apostelfürst Petrus jenen Simon abgewiesen.
Zur Theologie des Irenäus
Irenäus’ Theologie, die stark von seinem Kampf gegen Irrlehrer geprägt ist, lässt sich in folgenden Punkten zusammenfassen:
Erstens sind der Schöpfer der Welt und der Vater Jesu Christi ein und derselbe.
Zweitens fasst Christus das »All«, den »Menschen« mit allem, was hinzugehört, zusammen. Er »rekapituliert« es, greift die gesamte Unheilsgeschichte auf und macht sie damit ungültig. Auf diese Weise ist die letzte Einheit von Schöpfung und Erlösung gesichert.
Drittens haben die Bischöfe und kirchlichen Lehrer den Zusammenhang mit den Aposteln in gerader Folge bewahrt.
»Durch keine anderen wissen wir von dem Plan unserer Erlösung als durch jene, dank derer die Heilsbotschaft zu uns gelangte. Diese haben sie damals zunächst mündlich verkündet, danach aber überlieferten sie uns dieselben nach Gottes Willen in Schriften, die ›Fundament und Säule (1Tim 3,15) unseres Glaubens werden sollten«. (Haer III 1,1).
Viertens ist neben der Schrift auch die apostolische Verkündigung als »Regel der Wahrheit« Norm der Auslegung (vgl. Haer II 35,4), wobei der Kanonbegriff in einem dialektischen Verhältnis zum Schriftenkanon selbst steht. Theoretisch würde sogar gelten: »Hätten nämlich die Apostel nichts Schriftliches uns hinterlassen, dann müsste man eben der Ordnung der Tradition folgen, die sie den Vorstehern der Kirchen übergeben haben«. (Haer III 4,1).20
II. Tertullian 21
Tertullian war nach dem Zeugnis des Hieronymus (vir. ill. 53) Presbyter in Karthago. Doch ist die Richtigkeit dieser Notiz zweifelhaft. Sein Geburts- und Todesjahr sind unbekannt und kaum annähernd zu bestimmen. Allerdings geben einige Schriften Hinweise auf ihre Entstehungszeit und erlauben daher, Tertullians schriftstellerische Tätigkeit etwa auf die Jahre 196 – 220 zu begrenzen sowie die Schriften zeitlich zu ordnen. Montanist22 ist er spätestens 207 geworden. Konflikte mit der Kirche und besonders dem römischen Bischof waren fast vorprogrammiert, doch fanden seine Schriften aus sämtlichen Lebensperioden damals eine interessierte Leserschaft, so dass sie sich in großer Zahl bis in die Neuzeit hinein erhalten haben. Wann, wo und warum er zum Christentum übergetreten ist, wissen wir nicht; nur dass er früher Heide war, ist von ihm selbst bezeugt.23
Tertullians antiketzerischer Kampf. Sein Charakter
In der Schrift »Prozesseinrede gegen die Häretiker«. (De praescriptione haereticorum) übertrug der juristisch gebildete Römer Tertullian das juristische Prozessmittel, dem Gegner durch Einrede die Rechtsfähigkeit zu bestreiten, in den theologischen Bereich. »Er versteht darunter die Geltendmachung des formellen Rechts, vor der sachlichen Erörterung die Bedingung des Streites festzusetzen.«24 Demnach ist die Schrift das rechtmäßige Eigentum der Kirche. Die Ketzer sind gar nicht befugt, sie zu gebrauchen; ihnen muss man von vornherein die Rechtsfähigkeit absprechen, weil die katholische Kirche unmittelbar von den Aposteln sowohl ihre Lehre als auch die Heilige Schrift zu einem Zeitpunkt empfangen hat, da es die Ketzer noch gar nicht gab. Tertullian schreibt hier:
»Wenn sie Häretiker sind, so können sie keine Christen sein, da sie die Lehren, welchen sie nach eigener Wahl anhangen und weshalb sie sich den Namen Häretiker gefallen lassen müssen, nicht von Christus erhalten haben. Als Nichtchristen erlangen sie daher keinerlei Eigentumsrecht an den christlichen Schriften. Man könnte sie mit Recht fragen: Wer seid ihr denn eigentlich? Wann und woher seid ihr gekommen? Was macht ihr auf meinem Grund und Boden, da ihr nicht zu den Meinigen gehört? Mit welchem Recht, Markion, fällst du denn eigentlich meinen Wald? Wer erlaubt dir, Valentin, meine Quellen anders zu leiten? Wer gibt dir, Apelles, die Macht, meine Grenzen zu verrücken? Das Besitztum gehört mir! Wie könnt ihr übrigen hier nach eurem Gutdünken säen und weiden? Mein ist das Besitztum, ich besitze es von jeher, ich habe es zuerst besessen, ich habe sichere Übertragungstitel von den ersten Eigentümern selbst, denen die Sache gehört hat. Ich bin Erbe der Apostel«. (Praescr 37).
Den heutigen Leser beschleicht bei solchen Sätzen das Gefühl, dass jemand um jeden Preis Recht behalten will, wobei der Zweck die Mittel heiligt und Sachlichkeit nicht angestrebt wird. Hier redet der juristisch geschulte Christ Tertullian, der den Prozess zu gewinnen strebt, dem aber die Wahrheit irgendwie abhanden gekommen ist, weil er sie fest zu besitzen meint. Ein Suchen nach der Wahrheit kommt für ihn nicht mehr in Frage, und jene Sucherreligiosität25 der Ketzer, die sich z. B. auf Jesu Wort Mt 7,7/Lk 11,9 (»Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan«) stützten, war ihm ein Gräuel. Er schreibt:
»Ich möchte es ein für allemal gesagt haben: Niemand sucht, als wer etwas nicht hat oder es verloren hat. Jene Alte (sc. im Evangelium) hatte eine von ihren zehn Drachmen verloren (Lk 15,8 f); deshalb suchte sie; sobald sie sie aber gefunden hatte, hörte sie auf zu suchen. Der Nachbar hatte kein Brot (Lk 11,5 – 8); deshalb pochte er; sobald ihm aber aufgemacht und es ihm gegeben war, hörte er auf zu pochen. Die Witwe begehrte vom Richter, angehört zu werden (Lk 18,1 – 8), weil sie keinen Zutritt erhalten hatte; sobald sie aber Gehör erlangt hatte, drang sie nicht länger in ihn. Folglich gibt es ein Ende für das Suchen, Klopfen und Bitten«. (Praescr 11).
»Seit Jesus Christus bedürfen wir des Forschens nicht mehr, auch nicht des Untersuchens, seitdem das Evangelium verkündet wurde. Wenn wir glauben, so wünschen wir über das Glauben hinaus weiter nichts mehr. Denn das ist das erste, was wir glauben: es gebe nichts mehr, was wir über den Glauben hinaus noch zu glauben haben«. (Praescr 7).
Kein Wunder, dass Tertullian zufolge beim Streit mit den Ketzern weiter nichts herauskommt, »als dass man sich den Magen verdirbt oder Kopfschmerzen bekommt«. (Praescr 16).
Doch begnügte sich Tertullian nicht mit dem Argument der Prozesseinrede, sondern bemühte sich auch um eine hier nicht weiter darzustellende, äußerst genaue, umfängliche Widerlegung der Monarchianer, Markioniten und der geläufigen Spielarten der Gnosis.26
Karl Holl hat Tertullians antiketzerische Arbeitsweise so beschrieben:
»Für jede Meinung findet er einen Kontrast, um sie lächerlich zu machen. Er hat auch über dieses Mittel freimütig bekannt:›Wenn man da und dort lacht, so wird man damit nur der Sache hier gerecht werden. Manche Dinge sind es wert, auf diese Weise widerlegt zu werden, damit man ihnen nicht durch die ernsthafte Behandlung Verehrung zollt‹.«27
Es ist daher kein Zufall, dass dieser Charakter, als er Montanist war und gegen die römische Kirche kämpfte, die einst von ihm so hoch gepriesenen kirchlichen Liebesfeiern (Apol 39,16 – 21) in den Schmutz zog.28 Und als der römische Bischof Kallist grundsätzlich das Recht des Bischofs festschrieb, Todsündern (d. h. Unzuchtsündern) Vergebung zu gewähren, löste das bei Tertullian scharfen Protest aus.29 Bei seinem Charakter nimmt es nicht wunder, dass Tertullian sich zuletzt sogar von den Montanisten getrennt und eine eigene Sekte gegründet hat.30
III. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Irenäus und Tertullian
Während Tertullian die Rechtsgrundlage der Auseinandersetzung zwischen Kirche und Gnosis bestreitet, akzeptiert Irenäus die Gnostiker als Disputanten über die Schrift, da ihre Bekehrung nicht ausgeschlossen sei. Er schreibt z. B.: »Wir wollen … die Reden des Herrn anführen, ob wir nicht vielleicht durch Christi Lehre einige von ihnen überzeugen … können«. (Haer III 25,7). Irenäus will allein mit der Schrift siegreich sein; Tertullian lehnt das ausdrücklich ab. Bei ihm gibt eine »der Schrift und Exegese übergeordnete Instanz … den Ausschlag. Die Schrift bleibt folglich aus dem Disput, und eine Berufung der Gnostiker auf sie wird nicht zugestanden.«31 Er weigert sich also strikt, zum Zweck der Urteilsfindung mit den Ketzern zusammen auf den Text selbst zurückzugehen.
Doch müssen bei beiden Kirchenvätern gleichfalls außertheologische Gesichtspunkte ins Spiel gebracht werden, die ihnen bei ihrer Polemik die Feder geführt haben mögen. Ohne sie würden wir das, was damals wirklich vorging, nicht verstehen.32
Besonders verdächtig schien Tertullian die weitgehende »Demokratisierung« unter den gnostischen Christen. Er schreibt hierüber:
»Ich will nicht unterlassen, auch von dem Wandel der Häretiker eine Schilderung zu entwerfen, wie locker, wie irdisch, wie niedrig menschlich (sic!) er sei, ohne Würde, ohne Autorität, ohne Kirchenzucht, so ganz ihrem Glauben entsprechend. Vorerst weiß man nicht, wer Katechumene, wer Gläubiger ist, sie treten miteinander ein, sie hören miteinander zu, sie beten miteinander – und der Heide auch mit, wenn er etwa dazukommt; sie werfen ihr Heiliges den Hunden und ihre, wenn auch unechten, Perlen den Säuen hin. Das Preisgeben der Kirchenzucht wollen sie für Einfachheit gehalten wissen, und unsere Sorge für dieselbe nennen sie Augendienerei. Was den Frieden angeht, so halten sie ihn auch unterschiedslos mit allen. Es ist in der Tat auch zwischen ihnen, obwohl sie abweichende Lehren haben, kein Unterschied, da sie sich zur gemeinschaftlichen Bekämpfung der einen Wahrheit verschworen haben. Alle sind aufgeblasen, alle versprechen die Erkenntnis. Die Katechumenen sind schon Vollendete, ehe sie noch Unterricht erhalten haben«. (Praescr 41).
Ein besonderes Ärgernis stellten die ketzerischen Frauen dar. Über sie schreibt er im unmittelbaren Anschluss:
»Und selbst die häretischen Frauen, wie frech und anmaßend sind sie! Sie unterstehen sich zu lehren, zu disputieren, Exorzismen vorzunehmen, Heilungen zu versprechen, vielleicht auch noch zu taufen«. (ebd.).
Ein anderer Punkt, der seinen besonderen Widerstand erregte, war der laxe Umgang der Gnostiker mit Autorität und besonders dem Bischofsamt.33 Darüber schreibt er:
»So ist denn heute der eine Bischof, morgen der andere; heute ist jemand Diakon und morgen Vorleser; heute einer Priester und morgen Laie; denn sie tragen die priesterlichen Verrichtungen auch Laien auf«. (Praescr 41).
Eine solche Vorstellung war auch Irenäus unerträglich, der seit 178 n. Chr. Bischof der Gemeinde von Lyon und Vienne war. Sein striktes Festhalten daran, dass der Vater Jesu Christi und der Schöpfer der Welt identisch seien, mag auch politisch mitbedingt gewesen sein. Die Vorstellung vom Ordnungsgefüge in der Gemeinde und vom Ordnungsgefüge im Himmel entsprachen einander. Wäre im Himmel Raum für einen unbekannten Gott gewesen, hätte das zugleich die Gefahr bedeutet, dass die Gemeinde ins Wanken geraten könnte. Und eine demokratische Kirche, wie sie bei den Ketzern im Ansatz vorhanden war, widerstritt vollends der Vorstellung eines patriarchalischen Gottes.
Und schließlich vertraten beide Ketzerbestreiter mit Nachdruck die Auferstehung des Fleisches, Irenäus sogar in ihrer chiliastischen Variante.34 Das begründeten sie in ausführlichen Exegesen von 1Kor 15 und relativierten dabei vergeblich 1Kor 15,50 (»Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben«)35, um den von ihnen bekämpften gnostischen Paulusschülern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Hatte dieses unangenehme Pochen auf der fleischlichen Auferstehung Jesu und der Gläubigen sowie – nicht zu vergessen – der Ungläubigen (zum Verdammungsgericht)36 nicht auch eine politische Dimension? Wurde doch mit ihr eine klerikale Autorität erst geschaffen.
Nun wäre es sicher verfehlt, theologische Grundsätze direkt auf politische Überzeugungen zurückzuführen. Die religiöse Wirklichkeit ist komplizierter, und die Annahme einer direkten Bedingtheit der Theologie durch die Gesellschaft ist zu simpel. Immerhin beleuchtet der Hinweis auf die Konsequenzen der Theologie für die Politik eine Dimension, um die es in dem Streit zwischen Tertullian und Irenäus auf der einen und den gnostischen Ketzern auf der anderen Seite auch ging.
Gleichzeitig sieht man daran, dass und wie die entstehende katholische Kirche ein viel leichteres Auskommen mit dem Staat haben konnte (und umgekehrt) als die alles in Frage stellenden Ketzer, die in ihrer religiösen Suche und Neugierde eine stete Gefahr für das geschlossene System eines Irenäus und Tertullian darstellten.
Kapitel 3:
Wie aus Ketzerbestreitern Ketzer wurden oder: Die Jerusalemer Judenchristen in den ersten beiden Jahrhunderten
Historische Abgrenzungen. Das Problem der Kontinuität
Äußerlich lassen sich zwei Phasen des Jerusalemer Christentums unterscheiden, die Zeit vor dem Jüdischen Krieg im Jahre 70 n. Chr. und die Zeit danach, die den Jerusalemer Christen ein weiteres Verweilen in der jüdischen Metropole kaum mehr erlaubte, weil mit der Zerstörung des Tempels durch Heiden der heilige Ort auf Dauer geschändet worden und so ein Bruch mit der Vergangenheit vollzogen war.
Wie die Jerusalemer Christen die heilige Stadt der Juden verlassen haben, ist umstritten. Eine dogmatisch motivierte Antwort bietet der Kirchenvater Euseb im 4. Jh. Er schreibt darüber Folgendes in seiner Kirchengeschichte (= KG) III 5,2 f (die entsprechenden Bibelverse, die Euseb im Blick hat, sind in Klammern gesetzt):
(2) »Als nun nach der Himmelfahrt unseres Erlösers (Apg 1,9) die Juden zu dem Verbrechen an dem Erlöser (sc. als Schuldige an seinem Tode: 1Thess 2,15; Mk 15,6 – 15) auch noch die höchst zahlreichen Vergehen an seinen Aposteln begangen hatten, als zunächst Stephanus von ihnen gesteinigt (Apg 7,58 f), sodann nach ihm Jakobus, der Sohn des Zebedäus und Bruder des Johannes, enthauptet (Apg 12,2 f) und schließlich Jakobus, welcher nach der Himmelfahrt unseres Erlösers zuerst den bischöflichen Stuhl in Jerusalem erhalten hatte, auf die angegebene Weise beseitigt worden war1, als die übrigen Apostel nach unzähligen Todesgefahren, die man ihnen bereitet hatte, das Judenland verlassen hatten und mit der Kraft Christi, der zu ihnen gesagt hatte: ›Geht hin und lehrt alle Völker in meinem Namen!‹ (Mt 28,19) zur Predigt des Evangeliums zu allen Völkern hinausgezogen waren, (3) als endlich die Kirchengemeinde in Jerusalem in einer Offenbarung, die ihren Führern geworden war, die Weissagung erhalten hatte, noch vor dem Krieg die Stadt zu verlassen und sich in einer Stadt Peräas, namens Pella, niederzulassen, und als sodann die Christgläubigen von Jerusalem weggezogen waren, und weil damit gleichsam die heiligen Männer die königliche Hauptstadt der Juden und ganz Judäa völlig geräumt hatten, da brach zuletzt das Strafgericht Gottes über die Juden wegen der vielen Freveltaten, die sie an Christus und seinen Aposteln begangen hatten, herein und vertilgte gänzlich dieses Geschlecht der Gottlosen aus der Menschengeschichte.«
Der übergreifende Zusammenhang ist die dogmatische Aussage, dass die Zerstörung Jerusalems eine Strafe Gottes gegen die vielen »Untaten« der ungläubigen Juden gegen Jesus und seine Apostel war.2 In sie flicht Euseb die auf Überlieferung zurückgehende Einzelnachricht3 ein, dass die Christen vor dem Krieg die Weissagung erhielten, Jerusalem zu verlassen und in Pella Wohnung zu nehmen. Damit ist eine klare Trennung erreicht zwischen den Guten, die bisher eine Katastrophe verhindert haben, und den »Bösewichtern«, die in der Stadt bleiben und jetzt, da die heiligen Männer Jerusalem und überhaupt ganz Judäa verlassen haben, bestraft werden können.
Doch erregt hier wie sonst in der Geschichte ein Bericht von einem derart eindeutigen Verlauf das Misstrauen. Folgende Fragen stellen sich:
1. Wie alt ist und von wem stammt die Überlieferung vom Auszug der Urgemeinde nach Pella? Antwort: Sie dürfte auf Aristo von Pella (= Anfang des 2. Jh.s) zurückgehen (vgl. Euseb, KG IV 6,3 f) und setzt voraus, dass die Gemeinde in Pella geblieben und nicht nach Jerusalem zurückgekehrt ist.
2. Gibt es auch konkurrierende Traditionen? Das ist zweifellos der Fall. Der aus Palästina gebürtige Judenchrist Hegesipp verfasste in der zweiten Hälfte des 2. Jh.s ein fünfbändiges Werk »Hypomnemata«. Von ihm sind umfangreiche Fragmente in Eusebs Kirchengeschichte erhalten, in denen Hegesipp klar erkennbar von einer Kontinuität der Jerusalemer Gemeinde ausgeht.
3. Ist es vorstellbar, dass die Gesamtheit der Jerusalemer Gemeinde noch so kurz vor dem Krieg hätte fliehen können? Kaum. Verfechter der Historizität der Pella-Nachricht sind daher auch gezwungen, den Auszug vorzudatieren, z. B. ins Jahr 62, unmittelbar nach der Ermordung des Jakobus.
4. Wenn Pella anerkanntermaßen eine heidnische Stadt war, ist es dann überhaupt denkbar, dass dort eine judenchristliche Gruppe Zuflucht erhalten hätte? Die Frage ist zu verneinen.
An anderer Stelle4 habe ich diese Fragen ausführlicher behandelt und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Tradition eines Auszugs der Urgemeinde von Jerusalem nach Pella unhistorisch und die Gründungslegende der Pellenser Kirche ist, die sich mit ihr von der Jerusalemer Gemeinde herleitete. Jetzt möchte ich die These insoweit ergänzen, dass unmittelbarer Anlass der Entstehung dieser Überlieferung die Erzählung einzelner Jerusalemer Judenchristen gewesen sein mag, die in der Tat kurz vor dem Krieg Jerusalem verlassen hatten, ebenso wie andere Juden auch (vgl. Josephus, Ant XX, 256/Bell II 279: Ende 64 n. Chr., mit dem Amtsantritt des Gessius Florus, haben Juden Jerusalem verlassen).5 Diese Christen hätten dann später in Pella einen bleibenden Wohnort gefunden.
Jedenfalls bedeutete die Zerstörung des Tempels einen tiefen Einschnitt für die damalige Jerusalemer Gemeinde (und ebenfalls für die »nichtchristlichen« Juden). Ihre Nachfahren lebten in der Zukunft zersplittert an verschiedenen Orten: in Pella, Kokabe, Nazareth und im syrischen Beröa. Ein Teil der Urgemeinde aus Jerusalem sowie Teile des palästinischen Christentums dürften nach Kleinasien übergesiedelt sein (vgl. nur die Töchter des Philippus [Apg 21,8 f], von deren Ephesus- bzw. Hierapolis-Aufenthalt spätere Schriftsteller berichten [Polykrates von Ephesus bei Euseb, KG III 31,3 und Papias von Hierapolis, ebd., III 39,9]). Und schließlich ist die Möglichkeit nicht völlig von der Hand zu weisen, dass judenchristliche Restgruppen Jerusalemer Herkunft nach einiger Zeit wieder in Jerusalem ansässig geworden sind.
Die Nachricht Eusebs (KG IV 5,2), bis zur Niederwerfung der Juden unter Hadrian seien in Jerusalem 15 Bischöfe einander gefolgt und alle von Geburt Hebräer gewesen, sollte man zugunsten der zuletzt angeführten Möglichkeit nicht ins Spiel bringen, denn diese Überlieferung ist aus zwei Gründen anzuzweifeln. Erstens hat angeblich der Nachfolger des Jakobus und zweite Bischof, Symeon, bis ca. 115 n. Chr. den Bischofsthron innegehabt.6 Dann aber ist es unwahrscheinlich, dass in der verbleibenden Zeit bis zum Aufstand unter Hadrian, d. h. in 20 Jahren, 13 Bischöfe regiert haben. Zweitens sagt Euseb im gleichen Atemzug, er habe »über die Jahre der Bischöfe in Jerusalem keine schriftliche Nachricht ausfindig machen können«. (KG IV 5,1). Das macht die ganze Bischofsliste nicht glaubwürdiger. Vermutlich stammt sie überhaupt vom heidenchristlichen Bischof Narzissus, Anfang des 3. Jh.s, oder von seinen Anhängern7, denn für die zweite Periode bis zu ihm führt Euseb in einem Schematismus8 gleichfalls 15 heidenchristliche Bischöfe auf (IV 5,1 – 4; V 12).
Die Leitungsfunktion der Verwandten Jesu. Das Schicksal der Judenchristen
Jakobus, der Herrenbruder, war die Autorität in der späteren Phase der Jerusalemer Gemeinde. Nach seiner Ermordung im Jahre 62 übte ein Vetter Jesu, Symeon, bis zur trajanischen Zeit (= 98 – 117) die Leitung des »Jerusalemer« Gemeindeverbandes aus. Allerdings wird nicht recht deutlich, ob sich sein Sitz in Jerusalem befand. Hegesipp setzt dies zwar voraus (bei Euseb, KG IV 22,4), weil er an der Kontinuität der Amtsinhaber auf dem Jerusalemer Bischofsstuhl interessiert ist9, doch ist das aus allgemeinen historischen Gründen unwahrscheinlich. Wir wissen nur, dass nach der Ermordung des Jakobus zu einem bestimmten Zeitpunkt Symeon sein Nachfolger wurde, und zwar, weil er mit Jesus verwandt war.