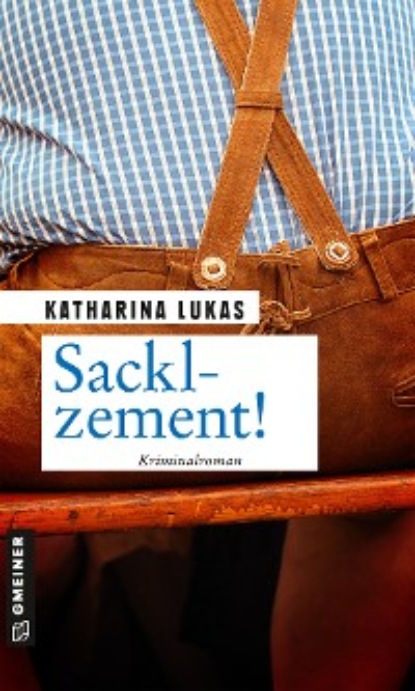- -
- 100%
- +
Fröhlich ist man bei so ernsten Angelegenheiten wie einer Gremess in Hintersbrunn oft, denn man lebt ja noch. Aber so lustig ist es selten. Ein lebensmüdes Haustier ist offenbar ein richtig guter Witz. Die Leute brüllen vor Lachen. Liesi springt auf, packt den verdatterten Franz am Arm und verfrachtet ihn auf eine Eckbank hinter der Garderobe, weg von den aufgeregten Leuten.
»Ich bin nicht blöd!«, ruft der beleidigt und schon ist Django zur Stelle und baut sich vor Liesi und Franz auf. Er sieht immer noch ziemlich gut aus, der Django, findet Gundi. Hat sich gut gehalten für sein Alter, muskulös, braun gebrannt und schlank. Nur statt seiner blonden Locken trägt er jetzt Vollglatze. Aus der Nähe bemerkt Gundi, dass der Kopf rasiert ist.
»Jetzt mal ganz langsam, Franze«, sagt Django mit hochgezogenen Brauen und dem Anschein, als ob er sich das Lachen nur mühsam verkneifen könne. »Der Hund vom Sackbauer hat sich also aufgehängt?« Er seufzt betroffen. »Hat er endlich ein Ende machen wollen, hm? Haben ihn vielleicht die Katzen in die Verzweiflung getrieben? Oder gibt’s einen anderen Grund? Hat er vielleicht sogar einen Abschiedsbrief hinterlassen?« Django genießt die Lacher der Dorfbewohner sichtlich. Ein paar klopfen ihm auf die Schulter.
»N… nein, es ist wahr«, wehrt sich Franz. »H… hinten im Scheideggerholz hängt er. Das ist k… kein Unfall gewesen!«
Django dreht sich zu seinem Publikum und breitet die Arme aus. »Dann brauchen wir die Mordkommission!«
Wieder gackern die Leute. Inzwischen hat sich eine Gruppe um Django gebildet, die mehr Sketcheinlagen auf Kosten des armen Franz erwartet. Ein paar andere stehen vor der Tür des Wirtshauses und telefonieren, und schließlich ist der Bräu der Erste, der sich wieder fasst.
»Jetzt wird erst mal gegessen«, sagt er und alle fügen sich.
Natürlich gibt es während des Schweinebratens nur ein Thema. Und vor der Nachspeise haben sich ein paar der Vereinsvertreter verabredet, die Sache in Augenschein zu nehmen. Zusammen mit Franz, der sich nach einem Knödel mit Soße wieder beruhigt hat, fahren sie zum Schauplatz des Geschehens. Als der ortsansässige Jäger wenig später mit seinem Anhänger auf dem Platz vor dem Wirtshaus hält, lassen alle ihren Nachtisch stehen. Auch Gundi und Liesi laufen hinaus und gaffen auf den großen weißen und mausetoten Hund auf der Ladefläche mit seiner gruselig langen blauen Zunge.
»Schau, wie es dem den Bläschel herausgetrieben hat!«, flüstert einer.
»Eindeutig. Der hat sich erhängt«, antwortet ein anderer. Man feixt wieder und raunt.
»Den Hund hat jemand abgemurkst, das ist euch schon klar, oder?«
»Aus Versehen ist der nicht verreckt …«
»Hat es eigentlich schon jemand dem Sackbauer gesagt?«
»Aus dem Weg!«, ruft schließlich eine tiefe Stimme, und wie auf Kommando treten die Dorfbewohner zurück und machen einem gut gekleideten älteren Herrn mit einem kunstvoll geschnitzten Spazierstock Platz. Der imposante Mann beugt sich langsam über den toten Hund und berührt zart dessen Kopf. Dann richtet er sich auf und sieht die plötzlich eingeschüchterten Dorfbewohner an wie das Gericht Gottes.
»Das war Mord«, verkündet er laut und keiner lacht mehr. »Das wird Konsequenzen haben! Wenn das eine Kampfansage sein soll …«
»Herr Professor Sackbauer«, unterbricht Bernleitner, weil er sich an sein Amt als Bürgermeister erinnert. »Das ist … Wir sind geschockt …«
Der Professor bringt ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. Er weist den Jäger an: »Zu mir heim.«
Das Auto mit dem toten Hund fährt los, der Herr Professor richtet einen letzten strafenden Blick auf die Gaffer und geht ebenso grußlos, wie er gekommen ist. Die Dorfbewohner sehen ihm schweigend nach, bis er mit seinem Stock klickend in die kleine Seitenstraße zu seinem Hof abbiegt. Anschließend trollen sie sich leise, einer nach dem anderen, und Gundi fällt auf, dass Liesi nicht mehr da ist. Drinnen in der Wirtsstube sitzen nur noch Django und ein paar Männer. Sie verstummen, als Gundi hereinkommt, um die Rechnung zu bezahlen.
»Du bist der größte Gauner von uns allen …«, sagt Alois Münchinger grinsend zu seinem Freund Django. Nach einer Halben Bier stehen sie zum Rauchen vor der Tür des Bräus, wo vor Kurzem der Sackbauer seinen gemeuchelten Hund gestreichelt hat.
»Warum?« Django nimmt die Zigarette, die ihm Alois anbietet, und lässt sich Feuer geben.
»Hast unserem sauberen Professor Sackbauer zeigt, wer was zu sagen hat im Dorf, stimmt’s?«, geiert Alois.
Django nimmt einen tiefen Zug und bläst den Rauch langsam aus. »Wieso ich?«
»Erhängt hat er sich, der Hund«, flüstert Alois und sieht Django verschwörerisch an. »Woher hast du das denn gewusst? Der Fürbitten-Franz jedenfalls hat nichts davon gesagt.«
»Ah so.« Jetzt grinst Django. Er nimmt einen letzten tiefen Zug, schnippt die Kippe in hohem Bogen auf die Straße und blickt ihr eine Zeit lang nach. »Das hat er jetzt davon«, stellt er fest. »Glaubt der feine Herr Kunstprofessor wirklich, dass wir uns das gefallen lassen? Dass der unser ganzes Dorf in den Dreck ziehen kann? Der schafft uns nichts an, das sag ich dir. Und jetzt weiß er das auch!«
Alois nickt.
Spätabends nach der Beerdigung mit Sketcheinlage sperrt Django die Tür zu seiner Villa neben dem elterlichen Hof auf. Ist eigentlich nicht schlecht gelaufen, der Tag heute mit der Überraschung beim Leichenschmaus, denkt er und lächelt zufrieden.
Als er ins Wohnzimmer kommt, im ersten Stock über seinem Büro, schallen ihm die schrillen Pfiffe von Tweety entgegen. Er hat ihn heute zu lange allein gelassen.
»Na, du Schlawiner?«, flötet Django und öffnet das Türchen zu dem großen Käfig, der zusammen mit einem belaubten Birkenast eine Ecke des riesigen Wohnzimmers einnimmt. Sofort hangelt sich der Nymphensittich an den Käfigwänden Richtung Ausstieg, klettert auf das Dach der Voliere und seine durchdringenden Laute gehen in ein angenehmeres Pfeifen über.
»Hast mich vermisst, du Lauser? Hast mich vermisst, was?«
Django beginnt zu pfeifen und zu schnalzen und lässt Tweety eine Weile an seinem Finger knabbern. Dann dreht er sich um und geht in die offene Küche. Kaum dass er sich eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank geholt hat, landet der Sittich auf seiner Schulter und Django lässt es geschehen wie einen Windstoß, den man nicht weiter bemerkt. Er greift nach einer Tupperdose mit Schnipseln von gelben Rüben. Der Bauunternehmer und sein Vogel sind seit sieben Jahren ein eingespieltes Team in ihrer feierabendlichen Wiedersehensroutine.
Auf dem Fernsehsessel legt Django die Füße hoch und sie beginnen ihr allabendliches Spiel, bei dem der Vogel auf der Hatz nach den Möhrenstückchen mit aufgestellter Federhaube auf Djangos Glatzkopf und Schultern herumklettert und flattert, während Django in Babysprache Versionen der Frage »Wo ist die böse Miezekatze?« säuselt. Schließlich hat Django genug und sein ausgestreckter Zeigefinger ist ein Befehl für den Vogel. Sofort klettert er darauf, und Django busselt seinen Gefährten drei-, viermal, bevor er ihm einen kleinen Schwung gibt. Tweety landet auf dem massiven Schrank im Kolonialstil und schwingt sich zurück zu dem aufgestellten Ast neben seinem Käfig, wo er üblicherweise den Abend verbringt, um von dort aus zusammen mit Django fernzusehen. Zumindest scheint Django das zu glauben, denn seine Selbstgespräche zum laufenden Programm richten sich an Tweety. Und der antwortet jedes Mal mit einem leisen Pfeifen.
Heute Abend kann sich Django nicht so recht auf das Fernsehprogramm konzentrieren. Der Sackbauer wird den Schwanz nicht gleich einziehen, denkt er. Der gibt jetzt erst recht nicht auf. Da muss er härtere Geschütze auffahren. Er weiß aber noch nicht, welche, und das wurmt Django. Schlecht gelaunt steht er auf, dirigiert seinen Vogel zurück in den Käfig und schnalzt eine Minute lang hinein, ehe er ihn mit einem Tuch bedeckt und den Fernseher ausschaltet. »The Dark Knight Rises« hat er sowieso schon tausendmal gesehen. Er holt sich noch ein Bier und grübelt eine Weile vor der Kühlschranktür. Mal schauen, was der Alte macht, denkt er schließlich und steigt die Treppe hinunter ins Freie auf den hell beleuchteten Vorplatz seiner Villa. Er will hinüber in das alte Bauernhaus.
Hier, auf diesem Hof, ein wenig außerhalb von Hintersbrunn, ist Django aufgewachsen als Sohn des Landwirts und langjährigen Bürgermeisters Lorenz Schickaneder. Und als Enkel einer Legende. Djangos Großvater war der erste demokratisch gewählte Bürgermeister nach dem Krieg. Politisch unbelastet. Der hoch angesehene Ignaz Schickaneder war von 1946 bis zu seinem Tod 1977 mehr Volksheld denn Volksvertreter und ihm verdankt Hintersbrunn fast jede Art von Modernisierung. Nach seinem Tod war es keine Frage, dass ihm sein Jüngster, Djangos Vater, der einzig überlebende Sohn der Bauerndynastie, ins Amt nachfolgte. Es wurde gar kein anderer Kandidat aufgestellt damals, 1978. Für Django lief es nicht so glatt, das hat er früh erfahren müssen. Er war 11, als sein Vater ins Amt kam, zu saufen begann, nach und nach den Grund des Hofes verscherbelte und anfing, seinen Sohn regelmäßig zu verprügeln, während die kränkliche Mutter bis zu ihrem frühen Tod unbeirrt wegsah. Django wehrte sich auf seine Weise, so sieht er das heute, und seine Rebellion endete mit Trunkenheit am Steuer, Beleidigung und Körperverletzung. Weil er seine Strafe nicht bezahlen konnte und sein Vater ihn hängen ließ, landete er für ein paar Monate im Gefängnis. Ein kurzes Eheglück scheiterte, seine Ex verwehrte ihm den Kontakt zur Tochter und zog ans andere Ende der Republik. Als er wegen seines »Widerspruchsgeistes«, wie er heute sagt, seinen Arbeitsplatz als Maurergeselle verlor, hatte er eine Vision: Er wollte in die Fußstapfen seines Großvaters treten und aus dem dahinsiechenden Dorf, dem in den 1990er-Jahren die Einwohner davonliefen, ein attraktives Wohngebiet machen für all die vielen Menschen, die am neu gebauten Franz-Josef-Strauß-Flughafen arbeiten sollten. Mit ein paar ersparten Groschen gründete er seine eigene Baufirma. Es war ein steiniger Weg, geschenkt hat ihm keiner etwas, das sagt sich Django immer wieder, und an die Leiche im Keller dieser arbeitsamen Jahre denkt er fast gar nicht mehr. Zum Bürgermeister wurde Django zwar nicht gewählt, als sein Vater 2003 in Pension ging. Das war aber gar nicht nötig, er zog längst anderweitig die Fäden und hatte beste Beziehungen zur lokalen Politik. Die Bauvorhaben der Gemeinde und bald auch diejenigen der Nachbargemeinden gingen alle an ihn und so ist es bis heute.
Stolz blickt er auf seine Villa und überschlägt kurz, wie viele Baustellen im Landkreis er gerade managt. Über die ehemalige Stallschleuse links von der eigentlichen Eingangstür betritt Django das alte Bauernhaus, in dem sein 80-jähriger Vater allein in der Stube lebt. Wie jeden Abend sitzt der inzwischen geschrumpfte Greis im Schlafanzug am Küchentisch und brabbelt laut vor sich hin. Der abendliche Pfleger hat das Geschirr vom Abendessen in der Spüle stehen lassen und den alten Mann bettfertig gemacht, bevor er zum nächsten Patienten seiner Runde weitergefahren ist.
»Was machst du denn noch auf, du Blödhammel?«, fragt Django, doch der Vater hört ihn anscheinend nicht. Django ergreift eine Zeitung, die auf dem Bänkchen vor dem Kachelofen in der Ecke liegt, rollt sie zusammen und haut sie dem Alten über den Hinterkopf.
»Ahhh! Au!«, schreit der und zieht den Kopf ein, ohne sich nach dem Angreifer umzusehen.
»Weißt wieder nicht, was dir geschieht, hm?« Für einen kurzen Moment wird Django noch aggressiver. Am liebsten würde er dem unnützen Fresser ganz den Garaus machen. Dann aber wirft er die Zeitung auf den Tisch und dreht sich um. Als er die Stubentür abschließt, sieht er, wie der Alte neugierig danach greift.
»Vollkommen vertrottelt«, murmelt Django.
Erste Alzheimersymptome gab es früh, aber es hätte auch vom jahrelangen Alkoholmissbrauch kommen können, dass der alte Bürgermeister schon bald nach seiner Pensionierung Namen vergaß und im Wirtshaus nicht mehr wusste, was er gezecht hatte. Eines Morgens saß er mitten im Dorf auf dem Gehsteig, fand nicht mehr heim und wäre in der Nacht beinahe erfroren. Nie wird Django den vorwurfsvollen Blick der Kramer Res vergessen, dieser vertrockneten Moralamsel, die den Alten nach Hause brachte. Seitdem lässt Django seinen Vater nicht mehr raus. Seinen Aktionsradius hat er auf die Stube reduziert, wo neben Tisch und Bett der für seinen Vater unzugängliche Kachelofen den Raum dominiert. Die Wege dazwischen hat Django mit fixen Holzgeländern eingezäunt wie beim Check-in am Flughafen. Da marschiert der Alte den ganzen Tag seine Runden. Inzwischen ist der ehemalige Bürgermeister fortgeschritten dement, schreit manchmal den ganzen Tag unverständliches Zeug, flucht, will heim oder ins Rathaus, hat Körperhygiene vollkommen vergessen, kann nicht alleine essen und seine Ausscheidungen nicht mehr kontrollieren. Dreimal täglich kommen Mitarbeiter eines ambulanten Pflegedienstes, und im Dorf sagt Django: »Mein Vater bekommt alles, was er braucht.«
Am Tag nach der Beerdigung des alten Bäckermeisters ist der »Hundemord« das einzige Gesprächsthema in Hintersbrunn. Tatsache ist, dass der edle, große Hund des ortsansässigen Professors Sackbauer im Wald aufgeknüpft worden ist. Tatsache ist, dass es kein Unfall gewesen sein kann, sondern dass jemand den Hund am Hals hochgezogen hat und qualvoll verenden ließ. Tatsache ist, dass der Tod durch Erhängen eintrat und dass die gerufene Polizei eine Anzeige aufgenommen hat. Gegen unbekannt. Irgendwer erzählt, dass der Professor in einem Wutanfall gedroht hat, das ganze »Faschisten-Dorf« in Grund und Boden zu verklagen. Und Tatsache ist, dass sich die Täterschaft Djangos zwar im Dorf herumspricht, kein Wort davon aber zum Professor dringt.
3
»Liesi? Kennst du mich noch?« Gundi steht vor der Theke des kleinen Dorfladens, hinter der die schlanke Frau gerade einen Geschenkkorb mit bunten Bändern verziert. Gestern haben sie bei all dem Durcheinander auf der Beerdigung kein Wort miteinander gesprochen, und Gundi ist sich nicht sicher, ob Liesi sich an die gemeinsam verbrachte Kindheit erinnert. Jetzt braucht sie ein paar Lebensmittel und hofft, etwas Kalorienreduziertes zu finden. Vor allem aber will sie jemanden finden, der ihr das alte Elternhaus abkauft. Und weil ein Dorfladen Marktplatz für alles Mögliche ist, hält Gundi einen Zettel in der Hand, auf dem sie ihre Handynummer notiert hat, zusammen mit den Worten: »Bäckerhaus. Haus und Grund. Unrenoviert zu verkaufen. 80.000 Euro.«
Liesi schaut auf und sofort springt ein Lächeln auf ihr Gesicht, was sie noch verknitterter aussehen lässt. Es ist ein schönes Gesicht, bemerkt Gundi, gebräunt und voller Sommersprossen, und jede Einzelne ihrer zahlreichen Falten ist definitiv eine Lachfalte.
»Gundi? Mein Gott, ist das lang her!«, ruft die Angesprochene und beeilt sich, hinter der Ladentheke hervorzukommen. Gundi zuckt zurück in der Angst, Liesi könne ihr um den Hals fallen, aber Liesi packt sie nur an beiden Händen, lehnt sich nach hinten und begutachtet Gundi mit ihren wachen grauen Augen.
»Bist auch nicht jünger geworden«, sagt sie und lacht ein wenig verlegen. Gundi geht es nicht anders. Es ist ein halbes Leben her, seit sie sich zuletzt gesehen haben, und obwohl sie eine Zeit lang beste Freundinnen gewesen waren, ist ihr Kontakt nach Gundis Weggang abgebrochen. Hatte wohl damit zu tun, dass sie damals 18 waren und das Leben im Wochentakt so viel Zukunft brachte, dass man für die Vergangenheit keine Zeit hatte.
Im Grunde sind Gundi und Liesi als Kinder nur Weggefährten gewesen, denn ihre Eltern hatten jeweils ein Ladengeschäft an der Dorfstraße. Das zweistöckige, von Gundis Großvater erbaute und in den 1960er-Jahren vom Vater herrschaftlich ausgebaute Bäckerhaus thronte groß und mächtig auf der einen Seite, der Lebensmittelladen von Liesis Eltern, der ungefähr zur selben Zeit zweckbaulich an das alte Waldlerhaus angedockt worden war, stand dagegen eher mickrig auf der anderen. Heute sieht die Sache anders aus. Die Bäckerei hat Gundis Vater vor Jahren aufgegeben, als er, statt zu backen und zu schimpfen, lieber nur noch schimpfte. Er ließ das Haus mitsamt Backstube verfallen. Der ehemals schäbige Kramerladen gegenüber wirkt heute wie aus dem Touristenprospekt »Schönes Bayernland«. Er fügt sich mit rustikaler Kartoffel- und Gemüseauslage vorm Haus und einem Schaufenster mit geräucherten Schinken und Gläsern voller selbst gemachter Marmelade wunderschön ein in das renovierte Waldlerhaus mit seiner dunkelbraunen Holzfassade und seinen grünen Fensterläden. Liesi hat nicht nur den Laden ihrer Mutter übernommen, sondern auch das alte Waldlerhaus restauriert, das sie im Laufe der Zeit mit sage und schreibe drei Männern bewohnt hat.
»Natürlich nacheinander«, lacht sie und spult auf kurze Nachfrage hin ihr Leben vor Gundi ab, als hätte sie all die Jahre darauf gewartet. Zum ersten Mal heiratete Liesi mit knapp 20 Jahren, schwanger von einem Burschen aus dem Dorf, mit dem auch die Gundi geschmust hatte. Mit 24 heiratete sie einen Kerl aus dem Nachbarort, den sie beim Tanzen kennengelernt hatte, damals, als sie ihr Kind noch bei der Mama abgeben konnte, um an den Wochenenden in den Landdiscos ihre Jugend nachzuholen. Diese Ehe hielt immerhin sechs Jahre. Dann hatte er eine andere und sie weitere zwei Kinder. Ihren letzten Mann hat sie einige Zeit später über das Internet gefunden und vor drei Jahren rausgeschmissen, weil er »nichts getaugt hat«.
»Gott sei Dank auch nicht für ein weiteres Kind«, ergänzt sie.
Wie unterschiedlich die Leben verlaufen, denkt Gundi, während sie in dem Laden steht und sich, nur ein paarmal unterbrochen von der Ladenglocke, Liesis Lebensgeschichte anhört. Als Kinder mussten sie beide mithelfen in den Läden ihrer Eltern. Liesis Eltern sind jung gewesen und freundlich. Liesi hatte Geschwister und im Haus der Kramersleute war ständig was los. Alle waren im Laden, alle hatten Aufgaben, und anders als bei Gundi zu Hause durfte jeder alles sagen, im Großen und Ganzen das tun, was er gerne machte, und es herrschte immer ein lautes und lustiges Durcheinander. Vor allen Dingen anders war, dass hier keiner schimpfte, keiner zuschlug und dass es bei den Kramers überhaupt kein Thema war, dass Gundi eventuell zu fett sei oder faul oder irgendwie lästig. Gundi erträumte sich eine Familie wie die Kramers und verbrachte viele Nachmittage bei ihnen. Liesi musste sich nie wegträumen und nie flüchten, denkt Gundi. Weder aus ihrer Familie noch aus ihrer zugedachten Rolle und auch nicht aus ihrer Heimat. Und während Liesi weitererzählt, dass ihre Eltern inzwischen verstorben und ihre Kinder erwachsen seien, spürt Gundi eine lang vergessene Bitterkeit in ihrer Brust und fragt sich heimlich, ob sie ihre ehemalige Freundin vielleicht beneidet. Am Ende schüttelt sie unmerklich den Kopf und kommt zur Sache.
»Weißt du jemanden, der mir das Haus von meinem Vater abkaufen würde?«
Liesi zuckt mit den Schultern. »Was willst du denn haben dafür?«
Gundi zeigt ihr den Zettel. »Darf ich den aushängen bei dir?«
Liesi zögert. »Ich würde das nicht machen«, sagt sie nach einem Augenblick. »Warum richtest du es nicht her und vermietest es? Wenn da ein Bäcker einziehen würde, bräuchte ich meine Semmeln nicht aus …«
»Wer soll denn in diesem Kaff etwas mieten wollen?«, bricht es aus Gundi heraus und sie bemerkt sofort die Beleidigung, die darin liegt. »Ich meine, das Haus ist ja voller Gerümpel, da kann überhaupt niemand einziehen.«
Glücklicherweise geht Liesi über den Fettspritzer hinweg. »Das mein ich ja«, sagt sie. »Räum es aus, streich es an, richte die Backstuben her, dann kannst du es gut vermieten oder meinetwegen verkaufen. Der Franz wird dir dabei helfen.«
»Welcher Franz?«
»Geh, den kennst doch. Der Fürbitten-Franz. Der gestern den aufgehängten Hund gefunden hat. Der trinkt jeden Tag in der Früh seine Halbe bei mir. Genau wie damals bei meiner Mutter. Ist jetzt so was wie der Dorfhausmeister. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne den machen würde. Er lebt immer noch im alten Schulhaus. Schau doch einmal vorbei bei ihm, der hat noch lange nach dir gefragt, nachdem du abgehauen bist.«
4
Sommer 1984
Bei der Kramer Res lieferte sie jeden Morgen 20 Brezen und 30 Semmeln ab. Die machte daraus Pausenbrote für die Schulkinder, deren Eltern bereits mit dem Frühbus in die entfernt liegende Fabrik gefahren waren. Die Bäckerstochter war es von klein auf gewohnt mitzuarbeiten, hatte Brote in die Regale geschichtet, die Backstube gekehrt und einen Tritt von ihrem Vater erhalten, bevor sie um 7.15 Uhr selbst in den Bus stieg, der sie in die Schule brachte. Als sie kleiner gewesen war, hatte sie es einfacher gehabt, weil die Grundschule direkt hinter dem Kramerladen lag. Jetzt ging sie in die fünfte Klasse und da musste sie ins 17 Kilometer entfernte Oberbach zur Schule fahren. Vor der Ladentür der Kramer Res wartete der Fürbitten-Franz, die Halbe Bier in der Hand. Er grinste sie erwartungsvoll und ein bisschen blöd an. Weil Gundi manchmal lustige Sachen erzählte und Franz den ganzen Tag darüber lachen konnte. Gundi mochte Franz und zwinkerte ihm von Weitem verschwörerisch zu.
»Weißt du, warum ein Pfurz stinkt?«, fragte sie ihn.
»Naaaa!«, rief Franz, schüttelte den Kopf und kicherte, weil er wusste, dass es lustig werden würde.
Gundi legte eine Hand an den Mund, als ob sie ein Geheimnis verraten würde: »Damit Taube auch was davon haben.«
Der Fürbitten-Franz brach fast zusammen vor Lachen. Trotz ihres Altersunterschieds hatten die beiden etwas gemeinsam. Sie gehörten zu den Kindern, die auf der Dorfstraße groß wurden, weil es daheim nicht stimmte. Die nicht so recht dazugehörten, weil sie ein wenig anders waren. Die niemand vor der Ausgrenzung durch andere Kinder beschützte. Franz war zwar schon über 20, im Kopf passte er dennoch perfekt zur 12-jährigen Gundi, und so waren die beiden in diesem Sommer ein bisschen eigenartige, aber verschworen gute Freunde.
Wie der Fürbitten-Franz zu seinem eigenartigen Beinamen gekommen war, hing damit zusammen, dass er länger Ministrant war als jeder andere Bub aus dem Dorf. In Hintersbrunn waren es zwölf Buben, die dem Pfarrer bei der Messe zur Hand gingen. Bei jedem Hochamt mussten es vier sein, gekleidet in rote Röcke, die fast bis zu den Füßen reichten, und einen weißen Überrock mit Spitzen. Jeden Sonntag waren sie vor dem Pfarrer in der Sakristei, legten seine Gewänder zurecht, öffneten eine neue Flasche Messwein und zündeten die Kerzen an. Im Winter machten sie zuallererst Feuer im Kohleofen in der Ecke. Den volkstümlichen Scherz, dass alle Ministranten heimlich vom Messwein nippten, kannten die Hintersbrunner Buben, aber keiner hatte sich das jemals getraut. Denn der Herr Pfarrer Dörner, seit 30 Jahren Dorfpfarrer, war sehr streng. Einmal hatte er einen Ministranten sogar während der Messe geohrfeigt, weil der nicht an der richtigen Stelle das Richtige getan hatte. Darüber hatte es zwar große Empörung im Dorf gegeben, doch gesagt hatte keiner etwas und die Eltern des Buben schämten sich trotzdem. Ein andermal wurde ein Ministrant aus dem Kirchendienst ausgeschlossen, weil er schmutzige Fingernägel hatte. Da hatte auch das Betteln der bestürzten Mutter des Buben nicht geholfen. Nicht jeder konnte Ministrant werden. Nur ein Bub, dessen Eltern fleißige Kirchgänger waren und der in der Schule gut war, durfte dazugehören. Außerdem durfte er nicht durch böse Streiche auffallen.
Auf Franz traf nur die letzte Bedingung zu. So streng der alte Pfarrer auch war, den kleinen Halbwaisen in den Dienst der Kirche aufzunehmen, hielt er für seine Christenpflicht. Und Franz war ein fleißiger Ministrant. Es sei die schönste Zeit seines Lebens gewesen, sagte er später einmal, und der Pfarrer behielt ihn ungewöhnlich lange. Franz blieb Ministrant, bis er 18 Jahre alt war. Er bemerkte nie, dass er eigentlich eine lächerliche Figur abgab, mit dem viel zu kleinen Messgewand unter all den kindlichen Messdienern. Die waren froh um Franz, denn er gab immer kleine Zeichen, wenn einer seiner Mitministranten einmal nicht weiterwusste. Und außerdem hatte er die ehrenvolle Aufgabe, jeden Sonntag die Fürbitten vorzulesen. Die schrieb ihm der Pfarrer in ein Schulheft und Franz verbrachte den ganzen Samstag damit, sie auswendig zu lernen. Sie gingen ihm immer sehr zu Herzen. Für ihn waren es die Bitten der Dorfbewohner an den lieben Herrgott. Dass er das schöne Wetter zur Erntezeit erhalten möge, dass er dem in der vergangenen Woche verstorbenen Schmidbauer Karl die ewige Ruhe schenken möge oder dass der liebe Gott das Kirchendach ein weiteres Jahr erhalten möge. Franz trug die Fürbitten mit tiefer Inbrunst vor, manchmal liefen ihm Tränen herunter. Eine ganze Weile lang hieß es, dass Franz einmal Mesner werden solle, ein Ehrenamt für einen verdienten Mann aus dem Dorf, der die Glocken läutete, den Klingelbeutel durchgehen ließ, die Orgel wartete. Der Mesner damals war schon alt, als der Fürbitten-Franz Ministrant war. Aber die Zeit verging und er starb nicht. Nachdem Franz zum letzten Mal seine rote Kutte abgelegt hatte, nach der Ostermesse kurz vor seinem 18. Geburtstag, lebte der alte Kirchendiener noch sieben Jahre. Und so blieb dem Fürbitten-Franz nur das Lagerhaus. Dort wurde er als Hilfskraft angestellt. In die Kirche ging er nicht mehr.