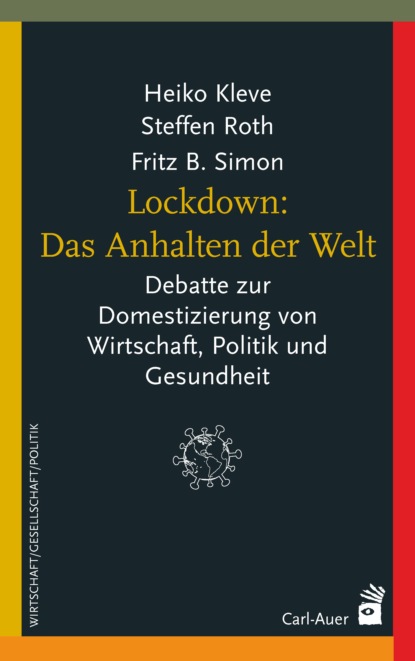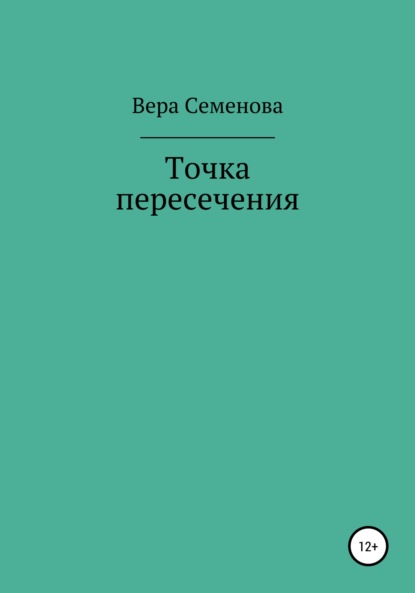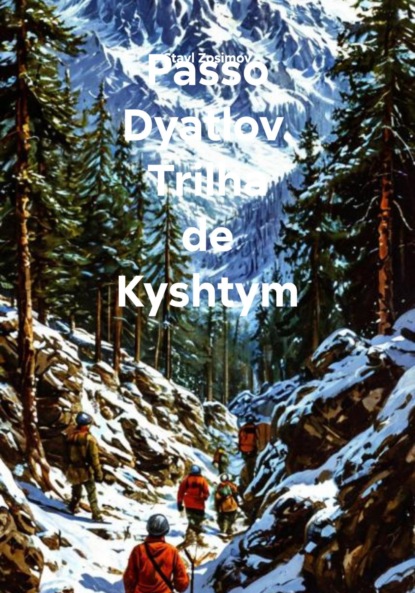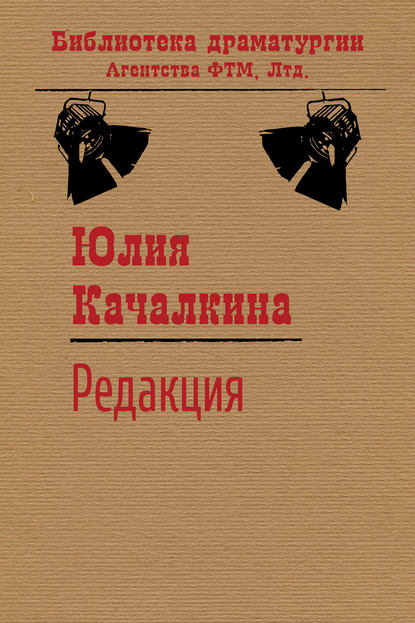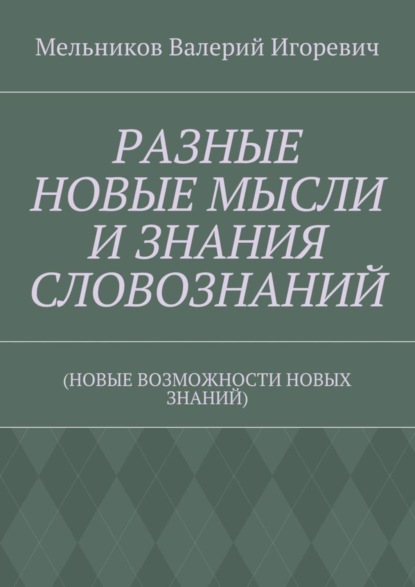Eine kurze Geschichte des systemischen Denkens

- -
- 100%
- +
Aber was ist aus Sokrates letztendlich geworden? Die Athener haben ihn schließlich für schuldig erklärt, dass er tatsächlich die Jugend verdorben habe. Vor die Wahl gestellt, im Alter von rund 70 Jahren Athen zu verlassen und ins Exil zu gehen oder einen Schierlingsbecher zu leeren und damit sich selbst zu töten, wählte er das Letztere. Seine Philosophie hat jedoch bis heute überdauert. Mit ihm bleibt die Erkenntnis, dass es durchaus lebensgefährlich werden kann, frei zu denken und zu sprechen. Aufgrund der großen Bedeutung von Sokrates in unserer Geistesgeschichte darf er zudem den ersten Platz in unserer kleinen Ahnengalerie einnehmen – wobei sein großes Standbild umringt gedacht sein darf von den Standbildern von Xenophanes, Heraklit und Protagoras sowie Siddharta Gautama und Laozi.
Der Philosoph Platon selbst ist zwar einerseits unsere wichtigste Quelle, was das sokratische Denken anbelangt, andererseits steht er auch stellvertretend dafür, dass einige der hier referierten Autoren durchaus durch eine ganz anders geartete – antisystemische – Brille betrachtet werden können. Platon macht es uns hierbei besonders einfach, denn sein Denken in seinen früheren Schriften (vermutlich noch recht nahe an Sokrates orientiert) unterscheidet sich in doch recht hohem Maße von seinem späteren (im Bemühen um eine Staatsphilosophie).
Platon, der zweifellos berühmteste Schüler von Sokrates, entstammte einer eher wohlhabenden Familie. Er gründete zudem die erste Philosophenschule Griechenlands (oder gar weltweit?), die Akademie, und versuchte, wenn auch erfolglos, den tyrannischen Herrscher von Sizilien, Dionysios, zu einer umfassenden Staatsreform zu bewegen.
Insbesondere in seiner Schrift über den Staat offenbart Platon ein Wahrheitskonstrukt, das den klassischen sokratischen Vorstellungen komplett widerspricht. Suchte Sokrates noch nach dem Guten, Schönen und Wahren, so interessiert sich Platon hier vielmehr primär für den wohlgeordneten Staat. Und für die anderen Aspekte gilt es nun, sich diesem neuen höheren Prinzip unterzuordnen. Eigentlich möchte man meinen: willkommen in der Moderne!
Aus heutiger Perspektive entwickelt Platon jedenfalls Vorstellungen von einem idealen Staat, die für uns eher als von totalitärer Natur erscheinen. So stellt sich Platon zunächst einmal einen Staat vor, der streng hierarchisch zu gliedern sei. Unten stehen die Stände der Erwerbstätigen, darüber die der Wächter und wiederum darüber die der Herrscher. Zur Legitimation dieses Konstrukts bedient sich Platon der Lüge und stilisiert sie zur »edlen Täuschung«19: Dem Volk sollen irgendwelche Mythen erzählt werden, welche ihren jeweiligen Stand als notwendig etikettieren, damit sie sich in ihr Schicksal fügen. Platon stellt sich dabei beispielsweise vor, dazu müsse die Fortpflanzung reguliert werden, und zwar so, dass
»die besten Männer den besten Frauen möglichst oft beiwohnen müssen, dagegen die schlechtesten Männer den schlechtesten Frauen möglichst selten«20.
Doch wie soll das gehen? Platon schlägt vor, dass dies durch »geschickte Verlosungen« geschehen solle, d. h., die Herrscher (wer auch sonst!) bestimmen aus eugenischen Gründen, wer mit wem zusammenkommt, und manipulieren die Verlosung.
Damit verbiegt sich ein erstes Mal in der Philosophiegeschichte ein klassisch konstruktivistisches Argument: Aus der Erkenntnis, dass Wahrheit eine bloße Annahme sei (Xenophanes) bzw. relativ zum Beobachter (Protagoras) oder dass sogar eine grundsätzliche Haltung des reflexiven Nichtwissens (Sokrates) einzunehmen wäre, reklamiert Platon hier schlichtweg eine höhere Wahrheit für sich, der sich alle anderen unterzuordnen hätten. Dafür genügt ihm das vage Versprechen eines »idealen« Staats. Ideal für wen? Für die vielen, die als »schlecht« wahrgenommen werden? Es lohnt sich somit durchaus – siehe nochmals Heinz von Foerster –, sich in kritischer Hinsicht zu Wahrheitsanmaßungen zu verhalten.
Schlussendlich: Ist Ihnen schon einmal etwas aufgefallen? Nämlich: Warum wird Wahrheit gemeinhin für den eigenen Standpunkt beansprucht und nicht etwa für den eines anderen? Komisch eigentlich, oder? Ich hätte ja wenig Probleme, andere als stärker, geschickter oder klüger zu bezeichnen. Aber näher an der Wahrheit dran? Manche von uns tun dies, aber nur, weil sie ihr Gewissen und ihr Denken in die Hände eines Führers oder Gurus oder irgendeiner Gottesvorstellung legen wollen.
So verdanken wir Platon zwar, dass wir Sokrates einen prominenten Platz in unserer systemischen Ahnengalerie zusichern konnten – er selbst wird wohl eher draußen bleiben dürfen.
Die Summe der Teile (Aristoteles)
Die antike Philosophengeschichte lässt sich aus unserer heutigen Perspektive auch als eine Abfolge von Lehrer-Schüler-Beziehungen lesen. In Platons Dialogen zählt Sokrates gleich eine ganze Reihe von Lehrerinnen und Lehrern auf, die ihn beeinflusst haben: Mit Aspasia und Diotima befinden sich in der damaligen feudalistischen und eigentlich noch prä-demokratischen Zeit sogar zwei Frauen darunter, der Bezug zu Xenophanes und Protagoras wurde bereits erwähnt. Platon wiederum steht in direkter »Schülerschaft« zu Sokrates, allerdings nicht als Einziger. Bis heute (wenn auch eher als Karikatur) bekannt ist beispielsweise Diogenes von Sinope (»Das ist der mit der Tonne«), Begründer der damals einflussreichen Schule der Kyniker.
Unter Platons Schülern wiederum sticht insbesondere Aristoteles (384–322 v. Chr.) hervor. Ihn als bloßen Platonschüler zu etikettieren würde allerdings deutlich zu kurz greifen, begründete Aristoteles doch mit seiner Unterscheidung theoretischen, praktischen und poetischen Wissens letztendlich das moderne Bild der Wissenschaften. Zudem ist ihm, wenn auch in etwas verklausulierter Form, eine wesentliche Erkenntnis zur Idee des Systems selbst zu verdanken.
Aristoteles erkundete im Zusammenhang mit Fragen der Metaphysik Fragen des Wesens: Was ist das Wesen eines Hauses, was das Wesen eines Menschen? Dieses Wesen wurde von ihm als eine ganz besondere Form der Ursache angesehen, also etwa, was einen Menschen zum Menschen macht. Hierzu aber brauchte es eine ganz andere Art und Weise der Erforschung, denn:
»Dasjenige, was so zusammengesetzt ist, dass das Ganze eines ist, nicht wie ein Haufen, sondern wie die Silbe, ist nicht nur seine Elemente.«21
Somit, im Kurzen: Das Ganze ist nicht die bloße Summe seiner Teile, sondern etwas anderes. So wie etwa die Silbe »eins« zwar aus vier Buchstaben besteht, aber inhaltlich rein gar nichts mit dieser »Vierheit« zu tun hat. Die von Aristototeles hier vermittelte Erkenntnis ist in der Folge häufig zu einem »Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile« kondensiert worden. Doch ebendieses »mehr« beinhaltet eine gewisse Unschärfe. Kommt da einfach noch etwas mit dazu? Es wäre sicherlich besser, stattdessen darauf hinzuweisen, dass das Ganze »etwas anderes« ist als die Summe seiner Teile (Metzger 1975, S. 6).22 In dieser Weise entkommt man zudem einem dümmlichen Reduktionismus, der aus dem »mehr« allenfalls wieder seine besondere Elemente zu extrahieren sucht.
Dieses von Aristoteles bereits erkannte Phänomen wird über 2000 Jahre später unter anderem als »Emergenz« bezeichnet – und es wird in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Disziplinen als eine wesentliche Eigenschaft komplexer Phänomene erkannt werden. Aristoteles selbst ist im Übrigen sogar jenseits der Philosophie zu Bekanntheit gelangt; war er doch Lehrer des größten Erobereres, den die altgriechische Welt hervorgebracht hat: von Alexander dem Großen.
Und die Frauen?
Bei aller Begeisterung für die vielfältigen Anfänge des philosophischen Denkens im antiken Griechenland kann eines nicht verschwiegen werden. Die viel gerühmte attische Demokratie war nämlich von unserem modernen Demokratieverständnis noch ein ganz schönes Stück weit weg. Athen war, ebenso wie die anderen Stadtstaaten der damaligen Zeit, eine Sklavenhaltergesellschaft, und die Anzahl der Sklaven hat die Anzahl der freien Bürger vermutlich deutlich überschritten. Den Frauen ging es damals nicht viel besser – sie standen offenbar lebenslang unter der Vormundschaft ihres Mannes bzw. ihres Vaters oder ihrer Brüder. Die attische »Demokratie« umfasste somit bloß eine Minderheit und ihre Interessen. Aber immerhin: Ein wichtiger Anfang wurde gemacht.23
Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen gibt es eine Reihe von Philosophinnen, die zumindest dem Namen nach überliefert sind, obzwar kaum etwas von ihrem Denken bekannt ist. Eine dieser Spuren führt direkt wiederum zu Sokrates zurück, denn es war eine Frau – Aspasia von Milet –, die ihn offenbar in Sachen »Rhetorik« unterrichtet hat. Doch offenbar war dies bereits eine Provokation für die damalige Gesellschaft: eine zwar nahezu rechtlose, aber dennoch gebildete Frau. Aspasia habe »nicht gerade ein ehrbares, anständiges Gewerbe«24 betrieben, sondern sie habe ein Bordell geführt, wurde behauptet. Was sie hingegen gedacht oder gar geschrieben hat, das ist nicht überliefert.
Wenigstens mag man an der Tatsache einer derartigen Schmähung erkennen, dass Philosophinnen wie Aspasia nicht ganz unwichtig gewesen sein können. Ähnliches widerfuhr im Übrigen der Frau von Sokrates: Xanthippe wurde von dem Sokratesschüler Xenophon zum Urbild der zänkischen Ehefrau gemacht – ein Name, der bis heute in dieser Weise nachhallt.
Die griechische Antike setzt damit leider trotz aller ihrer Errungenschaften ein äußerst unrühmliches Vorbild für das Verhältnis von Mann und Frau. Das frühe Christentum verstärkt unglücklicherweise noch diese Tendenzen. Erst mit der allmählichen Auflösung der feudal orientierten Gesellschaftsstrukturen ab dem 18. und stärker noch dem 19. Jahrhundert verändern sich die Chancen für weibliche Bildung und soziale Partizipation auf breiter Ebene.
Damit schließt dieser Ausflug in die Antike. Gezeigt wurde, dass bei allen Zwiespältigkeiten in jener Epoche erste handfeste Einsichten in die systemische und konstruktivistische Struktur unserer Wahrnehmungswelt entwickelt wurden. Einen besonderen Stellenwert nahmen hierbei Diskurse über den Begriff der Wahrheit sowie eine Reihe vorsystemischer, eher noch relationaler Gedanken ein.
Ein etwas längerer Gang durch die Antike hätte sicherlich neben Griechenland noch Rom gestreift – sowie darüber hinaus Ägypten und Persien und überhaupt den außereuropäischen Raum. Weitere wichtige europäische Denker kamen zudem gar nicht erst vor; ebenso wurde auf die Darstellung all der Gegenpositionen verzichtet, die natürlich schon damals vorhanden waren. Nur bei Platon wurde kurz ein Fenster geöffnet – zur Demonstration dessen, welche Kippbewegungen dem philosophischen Diskurs innewohnen können.
*Es gibt, auch im Deutschen, mehrere Schreibweisen des Namens (»Laotse«, »Lao-Tse« …). Mittlerweile etabliert hat sich jedoch die Schreibweise »Laozi«.
3Intermezzo im Mittelalter
Wir machen einen Sprung von über 1000 Jahren. Das Mittelalter erscheint uns heute zuweilen als die sagenumwobene Zeit der Rittersleute und des Minnesangs, der Völkerwanderung und einer allgemeinen Phase des Niedergangs nach dem Untergang Roms. Das Mittelalter, also jener Zeitraum, der zwischen Antike und Neuzeit liegt, umfasst seinerseits ebenfalls nochmals rund 1000 Jahre, in etwa die Spanne vom 6. bis zum 15. Jahrhundert. Das ausgehende Mittelalter war die Zeit, in der weit in den Himmel emporragende Kathedralen errichtet wurden und in welcher die Kirche und insbesondere die Klöster eine zentrale Rolle für Bildung und Erziehung spielten.
Stellvertretend für diese Zeit werde ich jedoch nicht von den Ideen und Überlegungen von Thomas von Aquin, Roger Bacon, Wilhelm von Ockham oder Meister Eckhard berichten. Sie kamen zudem allesamt erst später und folgten daher zumindest in zeitlicher Hinsicht einer bis heute hin berühmten Frau, die wir für gewöhnlich allerdings leider eher im Kräutergarten verorten als in der Philosophie: Hildegard von Bingen.
Die Welt und der Mensch (Hildegard von Bingen)
Hildegard von Bingens langes Leben umspannte fast das ganze 12. Jahrhundert (1098–1179). Ihr Geburtsort ist nicht ganz sicher; Bermersheim vor der Höhe, bei Alzey gelegen, erscheint als wahrscheinlich. Früh wurde sie Benediktinerin und gründete um 1150 das Kloster Rupertsberg, wo sie auch starb.
Hildegard von Bingen gilt als die erste deutsche Vertreterin der Mystik. Offenbar hatte sie Visionen, die sie göttlichem Ursprung zuschrieb und schriftlich niederlegte. Jedenfalls sind ihre Schriften von stark religiösem Charakter. Doch was sind »Visionen«? Wahnartige Vorstellungen, intensive kreative Phasen oder gar Flow-Erlebnisse, wie man heute vielleicht versucht wäre zu sagen? Wer weiß das schon.
In dem relativ spät verfassten Werk Welt und Mensch entwickelt Hildegard jedenfalls eine groß angelegte Schau der Verbundenheit: von Gott mit dem Menschen, aber auch vom Menschen mit der Welt sowie der Menschen untereinander:
»Jede kosmische Kraft wird von einer anderen gesteuert und gebremst, so wie auch ein starker Mann einem Feind in die Arme fällt, damit er nicht sich selbst oder andere umbringe. So ist jedes Geschöpf mit einem anderen verbunden, und jedes Wesen wird durch ein anderes gehalten.«25
Diese Form der Kosmologie, die Hildegard hier vorstellt, liest sich deutlich anders als etwa die biblische Schöpfungsgeschichte, welche ja vergleichsweise statischer Natur ist. Hier wird ein starkes Bild der Interdependenz entwickelt. Das göttliche Wirken selbst gerät dadurch sogar eher in den Hintergrund, obwohl es selbstredend alles »durchdringt«.
Selbst die Moralität wird von Hildegard reflexiv gestaltet. Alle »Taten des Menschen« seien miteinander verbunden:
»Durch die guten Werke, die die bösen bezichtigen, hat der Mensch Freude; an den schlechten Taten, durch die die guten erkannt werden, hat er Trauer.«26
Erstaunlich an dieser reflexiven Moralvorstellung ist, dass sowohl die guten als auch die schlechten Taten nicht nur als notwendig angesehen werden, sondern darüber hinaus für die Erkenntnis selbst sich wechselseitig bedingend. Hildegard argumentiert hier in einer ganz ähnlichen Weise wie beispielsweise Laozi, dessen Schriften sie jedoch wohl eher nicht gekannt haben wird.
Die insgesamt von ihr entwickelte Gesamtschau auf Mensch und Welt gipfelt schließlich in einer Darstellung der Welt in Gestalt eines großen Rades mit sechs konzentrischen Kreisen, die verschiedene Aspekte von Licht, Feuer, Wasser und Äther symbolisieren. Inmitten dieses Rades über alle sechs Kreise sich erstreckend: der Mensch, nicht Gott.
Das Verbundenheitsgefühl von Mensch und Welt, dem Hildegard von Bingen Ausdruck verleiht, steht im Rahmen dieses Buches stellvertretend für Einsichten in Gestalt einer Art von systemischer Alltagsweisheit einer allumfassenden Verbundenheit. Manche mögen derartige Alltags- oder Volksweisheiten belächeln; die Ironie der Geschichte besteht jedoch darin, dass ihnen bereits ein frühes Verstehen von Ökologie im Sinne einer »harten« Naturwissenschaft innewohnt.
Dies wiederum lässt Sichtweisen wie diejenige von Hildegard als moderner und wissenschaftlicher erscheinen denn so manch anderen, konkurrierenden Weisen der Weltwahrnehmung, in der die Welt beispielsweise eher als Ansammlung von Entitäten wahrgenommen wird. Die Idee einer Verbundenheit, wie sie Hildegard von Bingen entwickelt, ist mit Sicherheit nicht so naiv, wie es zunächst den Anschein haben mag, sondern stellt bereits eine gereifte Wirklichkeitswahrnehmung dar.
4Ambivalenzen der Neuzeit
In der Neuzeit werden nun viele der Ideen, die bis heute unser Denken und Handeln prägen, in ihrer modernen Form entwickelt oder zumindest vorformuliert. Bereits im Jahre 1620 spricht Francis Bacon von einer »neuen Wissenschaft«. Darin fordert er, das Experiment als zentrale Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis zu nehmen und nicht bloß althergebrachten Lehrmeinungen nachzufolgen. Das Unternehmen der modernen Wissenschaft gewinnt damit seine Gestalt.
Parallel dazu verdichten sich die Widersprüchlichkeiten von nunmehr sichtbar konkurrierenden Denkweisen. Was sich in der Antike bereits angedeutet hat, nimmt nun die Form an, die bis heute hin fortwirkt: in all der Ambivalenz zwischen technischem Fortschritt und einer genuinen Blindheit für breiter angelegte Zusammenhänge.
Doch wann beginnt die Neuzeit? Genauer: Wann lassen wir sie beginnen? Vielleicht in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, denn dort treffen wir auf gleich zwei große Wegmarken in der menschlichen Geschichte: die Erfindung des Buchdrucks um 1450 sowie die »Entdeckung« Amerikas im Jahre 1492. Ersteres sorgte für eine rasche Verbreitung von Informationen und Wissen, Letzteres veränderte eine ganze Reihe von Horizonten.
Aus der Vielzahl an Denkern aus einem Zeitraum, der bis in das 19. Jahrhundert hineinreicht, wurden hier nur derer fünf ausgewählt. Sie stehen paradigmatisch für miteinander konkurrierende philosophische Traditionen. Für den Konstruktivismus und die Systemik werde ich Ideen von Vico, Kant und Hegel erläutern. Für zwei Typen dagegen opponierender Denkweisen werden Descartes und Nietzsche benannt. Entsprechend der Chronologie der Dinge bilden Letztere hierbei einen Rahmen für Erstere. Beginnen wir also mit Descartes und enden mit Nietzsche, und ich nehme mir weiterhin die Freiheit der Auswahl. Alle fünf Autoren lassen sich nämlich durchaus auch anders lesen, wenn man anderen Aspekten ihres Denkens den Vorrang gibt.
Dualismus (René Descartes)
René Descartes (1596–1650) stammt aus dem kleinen französischen Örtchen La Haye en Touraine, das in der Region des Loire-Tals liegt. Gelebt hat er jedoch vor allem in Paris, in den Niederlanden und zuletzt in Stockholm.
Eine der großen philosophischen Fragen, die Descartes beschäftigten, bestand darin, dass unsere Sinneswahrnehmungen uns betrügen können. Die ganze Welt als eine Fata Morgana? Dies ließ ihn geradezu verzweifelt nach einem sicheren Kriterium für eine unumstößliche Wahrheit suchen. Descartes ist der große Sucher nach erkenntnistheoretischer Sicherheit.
Das zentrale Problem für ihn bestand darin, dass er all die Erkenntnisse bezweifelte, die unser Wahrnehmungsvermögen erst ermöglicht. Unsere Sinne seien trügerisch, denn sie können getäuscht werden. Daher ist ihnen zu misstrauen. Unmöglich also, dass sie einen verlässlichen Boden für sicheres Wissen bieten können.
Wäre Descartes diesem Zweifel in einer anderen Weise begegnet, und hätte er nicht derart verzweifelt nach einer felsenfesten Form von Wahrheit gesucht, wäre er vielleicht sogar zu einem Konstruktivisten geworden. Seine Feststellung jedoch, dass unsere Sinne uns täuschen können, bedeutete für ihn bloß, dass man ihnen gar nicht erst trauen dürfe.27
Welcher Instanz aber stattdessen Vertrauen schenken? Für Descartes war der gesamte Körper also ausgeschlossen. Somit blieb für ihn nur noch der Geist, die Vernunft. Seine daraufhin entwickelten Ideen setzen eine zentrale Wegmarke in der langen Tradition der Aufspaltung und des wechselseitigen Ausspielens des menschlichen Körpers gegen seinen Geist. Wenn wir eine Ahnengalerie des Reduktionismus aufbauen wollten, so gebührte Descartes gewiss ein prominenter Platz.
Im Rahmen seiner sechs »Meditationen« entwickelt er eine philosophische Position, die sich als radikale Gegentheorie sowohl zu systemischen als auch zu konstruktivistischen Denkweisen lesen lässt. Seine Argumentation zeichnet sich hierbei übrigens durch eine bewundernswerte Klarheit aus. Umso leichter wird es sein, den zentralen Fehlschluss in seinem Denken aufzuzeigen.
Descartes betont also die bis heute vielerorts zwar gebräuchliche, wenn auch fatale radikale Trennung von Körper und Geist. Den Körper versteht er im Gegensatz zum Geist als teilbar. Der Geist – bzw. die Seele – hingegen sei notwendigerweise unteilbar. Für ihn folgte daraus unter anderem, dass »aus der Zerstörung des Körpers nicht die Vernichtung des Geistes folgt«28. Denn der Geist, d. h. die Seele, sei unsterblich, und das Dasein Gottes ist für ihn kein Glaubensartikel, sondern wird als bewiesen angesehen. (Aber worin bestünde dann der Sinn des Glaubens?)
Immerhin flirtet Descartes mit konstruktivistischen Sichtweisen. So formuliert er – durchaus konform mit moderneren Einsichten –, dass der Körper letztlich nicht bloß durch die Sinne oder durch die Einbildungskraft erkannt wird, sondern durch den Verstand, also dadurch, dass man den Körper denkt.29 Aber daraus zu folgen, dass wir damit erst lernfähige Wesen sind und dass dies daher gar nicht so schlimm ist, das liegt ihm fern. Descartes glaubt, dass es Wahrheit ganz einfach geben müsse. Und da es sie in der dinglichen Welt nicht geben kann (womit er im Übrigen deutlich weiter ist als die vielen kruden Reduktionisten und »Realisten« nach ihm), so verbleibt ihm nur noch Gott.
Damit nimmt nun aber das philosophische Unheil erst so richtig seinen Lauf. Descartes müht sich gar nicht erst damit ab, sich selbst als ein gewordenes Wesen zu begreifen. Er scheint nie wirklich Kind gewesen zu sein. So erklärt er selber sinngemäß sogar, dass seine Eltern ihn zwar körperlich erzeugt hätten, sein Geist sei jedoch allein von Gott gekommen und habe sich offenbar in seinem wachsenden Leib einfach »irgendwie« entfaltet. Und da dieser Geist zudem unteilbar zu sein hat, gibt es keinen Platz mehr für innerpsychische Differenzierungen. So einfach kann man es sich machen.
Damit aber stellte sich Descartes als Urahn des Dualismus (also der Trennung von Körper und Geist) gleich eine doppelte Falle: Zum einen führte sein Beharren auf Unteilbarkeit auf der Seite des Geistes zu einem komplett mangelhaften Differenzierungsvermögen in allen geistigen Dingen. Zum anderen entspricht seine Betonung einer beliebigen Teilbarkeit des Körpers einer Art von Holzhackermentalität, was die Welt anbelangt. Diese beliebige Teilbarkeit (und demzufolge Zusammenbastelei) von allem und jedem ist ein typischer Kern reduktionistischer Denkweisen, auch wenn hier später natürlich deutlich elaboriertere Konzepte entwickelt werden. Es gibt zudem spätere Formen des Reduktionismus, welche konsequenterweise auf die sowieso nur künstliche Trennung von Körper und Geist verzichten, dann aber alles der Materie zurechnen.
So weit geht Descartes zwar nicht, philosophisch unbefriedigend bleibt seine Konstruktion dennoch: Eines der Probleme nämlich, welches Descartes zwar wortreich umkreist, jedoch bei Weitem nicht löst, besteht darin, dass all seine Aussagen über den Geist und über die Seele sich nur mithilfe von Sinnen vornehmen lassen. Wir können nun einmal seine Worte nur über den trügerischen Weg unserer Sinne lesen … Sein früher Reduktionismus krankt somit an seiner forcierten Ignoranz gegenüber der Verwobenheit der Welt unserer Wahrnehmung.
Besonders deutlich zeigt sich die Malaise dieses Denkens in der berühmten Zuspitzung, die Descartes selbst in Gestalt seines «Ich denke, also bin ich« (»Cogito, ergo sum«) vornimmt.30 Diese Formel ist es, die für ihn letztendlich das Fundament einer nicht weiter hinterfragbaren Einsicht einnimmt. Allerdings handelt es sich bei dieser scheinbar unhinterfragbaren Wahrheit um einen klassischen sogenannten Kategorienfehler, also um eine unzulässige Vermengung verschiedener Aussageebenen.* Denn: Jenes »Ich bin« beinhaltet bereits ein Sein, und zwar ein körperliches Sein. Descartes kann schlichtweg keine Form des Denkens behaupten, ohne eine Aussage mit Bezug auf unsere Sinne und somit auf unsere Körperlichkeit zu machen. Er sagt somit letztlich nicht mehr, als »Ich bin Geist, also bin ich Körper« – ein logischer Schluss, den er im Rahmen seiner dualistischen Philosophie jedoch von Beginn an ablehnt. Er endet somit genau da, wovor er sich durch seinen verzweifelten Denkakt schützen wollte. Würde man derartige Kategorienfehler vermeiden wollen, so wäre eine logisch korrekte, wenn auch hinreichend belanglose Wendung: »Ich esse, also bin ich.«