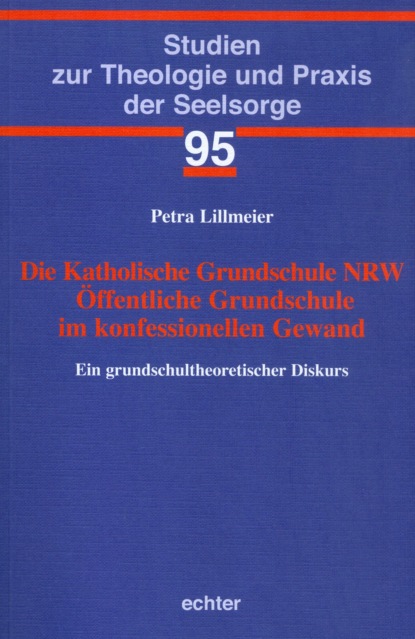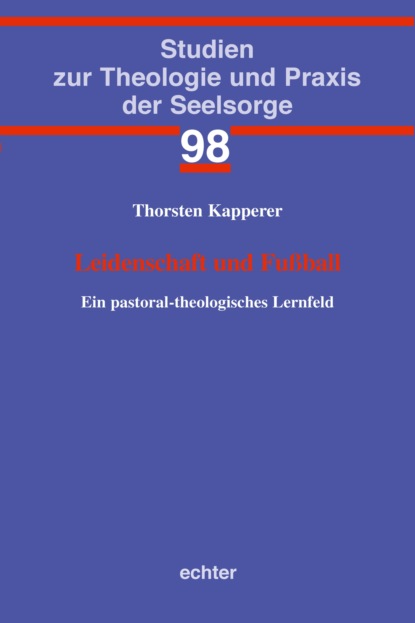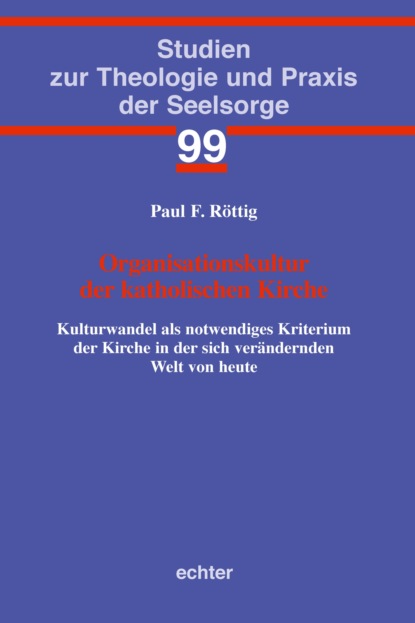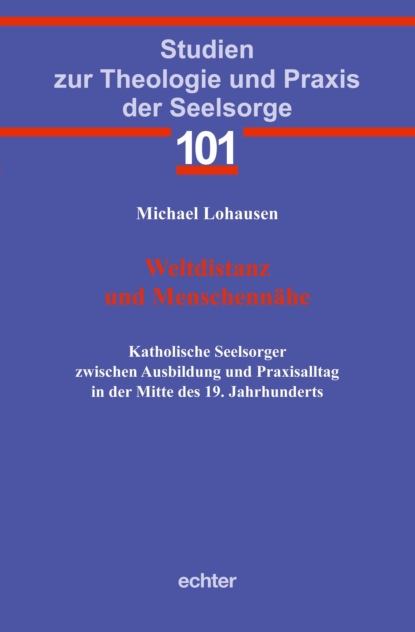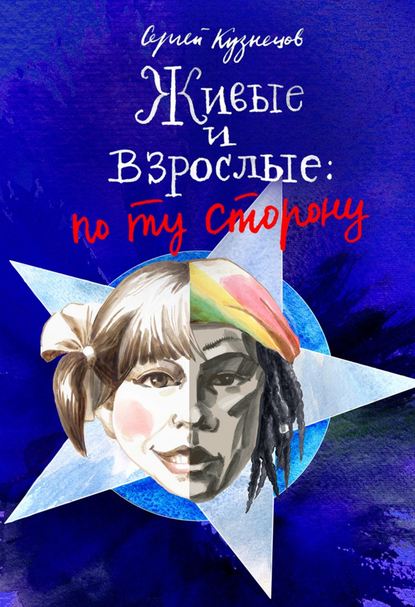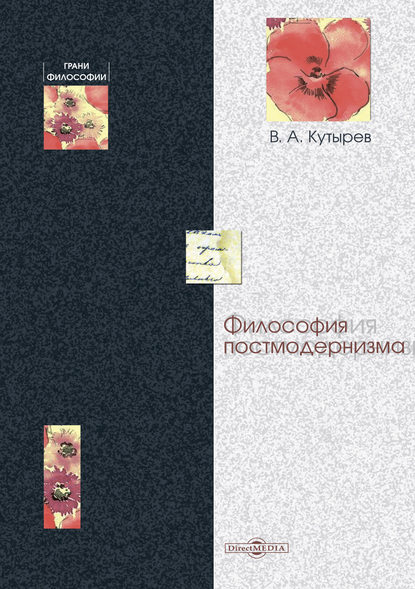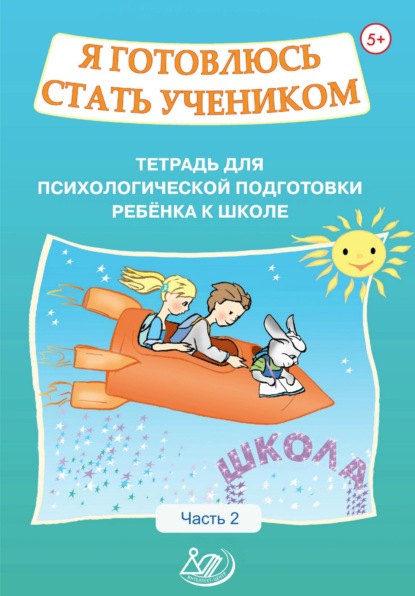Firmung Jugendlicher im interdisziplinären Diskurs
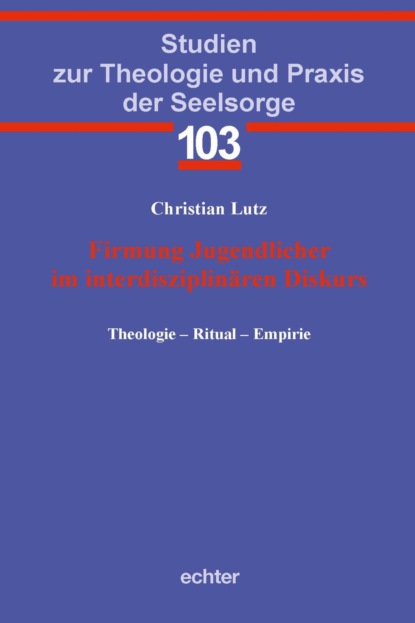
- -
- 100%
- +
Die Sakramente und damit auch die Firmung haben eine soziale Dimension. Sie dienen zum Aufbau der Kirche, gerade auch in den Einzelgemeinden, die besonders als territorial umschriebene Pfarreien, in gewisser Weise die Gesamtkirche darstellen61. In dieser Zuschreibung von Pfarrei / Gemeinde und Kirche sieht Zerndl auch die Wirkung der Initiationssakramente: „christliche Initiation erschöpft sich nicht in ‚Gemeinde’, aber die Eingliederung in ‚Gemeinde’ ist ein wesentliches Ziel“62. Dieses wird schon aus dem Grund deutlich, dass die Wirksamkeit der Sakramente vom Paschamysterium abhängig gemacht wird. So wird in SC 61 die Wirkung der Sakramente und Sakramentalien aus dem Christusereignis abgeleitet und eigens betont, dass der rechte Gebrauch aller materiellen Dinge auf das Ziel hin ausgerichtet ist, den Menschen zu heiligen und Gott zu loben. Initiation und Firmung müssen also von der „metahistorische[n] Bedeutsamkeit der Person Christi“63 her verstanden werden. Damit einher geht aber auch die Öffnung der Gemeinschaft auf andere Menschen und auf die gesamte Schöpfung hin. Christliche Initiation beinhaltet immer auch eine Sendung, denn die Firmung trägt wie alle Sakramente und wie jedes individuelle menschliche Leben64 dazu bei, „das Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten“65 zu heiligen. Diese biographische Bedeutung der Sakramente stellt die Firmung in die Nähe einer Begleitung oder auch Heiligung der Lebenszeit, in der sie empfangen wird, also zum Beispiel dem Jugendalter. Dies kann eben darin geschehen, dass das Leben Jesu für das persönliche Leben von Christinnen und Christen der Gegenwart Bedeutung erlangt. Deshalb wird die Firmung theologisch sowohl im Pfingstgeschehen verortet sein als auch im Pascha-Mysterium.
1.1.2 Firmung ist ein ekklesiales Heilszeichen
Die Dogmatische Konstitution Lumen Gentium über die Kirche hat sich folgendermaßen zur Firmung geäußert: „Durch das Sakrament der Firmung werden sie [die Getauften] vollkommener der Kirche verbunden und mit einer besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet. So sind sie in strengerer Weise verpflichtet, den Glauben als wahre Zeugen Christi in Wort und Tat zugleich zu verbreiten und zu verteidigen“66. Diese Wendung findet sich im Zweiten Kapitel über das Volk Gottes und beschreibt das priesterliche Gottesvolk. Der Christ / die Christin wird in der Firmung also mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet und so individuell für das Leben gestärkt, gleichzeitig wird er / sie vollkommener mit der Kirche verbunden und so wird die Gemeinschaft, die Kirche, gestärkt. Die Firmung ist also sowohl subjektiv bedeutsam als auch ekklesial. Sie steht mit der Taufe genau an dem Schnittpunkt der Zugehörigkeit des Einzelnen zur Kirche. Firmung ist zunächst einmal eine Gabe und zwar sowohl an den einzelnen Christen als auch an das gesamte priesterliche Gottesvolk. Die Firmung beschreibt aber auch eine Aufgabe. Während alle Getauften die Pflicht haben, ihren Glauben „vor den Menschen zu bekennen“67, sind die Gefirmten in strengerer Weise verpflichtet, Zeugen Christi zu sein und den Glauben in Wort und Tat zu verbreiten und zu verteidigen. Der christologische Begründungszusammenhang der Firmung wird hier mit einer Theologie des Volkes Gottes ergänzt, das in der Firmung eine Stärkung erfährt. Deshalb wird eine komparative Sprechweise zur Erklärung der Firmung herangezogen. Damit tritt auch die Verpflichtung zur missionarischen Tätigkeit für die Gefirmten deutlich in den Vordergrund. Bei der Verbreitung des Glaubens ist allerdings auch seine Verteidigung mit impliziert. Dadurch beinhaltet die Firmung sogar den Auftrag zu apologetischem Wirken. Die Beziehung der Firmung auf die Verbreitung des Glaubens in Wort und Tat und der Einleitungspassus von LG 1168 verweisen obendrein auf ethische Implikationen des Sakramentes der Firmung. Darüber hinaus weist LG 11 neben dem christologischen Bezug der Firmung auch auf die pneumatologische Dimension hin. Neben der ethischen und missionarischen Verpflichtung werden auch spirituelle Aspekte der Zeugenschaft für Christus erwähnt.
Während für Peter Hünermann in LG 11 die einzelnen Christinnen und Christen als „Empfänger der Sakramente im Blickfeld“69 stehen, verweist Josef Zerndl auf die Aussagerichtung von LG 1170: Alle Aussagen beziehen sich auf die Wirkung des Sakramentes der Firmung. Die Entstehungsgeschichte von LG 11 zeige aber zudem, dass ursprünglich ein eigenes prophetisches Betätigungsfeld der Gefirmten angedacht war, das ein Desiderat geblieben ist. Anstelle dessen stünde in der Endfassung der Verpflichtungscharakter im Vordergrund. Entscheidende neue Aspekte in der Firmtheologie seien die Verlagerung des Schwerpunktes von der Verteidigung des Glaubens auf die Ausbreitung des Glaubens, ebenso wie die subjektive und ekklesiale Dimension im Sakrament der Firmung. Auch die Zeugenschaft für Christus in Wort und in Tat habe die bis zum damaligen Zeitpunkt vorherrschende Theologie der Firmung bereichert. Man könne dabei aber nicht von einem eigenen Auftrag an die Gefirmten sprechen, denn die Zugehörigkeit zur Kirche und die Verpflichtung zum Glaubensbekenntnis vor den Menschen ist in der Taufe bereits Grund gelegt71. Bedacht werden müsse ebenso, dass in LG 11 nicht von einer einheitlichen christlichen Initiation gesprochen wird. Die Firmung wird eher komparativ mit der Taufe in Beziehung gestellt, indem erneut von einem mehr die Rede ist. Dieser Komparativ erscheint aber eher als eine Zunahme, ein Wachstum oder eine Steigerung, als eine Herabsetzung der Taufe. Dennoch komme, so Peter Hünermann, das Volk Gottes als ein „in der Öffentlichkeit agierendes Handlungssubjekt [nicht deutlich zum Vorschein. Gesprochen wird] lediglich davon, dass durch die Gläubigen die Einheit des Volkes dargestellt wird“72. Auf dieser Grundlage wird in Herders Theologischem Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil die Passage aus LG 11: Sacramento confirmations perfectius Ecclesiae vinculantur übersetzt mit der deutschen Wendung: „Durch das Sakrament der Firmung werden sie vollkommener an die Kirche gebunden“73. Deutlich wird dadurch ersichtlich, dass Hünermann die Beziehung der Firmung zum „messianischen Charakter des Gottesvolkes“74 vermisst.
Dafür wird die Zeugenschaft für Christus in der Firmung noch einmal besonders bedeutsam, wenn von der Mitarbeit der Laien an der Sendung der Kirche in LG 33 die Rede ist: „Der Apostolat der Laien ist Teilnahme an der Heilssendung der Kirche selbst. Zu diesem Apostolat werden alle vom Herrn selbst durch Taufe und Firmung bestellt“. Durch das Zueinander von Laienapostolat, Heilssendung der Kirche und den nicht genau differenzierten Sakramenten Taufe und Firmung wird die Berufung des christlichen Lebens mit dem Laienapostolat identifiziert. Das bedeutet, dass das Mittun der Laien keine Hilfsarbeit für die Priester ist, sondern aus Taufe und Firmung direkt abgeleitet werden muss: es ist ein Grundcharakter christlicher Existenz75. Über LG 11 hinaus wird damit das Laienapostolat auf eine sakramentale Grundlage gestellt und nicht nur als eine Verpflichtung verstanden, die sich aus Taufe und Firmung heraus ergeben würden. Bemerkenswert ist, dass auf der Grundlage einer eschatologischen Sichtweise der Sakramente auch dem Laienapostolat eine eschatologische Dimension zugesprochen wird, wenn auch nur am Rande76.
Dass die Kirche als allumfassendes Heilssakrament verstanden wird77 und dass die Taufe Christus gleich gestaltet und der Empfang der Eucharistie Anteil am Leib des Herrn ist78, führt zu einer Theologie der Taufe als Begründung der Eingliederung in die Kirche und einer Theologie der Eucharistie als Zielpunkt der Eingliederung. Dies zeigt sich im Besonderen im Dekret Presbyterorum Ordinis. Über Dienst und Leben der Priester 2 und 5. Wenn es „kein Glied [am mystischen Leib Christi gibt], das nicht Anteil an der Sendung des ganzen Leibes hätte [, dann muss jedes Glied] vielmehr Jesus in seinem Herzen heilighalten und durch den Geist der Verkündigung Zeugnis von Jesus ablegen“79. Für Zerndl ist deshalb das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen die „Voraussetzung für das Amtspriestertum“80. An eine Beauftragung des Amtspriestertums durch das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen sei damit allerdings nicht gedacht. Dadurch, dass das Amtspriestertum nicht aus der Taufe abgeleitet wird, würde PO 2 den Gedanken an eine Weihe des Laien zum Apostolat nicht rechtfertigen: „Firmung kann nicht als eine Art niedere Weihe betrachtet werden; sie gehört theologisch zur Taufe, nicht zum Amt“81. Deshalb absorbiert der sakramentale priesterliche Dienst „Taufe und Firmung nicht, sondern [er] setzt sie voraus“82. Die Befürchtung, das Amtspriestertum vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen abhängig zu machen, könnte dazu geführt haben, dass man von einem eigenen Betätigungsfeld für Gefirmte Abstand nahm.
1.1.3 Firmung ist das besondere Sakrament des Heiligen Geistes zur apostolischen Sendung
Die eucharistische Gemeinschaft bleibt in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht auf sich selbst bezogen, sondern ist als solche immer schon eine gesandte. Apostolische Sendung und missionarische Verpflichtung sind damit eine priesterliche Tätigkeit im Dienst aller Getauften und Gefirmten: in Taufe und Firmung sind Christinnen und Christen zum Apostolat gesandt83. Dazu bedient sich das Dekret Apostolicam Actuositatem. Über das Laienapostolat 3 vor allem der drei theologischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung und bezieht die Liebe auf die Liebe zu allen Menschen und das Tätigwerden für deren Heil. Zur Durchführung dieses Apostolates schenkt der Heilige Geist den Gläubigen Gnadengaben, Charismen, die im Konzilstext allerdings nicht näher erläutert werden. Es wird lediglich erwähnt, dass der Empfang eines Charismas verpflichtet, sie „in Kirche und Welt zum Wohl der Menschen und zum Aufbau der Kirche zu gebrauchen“84 und dass das Hirtenamt damit beauftragt ist, die Charismen zu prüfen und zu fördern. Entscheidend ist an diesem Text, dass das Apostolat der Getauften und Gefirmten gleich ursprünglich zu verstehen ist wie die Sendung der sakramental geweihten Diakone, Priester und Bischöfe85.
Ein Charisma, eine Gabe des Heiligen Geistes als Hilfe zum Apostolat, ist also nur zum Wohl der Menschen und zum Aufbau der Kirche zu gebrauchen. Es wird ganz ähnlich wie die Firmung als Gabe und Aufgabe verstanden, es ist allerdings nicht direkt als Wirkung der Firmung beschrieben, sondern als eine Gabe des Heiligen Geistes, die den Getauften und Gefirmten mit auf den Lebensweg gegeben wird. Und dieses Leben ist in vollem Umfang in den Prozess der Zeugenschaft für Christus mit einzubeziehen. Die sozialen Gruppen, in denen die Christinnen und Christen leben, wie auch die zeitlichen Einflüsse, denen alle Menschen unterliegen: all dem soll mit Liebe und Achtung begegnet werden, weil Zeugenschaft für Christus nur im persönlichen Leben möglich ist86. Peter Hünermann erklärt, dass eine „sichtbare Erneuerung des missionarischen Geistes […] durch dieses Dokument [AG] in der nachkonziliaren Kirche“87 nicht ausgelöst wurde. Festzuhalten ist aber auch, dass auch AG 11 das Apostolat der Laien nicht vom hierarchischen Priestertum abhängig macht, sondern als ursprüngliche Sendung zusammen mit dem hierarchischen Priestertum versteht88.
Gerade im Dekret Orientalium Ecclesiarum. Über die katholischen Ostkirchen tritt eine weitere Frage zu Tage, die auch in der römischkatholischen Kirche in Deutschland für Diskussionen sorgt: nämlich die Frage nach dem Zeitpunkt der Firmung, die bewusst nicht beantwortet wird: „Das Konzil möchte zwar die ältesten Traditionen wiederhergestellt sehen, läßt aber den Zeitpunkt der Firmspendung offen“89. Während sich aber in den deutschsprachigen Ländern die Diskussion eher darum drehte, mit der Firmung zu warten und erst mündige junge Erwachsene zur Firmung zuzulassen90, geht es in OE darum, sowohl die Firmung im Anschluss an die Taufe als auch die Firmung zu einem späteren Zeitpunkt zuzulassen. Dabei zeigen die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils Interesse daran, dass möglichst viele Christinnen und Christen das Sakrament der Firmung empfangen, denn „um des Seelenheiles willen hält das Konzil nicht unbedingt am Prinzip der Rituszugehörigkeit fest. Alle orientalischen Priester dürfen sogar lateinisch Getaufte und auch unabhängig von der Taufspendung und ohne rituelle Konsequenz firmen, ähnlich umgekehrt lateinische Priester mit entsprechenden Vollmachten“91. Dies mag gerade dann überraschen, wenn man davon ausgeht, dass die Firmung kein heilsnotwendiges Sakrament ist92. Gerade die zeitliche Zusammengehörigkeit von Taufe, Firmung und Eucharistie in den orientalischen Kirchen mag zu dieser Haltung beigetragen haben. Sowohl die Bestimmung in LG 26, nach der die originären, erstberufenen Spender der Firmung die Bischöfe sind, als auch das Prinzip der Rituszugehörigkeit werden damit zugunsten des Seelenheiles der Christinnen und Christen ausgeweitet.
Nach Günter Koch lassen sich deshalb die wenigen aber wichtigen Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils zur Firmung folgendermaßen zusammenfassen: Taufe und Firmung gehören eng zusammen (LG 11; SC 71), Sie vereinigen mit Christus, dem Haupt (AA 3). Die Firmung verbindet vollkommener mit der Kirche (LG 11; AA 3), sie schenkt eine besondere Kraft des Heiligen Geistes (LG 11; AA 3) und befähigt und verpflichtet so nachdrücklicher zum Apostolat, zur Verwirklichung der christlichen Berufung (LG 11; AA 3). Die Bischöfe sind dabei die erstberufenen, originären Spender des Sakramentes des Firmung (LG 26)93. Günter Koch ist der Ansicht, dass das Zweite Vatikanische Konzil entscheidende und grundlegende Aussagen zur Firmung gemacht hat94, während Heribert Mühlen die Auffassung vertritt, das Zweite Vatikanische Konzil habe keine neuen Aspekte der Firmung vorgetragen95. Für Josef Zerndl ist diese Frage von geringerer Bedeutung, entscheidend sei vielmehr, dass auch das Zweite Vatikanische Konzil die prekäre Zuordnung von Tauf- und Firmwirkung nicht geklärt habe, so Zerndl96. Wenn das Zweite Vatikanische Konzil aber nichts zur exakten Unterscheidung von Tauf- und Firmwirkung beigetragen hat, kann man auch fragen, ob dies nicht eben die innere Zusammengehörigkeit der beiden Sakramente stärkt. So sehr auch Theologinnen und Theologen versucht haben, die spezifische Unterschiedlichkeit herauszuarbeiten, so bleibt man doch letztlich auf die innere Verbundenheit von Taufe und Firmung verwiesen, wobei die Beziehung zum Sakrament der Taufe nicht als ein exklusives Merkmal der Firmung interpretiert werden kann. Die Relation zum Sakrament der Taufe ist bei jedem einzelnen Sakrament ebenso zu berücksichtigen, wie die Beziehung zur Eucharistie.
1.1.4 Entfaltung dieser Aspekte der Firmung – die Beschlüsse der Synoden
Die Sendung der Getauften und Gefirmten war dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein wichtiges Anliegen. Betätigungsfelder oder Anregungen, die Sendung im alltäglichen Leben umzusetzen, sucht man aber vergebens. Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland und die Pastoralsynode der katholischen Kirche in der DDR hatten auch deshalb die Aufgabe, die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen zu fördern und „zur Gestaltung des christlichen Lebens gemäß dem Glauben der Kirche beizutragen“97. Dazu mussten sich beide Synoden in besonderer Weise auch mit dem Sakrament der Firmung auseinandersetzen. Die Schwierigkeit lag vor allem darin, dass Papst Paul VI. Im Jahr 1971 den Ritus der Firmspendung einer Revision unterzogen hatte98. Die Firmung der Erwachsenen folgt dem in den orientalischen Kirchen üblichem Ablauf von Taufe-Firmung-Eucharistie. Die Firmung von Heranwachsenden findet in der Regel nach der ersten Spendung der Eucharistie und des Bußsakramentes statt. Der Empfang der Firmung wurde abhängig gemacht von der Taufe, der Erlangung des Vernunftgebrauchs, einer katechetischen Unterweisung und der rechten Disposition zur Erneuerung des Taufversprechens99. In der Überarbeitung des Firmritus sollte deutlich werden, dass in der Firmung die Gabe des Heiligen Geistes mitgegeben wird100, die bis dahin übliche Spendeformel, die den Spender des Sakramentes in der Ersten Person als handelndes Subjekt nannte101, wurde abgeändert und die Betonung der Spendung der Firmung wurde erstens auf die Salbung mit Chrisamöl an der Stirn, und zweitens auf die Auflegung der Hände gelegt mit der neuen Spendeformel: Sei besiegelt mit der Gabe des Heiligen Geistes102 gelegt. Gerade der Bezug auf die Gabe des Geistes darf aber nicht exklusiv oder unter Zurückstellung der Taufe verstanden werden, denn Papst Paul VI. ordnete die Firmung in die Reihe der Initiationssakramente ein und verwies ausdrücklich auf die Taufe als Wiedergeburt, die Firmung als Stärkung und die Eucharistie als Nahrung für das ewige Leben103. Neuartig ist die vom Zweiten Vatikanischen Konzil her inspirierte beziehungsweise aus den Verlautbarungen her ableitbare zentrale Stellung der pneumatologischen Dimension der Spendeformel. Die Firmung ist somit in ihrer Beziehung zur Taufe und in ihrer Hinordnung auf die Eucharistie zu verstehen.
Diese neuen Konstellationen stellte auch die Gemeinsame Synode vor Herausforderungen, was dazu führte, dass zeitweise ein eigenes Dokument zur Taufpastoral geplant war, unter Auslassung des Sakramentes der Firmung104. Die Auseinandersetzung mit der Firmung geschah in der Gemeinsamen Synode vorwiegend in dem Synodenbeschluss Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral. Der Beschluss Die Beteiligung der Laien an der Verkündigung erwähnt die Firmung überraschender Weise nur beiläufig, stellt sie aber in eine Reihe mit der Taufe als „geistgewirkte Befähigung zum Glaubenszeugnis“105.
Inhaltlich ist der Synodenbeschluss Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral davon gekennzeichnet, dass die Relevanz der Sakramente im persönlichen Leben sichtbar werden soll. Richard Hartmann formuliert dies folgendermaßen: „Es geht den Synodalen darum, den Zusammenhang der Sakramente mit den Grundfragen nach dem Leben, nach bestimmten und zentralen Stationen herzustellen. Sakramente sollen nicht ‚einseitig als Gnadenmittel verstanden’ werden, ohne den Lebensbezug und die Christusbeziehung zu entfalten“106. Der Synodenbeschluss stellt den Bezug zum alltäglichen Leben gleich im ersten Abschnitt deutlich heraus und beginnt mit der Feststellung, dass Menschen in besonderen Lebenssituationen die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen. Die Sakramente werden in diesem Kontext als Deutungsmöglichkeit und als Ausfaltung der Bestimmung des Menschen verstanden. Dass Sakramente Zeichen des Heils sind und in Jesus Christus, dem Ursakrament, begründet sind, würde vielen Menschen allerdings nicht mehr deutlich – „der Bezug zum eigenen Leben und das Angebot einer persönlichen Begegnung mit Christus“107 würden nicht mehr erkannt. Die Zeichen der Liebe und der Nähe Gottes, als welche die Sakramente auch bezeichnet werden, sind in der Kirche für jeden Menschen auffindbar, besonders sinnenfällig in der Gemeinde, die als Gemeinschaft der Gläubigen an einem Ort verstanden wird108. Deshalb möchte die Synode die Sakramente nicht nur als punktuelle Kontakte von Sakramentenempfängern mit der Gemeinde verstanden wissen, sondern auf vielfältige Weise zu Begegnungen mit der göttlichen Wirklichkeit auffordern.
Die Firmung ist, wie alle Sakramente in ihrer pneumatologischen Dimension zu verstehen. Denn der Heilige Geist leitet die Kirche, die wiederum der Ort für die einzelnen Sakramente in den Gemeinden ist. Sie muss außerdem auch in ihrer Beziehung zur Taufe gesehen werden und sie führt zu einer „neuen Befähigung und Beanspruchung des Getauften zum christlichen Leben“109. Fragen nach einer genaueren Unterscheidung von Taufe und Firmung beantwortet der Synodentext nicht. Entscheidender sind die Anweisungen zur Firmpastoral, die aus der Zusammengehörigkeit der Initiationssakramente abgeleitet werden.
Der Ort der Firmung ist die konkret verfasste Gemeinde, in der die Firmung in nicht allzu großen Abständen vom Bischof oder einem Bevollmächtigten gefeiert werden soll. Zusätzlich zu dieser Verortung der Firmung in der Gemeinde soll der Pate dem Firmanden helfen, seinen Ort in der Gemeinde zu finden. Deshalb ist die Glaubenshaltung des Paten das eigentliche Kriterium für deren Auswahl. Kann kein geeigneter Pate gefunden werden, kann auch auf den Paten verzichtet werden110.
Spender der Firmung ist nach Möglichkeit der Bischof. So soll den Firmanden die Zusammengehörigkeit ihrer Gemeinde mit der Diözese und mit der Weltkirche vermittelt werden111. Entfalten soll sich die Firmung in einem Leben aus dem Glauben. Die Gefirmten sollen gelernt haben „als geistliche Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott [zu finden] und bereit sein, gemeinsam und als einzelne in Kirche und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen“112. Dabei sollen die Gefirmten in der Seelsorge mithelfen können, in den kirchlichen Räten aktiv sein, die caritativen Einrichtungen mit ihrem Engagement unterstützen und im liturgischen Bereich Aufgaben übernehmen. Alle diese Stellungen und Funktionen sind mit einer Gnadengabe des Geistes verbunden und deshalb wären gerade Gefirmte in solchen Positionen wichtig.
Eine große Schwierigkeit ist die Frage nach dem Alter der Firmanden: „Je mehr die eigene Entscheidung und Reife des Firmlings betont wird, desto eher wird ein höheres Alter gefordert. Dies, so wird festgehalten, sei jedoch keine theologische, sondern eine pastorale Ermessensfrage“113. Günter Koch hält dem gegenüber fest, dass die „pastorale Frage nach dem rechten Firmalter […] auch von dem favorisierten theologischen Ansatz“114 abhängt und somit nicht eine Entscheidung nur nach persönlichem Ermessen ist. Das kommt eigentlich auch im Synodenpapier zum Ausdruck:
Angeführt wird 1) das Argument, die Firmung im 7. Lebensjahr würde es ermöglichen, die altkirchliche und bei der Eingliederung Erwachsener in die Kirche übliche Reihenfolge der Initiationssakramente Taufe-Firmung-Eucharistie einzuhalten. 2) Dem wird aber entgegengehalten, dass gerade die Findung der eigenen persönlichen Möglichkeiten zu einem freiheitlich verfassten christlichen Leben in diesem Lebensalter noch nicht möglich ist. 3) Deshalb wird für eine Firmung ungefähr im 12. Lebensjahr plädiert. In diesem Alter könne das Kind / der oder die Jugendliche bereits Zeuge des Glaubens sein und die Bedeutung der Firmung nachvollziehen. Es bleibt eigentlich dann nur die Frage offen, wie ein Kind im 10. Lebensjahr die Bedeutung der Gegenwart des erhöhten Herrn Jesus Christus im eucharistischen Brot begreifen kann, wenn es die Erstkommunion feiert. Deutlich sichtbar wird deshalb, dass der Synodentext ein Kompromissdokument ist, das bei verschiedenen Meinungen der Synodalen das richtige Mittelmaß finden will115. Der Wunsch war jedenfalls, dass das Synodenpapier einen Beitrag zur „Erneuerung der Kirche im Leben ihrer Gemeinden“116 leistet.
Einen ähnlichen Weg ging die Pastoralsynode der katholischen Kirche in der DDR, indem sie das Sakrament der Firmung ausschließlich in dem Dokument Aspekte des Verkündigungsdienstes der Gemeinde berücksichtigte117. Die wenigen Aussagen zur Firmung machen deutlich, dass der Auftrag zur Verkündigung in Taufe und Firmung gegeben ist und dass alle Getauften und Gefirmten an der Sendung der Kirche in der Welt teilnehmen118. Die katechetische Arbeit mit jungen Christen erfordert, auf ihre Lebensumstände einzugehen. Ebenso sollen die Eltern der Firmanden in ihrem Glauben gestärkt werden119.
1.1.5 Sachthemen für die interdisziplinäre Arbeit mit der Firmung
In einer interdisziplinären Untersuchung müssen die verschiedenen Wissenschaften miteinander ins Gespräch gebracht werden. Dies geschieht dadurch, dass Kriterien beziehungsweise Sachthemen benannt werden, die in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht werden und welche eine Fokussierung des normativ-theologischen Gehalts der Firmung ermöglichen. Gleichzeitig müssen diese Sachfragen im weiteren Verlauf der Arbeit den ritualwissenschaftlichen und empirisch-sozialwissenschaftlichen Entwürfen gestellt werden können.
Es kann festgehalten werden: Als Teil der christlichen Initiation steht die Firmung in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils an einem Berührungspunkt zwischen individueller Biographie und kirchlicher Gemeinschaft. In der persönlichen Biographie muss im christlichen Selbstverständnis der Blick auf das Pascha-Mysterium offen bleiben, das eigene Leben mit seinen alltäglichen Begebenheiten muss in Bezug auf das Leben und Sterben, die Worte und Taten sowie die Auferstehung Jesus Christi geführt und verstanden werden. Damit gehört jeder Christ / jede Christin in die Gemeinschaft des Kyrios, also zur Kirche. Die Firmung ist ein Heilszeichen für die kirchliche Gemeinschaft und für den /die Einzelne, denn die Gabe des Heiligen Geistes wird in der Firmung mit auf den Weg gegeben und die kirchliche Gemeinschaft wie die Firmanden stärker miteinander verbunden.