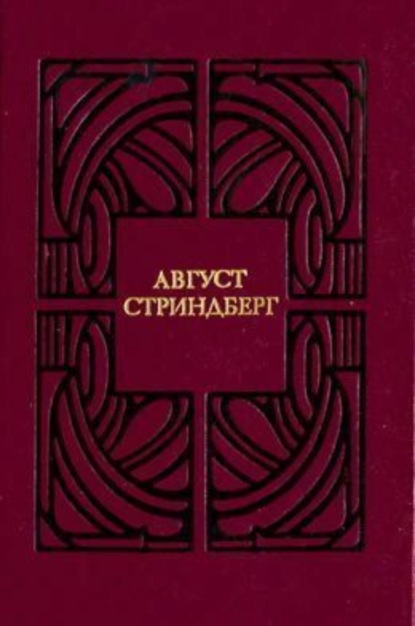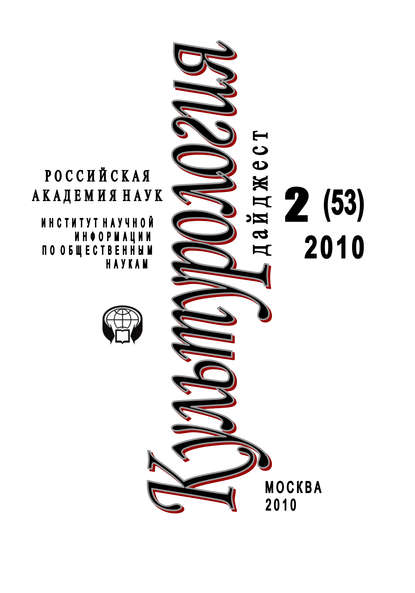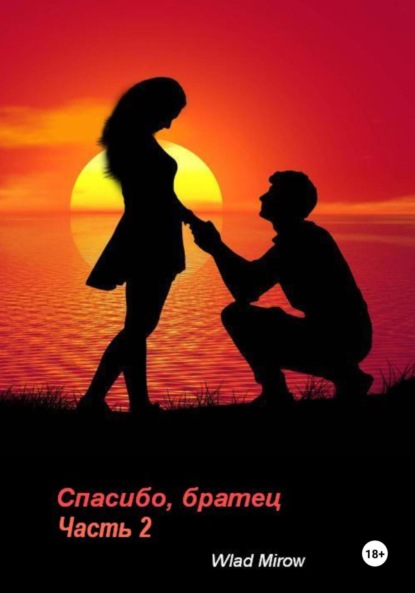Deutschland oder Jerusalem
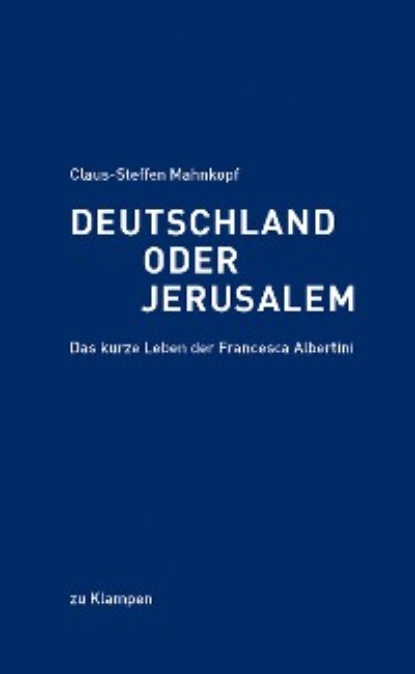
- -
- 100%
- +
Musik mußte für sie mit Text oder Handlung verbunden sein. Als sie, die Freiburger Studentin, in ein akademisches Konzert gebeten und von mir über die Länge einer Mahlersymphonie aufgeklärt wurde, schob sie eine Krankheit vor. Daher liebte sie die Oper oder Chorgesang, so aus der Renaissance, die sie in meiner CD-Sammlung entdeckte. Bei Puccini schmolz sie dahin. Als sie in einer Kirche Thomas Tallis’ berühmte 40stimmige Motette Spem in alium hörte, war sie enthusiasmiert. An Opernabenden interessierte sie die Inszenierung mehr als die Musik. Wenn diese ihr nicht lag, konnte sie das Haus auch früher verlassen. Bei der Uraufführung von Klaus Hubers Schwarzerde in Basel konnte ich sie gerade noch aufhalten. Immerhin war Huber mein Kompositionslehrer und Francesca von seiner Erscheinung äußerst angetan. Aber für sie zählte der Inhalt, der Stoff mehr als die Musik.
Francesca liebte die Harfe. Immer wieder versuchte sie mich zu einer speziell ihr gewidmeten Harfenkomposition zu verführen. Ich wies sie auf den diatonischen Charakter dieses Instruments hin und daß dies mit meiner musikalischen Sprache schwer zu vereinbaren wäre – was sie aber nicht verstand. Ich solle nicht chinesisch reden, antwortete sie mir. Dabei hatte ich bereits ein Harfensolostück geschrieben. Sie wünschte sich jedoch ein eigenes, persönliches. 2010 überlegte sie sich ernsthaft, eine Handharfe zu kaufen und sich das Spiel autodidaktisch anzueignen. Hierzu vertiefte sie sich in eine Einführung in die Notenschrift. Sie entdeckte die dem Fünfliniensystem innewohnende Unregelmäßigkeit zwischen Ganz- und Halbtonschritten und beschwerte sich bei mir über solche Irrationalität, die ihr nur Zeit raube. Als ich erklärte, daß wir diesen Unebenheiten die Tonalität zu verdanken haben, erreichte meine Rede sie nicht mehr. Sie hatte bereits innerlich abgeschaltet. Von einer Harfe war nicht mehr die Rede.
Die Musik verband uns also nicht oder nur wenig. Doch die Gemeinsamkeiten waren überwältigend. Wir mochten nicht: Horoskop und Esoterik, Adlige, laute, lärmige Musik, extrem geschminkte Frauen, Kreuzfahrten (ich foppte sie, sie werde wohl kaum ablehnen können, wenn ich ihr eine Kreuzfahrt schenkte; sie drohte daraufhin mit Scheidung), teure Autos, Pelzmäntel, den Papstkult, Fußball, Scharlatanerie in der Kunstszene, die Postmoderne. Wir verachteten Westerwelle, amüsierten uns über den Freiherrn zu Guttenberg, Berlusconi verabscheuten wir. Wir mochten Bruno Ganz, Woody Allen, Venedig, Katzen, Kartoffeln (Francescas, der Italienerin, Lieblingsbeilage), Ironie, Bücher, Reisen, Politik, Philosophie, Theater, Museen. »Mein Leben besteht auch aus Literatur, Politik, Theater, Oper und Freunden«, schrieb sie einmal. Das war bei mir nicht anders. Regelmäßig fuhren wir nach Basel zu den Museen, in Berlin gingen wir in jede wichtige Ausstellung, in Rom sowieso.
Häufig verständigten wir uns über philosophische Metaphern. Zu unserer Hochzeit im September 1999 beschenkten wir uns gegenseitig. Ich bekam eine sechsbändige Aristotelesausgabe. Die Widmung: »Aristotelicamente, tu sei il ›sinolo‹ della mia vita!« »Aristotelisch gesehen, bist Du die Substanz meines Lebens.« Natürlich hatten wir intellektuelle Differenzen, etwa, was die Einschätzung von Derrida betraf. Er war für sie ein genialer Schriftsteller, aber kein genialer Philosoph, der Lévinas für sie war. In politischen Fragen trennte uns ihre Ungeduld. Sie wollte die Demokratie in China jetzt, das Elektroauto jetzt, die Abschaffung des Hungers jetzt, die Reform des Kapitalismus jetzt, die Überwindung revanchistischer Bewegungen in Europa jetzt. Es konnte ihr nicht schnell genug gehen. Immerhin las sie auf meine Anregung hin das eine oder andere politische Buch, das pragmatische und nicht nur prinzipielle Lösungen vorschlägt, so von Franz Josef Radermacher oder Jeffrey Sachs. Da für uns beide die Vernunft – und nicht etwa der Glaube oder die Ideologie – an erster Stelle stand, konnten wir uns rasch verständigen. Unterschiede ergaben sich aus der unterschiedlichen Lebenserfahrung, dem Alter, der Herkunft, Interessenlage, dem Geschmack und Temperament – mithin Allzumenschlichem. Aber einen Grunddissens gab es für uns nicht. Wir hätten ohne großen Konflikt ein Buch zusammen schreiben können.
Wer religiös ist, könnte sagen, daß Gott uns zusammengeführt hat. Aber nicht in dem einfachen Sinne, daß er die Liebe zweier Menschen stiftet; eher in dem, daß zwei füreinander bestimmt scheinen und der Zufall, der sie zusammenführt, keiner sein kann. Uns verband die messianische Idee. Es war ihr Thema. Nicht nur im Messiasbuch und in der entsprechenden Vorlesung, sondern insgesamt. Das gilt aber auch für mich, seit ich in den frühen Kindestagen mit gesellschaftlichen Revolutions- und Erlösungsthemen der 1968er Zeit geradezu vollgepumpt wurde und kaum anders darauf zu reagieren wußte, als mir einen idealen Staat auszumalen. Als ich zehn Jahre später Adorno und den Schlußaphorismus zum Messianischen Licht in den Minima Moralia entdeckte, war es wie eine Wiedergeburt. Auf eine neue Reflexionsstufe wurde mein latenter Messianismus weniger durch das Studium, so in Frankfurt, gehoben, als durch die Begegnung mit der Jüdin, die Francesca war. Es ist schließlich kein Zufall, daß ich eines Tages ein großes Chorstück mit dem Messiastext von Maimonides komponieren sollte.
Unsere Liebe ging bis zu einer Art siamesischer Verschwisterung. Mir fiel irgendwann auf, daß ich im Kreise meiner Leipziger Studenten nicht nur häufig über Francesca sprach, sondern das in einer Art und Weise tat, als ob sie eine allseitig bekannte Persönlichkeit sei. Wie Francesca andernorts über mich sprach, erfuhr ich erst später. Eine Kollegin von der University of Amsterdam schreibt: »Im Sommer 2001 traf ich sie wieder in Oxford, auf einem Sommerkolloquium in Yarton Manor. Ich erinnere mich klar, daß es Ihr Hochzeitstag war, und sie war so glücklich, von Ihnen zu hören und Blumen zu empfangen. Sie erzählte das der gesamten Gruppe und strotzte vor Glück. Es war offensichtlich, daß sie sehr stolz auf Sie war.« Ein Kollege in Potsdam schrieb ihr einmal: »Warum sagst Du mir nicht, daß Du einen so berühmten Mann hast? Ich dachte immer, Dein Mann ist einer jener Partner, die froh sind, wenn etwas Licht vom Gatten auf sie herabfällt und die mit tränennassen Augen im Auditorium sitzen, wenn der Gatte irgendwo geehrt wird. Bei euch wird das eher ein Spiegelungsverhältnis sein.« Francesca antwortet: »Du hast mich nie nach meinem Mann gefragt … Jetzt aber im Ernst: Ich bin auf meinen Clausi sehr stolz.« Aus Hawaii kam die Beobachtung: »Francesca hat Sie sehr geliebt und mit großer Bewunderung von Ihrem Talent gesprochen.« Jeder Witwer hört das gerne.
Die vielleicht wunderbarste Seite an Francesca war ihr phänomenaler Witz. Ironie war ihr Element, und sie litt darunter, daß die Deutschen diese häufig nicht verstünden, weil sie sie für bare Münze nähmen. Francescas mitunter harte, ja bissige, aber niemals zynische Bemerkungen (»Die Universitätsverwaltung zwingt mich zum Amoklauf«) erzeugten eine gewisse Leichtigkeit, um über das am Leben eben nicht Leichte hinwegzukommen. Ihre umfassende Bildung half ihr dabei, natürlich auch, daß sie aus mindestens zwei zusätzlichen Welten kam, der römischen und der jüdischen. Als der Verlag ihres ersten Buches ein graues Cover vorschlug, schrieb sie zurück, es erinnere sie an das größte Gefängnis in Rom. Das Buch erschien dann in Knallrot, ihrer Lieblingsfarbe, der Farbe der Liebe, des Feuers und der Leidenschaft, wie sie sagte. War sie erzürnt, rief sie durchaus: »Ich schicke den Mossad!« Wurden wir der häßlichen und geschmacklosen Seiten der Deutschen ansichtig, seufzte sie auf: »Mein Volk …« Wir konnten ganze Abende im Restaurant im Tonfall der Ironie, der Indirektheit und des Humors verbringen. Witze waren gleichfalls ein Medium unserer Weltverständigung.
Francesca war von genialischem Zuschnitt, eine Ausnahmebegabung. Aber das Attribut »Genie« adressierte sie an mich zurück. Das hört man als Komponist zwar gerne, ich wollte aber doch die genauere Begründung hören. Sie antwortete mit Kant: ein schöpferischer Geist, welcher der Materie die Regeln aufzwingt. Sie bewunderte mich als Komponisten auch, weil sie davon nichts oder kaum etwas verstand. Aber sie hörte den Geist in meiner Musik. Wie genau sie dafür Worte finden konnte, zeigt sich an meiner oktophonischen Raumkomposition void – mal d’archive, in der Klänge aus Libeskinds Berliner Jüdischem Museum verarbeitet sind. Sie nannte das Werk ein »Requiem ohne Gott«. Ich habe bisher keine trefflichere Formulierung gefunden. Vermutlich hatte Francesca recht, wenn sie das Schöpferische in mir verortete. Ihre philosophische Doktorarbeit war auch weniger ein eigenständiger systematischer Entwurf. Francesca war viel eher eine Person, deren hermeneutische Kraft sich ganz entfaltete, wenn sie mit fremden Texten konfrontiert wurde, wie es ihr Freiburger Mentor Casper einmal treffend formulierte.
Die Intellektuelle Francesca ließ sich nicht blenden. Da sie möglichst viele Bücher kaufte, die ihren Interessen entsprachen, erwarb sie auch das Buch Das Wissen der Religion von Norbert Bolz, ohne zu ahnen, wer dieser Autor ist. Sie las es auf unserer Andalusienreise. Zunächst sagte ich nichts und wartete ab. Nach etwa 30 Seiten klappte sie frustriert das Buch zu. »Da steht nichts Originelles drin, und vieles ist einfach nur sachlich falsch oder uninformiert.« Das war der Zeitpunkt, sie über den Blender und Pseudophilosophen, der Bolz nun einmal ist, aufzuklären, über einen Autor, der großspurig auftritt, im besseren Fall aber nur Allgemeinplätze verkündet. Ich mußte schmunzeln, eine andere Reaktion von ihrer Seite hätte mich gewundert.
Wie ich schon andeutete und Tamara Albertini in ihrer Beschreibung bestätigt, trat Francesca nicht als Intellektuelle auf. Es fehlte ihr die Arroganz, vielmehr war sie getragen von Demut. Ihr fehlte das paranoische Gesicht weiblicher Intellektueller, die bereits auf Angriff gehen, bevor überhaupt etwas gesagt ist. Francesca war weder Kampffeministin noch Kampfjüdin, auch keine Kampfphilosophin. Sie wußte, daß sie, der »shooting star«, das nicht nötig hatte; sie lebte ein anderes Leben, eines, das nicht trennt zwischen Leben und Arbeit, zwischen Lebensvollzug und der weltanschaulichen Ausrichtung. Ihre Gesichtszüge hatten nichts von dem Verhärmten, Angespannten, Kopflastigen, Besserwisserischen, dem man so häufig in Deutschland unter Akademikern begegnet, auch nichts von der ewigen Opferrolle der Jüdin, deren Volk vernichtet werden sollte. Sie hatte auch nichts von einem Minderwertigkeitskomplex des zu Recht oder zu Unrecht verkannten Genies. Schon eher hatte sie etwas von einer Schauspielerin, wandelbar, ausdrucksstark, facettenreich, klug. Selbst für mich, der sie auch anders erlebte, ist frappant, daß sie auf fast allen Bildern in die Kamera lacht. Sicher, das war auch dem Gegenüber geschuldet. Aber diese hier ausgedrückte Lebensfreude muß man erst einmal in sich spüren. Das Harte im Gesicht einer Hannah Arendt fehlte ihr gänzlich. Eher könnte man sie mit Anne Frank, Etty Hillesum und Simone Weil vergleichen, zumal Francesca immer wesentlich jünger aussah, als sie war. Es gibt ein Bild aus Las Vegas, auf dem die 32jährige wie ein Teenager aussieht. Francesca bleib immer auch ein Kind. Selbst noch als Professorin. Eine Doppelexistenz eben.
REISEN
Reisen, in der Welt herumkommen war uns beiden essentiell und existentiell. Immer wenn ich Francesca fragte, was wir machen sollten, wenn wir zuviel Geld hätten (sie war an Luxus à la Autos, Kleidung, Schmuck und dergleichen völlig desinteressiert), sagte sie »reisen«. Sie wollte die ganze Welt sehen. Nicht nur, um die diversen Naturformationen und die großen Orte der Kulturen, sondern auch die verschiedenen Völker kennenzulernen. Das war schon als Teenager der Fall und wurde nach unserer Hochzeit systematisch ausgeweitet. Ihre, unsere Reisen waren ein integraler Teil unseres Politikverständnisses. Gerade hier, beim Reisen, zeigte sich unsere Syntonie. Wie oft sind Urlaube oder Besichtigungen belastet, weil die Partner, was Geschwindigkeit und Interessenlage betrifft, divergieren. Nicht so bei uns. Wir waren intensiv, gründlich, gut vorbereitet und absolvierten unser Programm zügig.
Unsere Reisen waren generell eher kurz, eine Woche oder zehn bis zwölf Tage, aber nicht länger. Nach acht Tagen meldete sich die Arbeit, wir mußten zurück an den Schreibtisch. Entsprechend waren unsere Reisen vollgepackt. In den zwölf Tagen China hatten wir immerhin vier Binnenflüge. Und auch Ägypten mit der Route Luxor, Assuan, Abu Simbel, Kairo mit einem Abstecher nach Sinai schafften wir in zehn Tagen, ohne daß wir das Gefühl hatten, etwas zu versäumen. Wir waren schnelle, schnell aufnehmende Menschen. Die Vorstellung, man hielte sich beispielsweise drei Wochen in einer Stadt auf, um deren Flair einzusaugen, war uns fremd. Auf Achse waren wir beide allein schon unseres Berufes wegen. Hinzu kamen das ständige Pendeln für die Lehrtätigkeit, die regelmäßigen Besuche bei der Familie in Rom sowie die längeren Studienaufenthalte.
Francesca kam viel herum, in der Schulzeit bereits nach Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Österreich, in unserer gemeinsamen Zeit Kalifornien, New York, Granada, Krakau/Auschwitz, St. Petersburg, Budapest, Ägypten, Israel, Jordanien, China und Burgund. Moskau, Hawaii, Oxford, Toronto mit den Niagarafällen und einige amerikanische Städte wie Las Vegas, Cincinnati und Princeton besuchte sie ohne mich. Wir hatten für die Zukunft viele große Reisen geplant: Mexiko, Tibet (das war einer ihrer sehnlichsten Wünsche), Marokko, Indien, Zentralasien, Syrien, Laos/Kambodscha, eine Safari durch die Tierwelt Afrikas und zahlreiche Städte wie Dublin, Prag oder Istanbul. Ihr Wunsch war es auch, in Hiroshima zu beten. Im Vordergrund standen Bildungsreisen, die wir selber zusammenstellten. Reisegruppen wollten wir uns niemals anschließen. Lieber buchten wir organisierte Touren mit einem persönlichen Reiseführer und einem Fahrer, der auf uns wartete, so daß wir uns nach Belieben einrichten konnten. Wir waren Individualisten.
Francesca bewegte sich ganz ungezwungen im Ausland. Sie beherrschte die Sprachen, hatte keine Angst, auf Menschen zuzugehen. Ja, sie war auf einem Tourismusgymnasium gewesen – ob das sie geprägt hatte? Jedenfalls spürte man, daß sie auf der ganzen Welt zu Hause sein konnte. Sie war eine Kosmopolitin, die Freude daran hatte, neue Völker und deren Gepflogenheiten kennenzulernen. Eine Konstante war das Kartenschreiben. Gleich, wo Francesca sich aufhielt, im Urlaub oder auf einem Kongreß, der erste Gang führte zu einem Ständer mit Ansichtskarten. Sie bedachte die Familie, die Freunde und Kollegen. Natur interessierte sie nur insofern, als sie keine körperliche Anstrengung bedeutete. Eine von Francescas Ideen war eine Schiffsreise zu den Pinguinen in der Antarktis. Sie hatte sich schon eine Route von der Südspitze Argentiniens aus überlegt. Auch Island wollte sie sehen, ohne dort groß herumwandern zu wollen. Für Inseln wie Madeira oder Hawaii wurden Leihwagen organisiert.
Die Konstante unserer Reisen war natürlich Italien. Ich kann nicht zählen, wie häufig wir dort waren, einzeln oder gemeinsam. Sie hatte dort beruflich zu tun und besuchte ihre Eltern vor allem zu jüdischen Festen, bei denen sie Heimweh, »nostalgia«, verspürte. In Rom bewegten wir uns wie zu Hause, Francesca sowieso, aber auch ich behandelte diese Stadt wie meine zweite. Wir trafen die Familie und Freunde und genossen die großen Ausstellungen, so zum Futurismus im Herbst 2001 oder »I tesori degli aztechi« im Frühjahr 2004. Nachdem wir von der Villa Massimo aus Venedig, Neapel und die Abruzzen besucht hatten, machten wir unsere Hochzeitsreise von Rom aus, wo im erweiterten Familienkreis gefeiert wurde, nach Florenz.
Allein, unser Herz schlug die ganze Zeit für Venedig. Die Serenissima war unser beider Traum, und das viel länger, als wir uns kannten. Man bedenke: Francesca, italienabstinent, wäre für Venedig – genauer: einen Lehrstuhl mit einem amerikanischen Gehalt nebst einem Palazzo – bereit gewesen, nach Italien zurückzukehren. Das will etwas heißen. Wir waren dreimal gemeinsam dort. An jenem Wochenende 1998, als Rot-Grün die Bundestagswahl gewann, 2005, als ich für zwei Monate Stipendiat am Centro Tedesco di Studi Veneziani war und Francesca mich besuchte, und 2010 im Frühsommer. Venedig war für uns der Inbegriff dessen, was Italien für die Menschheit bedeutet: Kunst, Größe, Eleganz, Kultur, Renaissance, Republik, aber auch die spezifische Morbidezza tat uns gut. Dann die Abwesenheit von Autos, das Wasser, das jüdische Ghetto. Venedig war für uns außergewöhnlich, und das heißt buchstäblich: wie nicht von dieser Welt. Eine Gegenwelt. Gewiß, die Touristen, die diese Stadt bevölkern, muß man ignorieren; wir als Italiener konnten dies auch. Wir kannten die Schlupflöcher.
Unsere erste ganz große Reise ging nach China – wohin sonst? Wenn wir schon so viel Geld ausgaben, dann für das Land, das uns naheliegend und zugleich fremd erschien. Im September 2000 war es so weit. Francesca plante: Beijing, Xi’an, Shanghai, Guilin, Hongkong. Wir landeten frühmorgens mit einem schrecklichen Jetlag in Peking bei bestem Sommerwetter. Endlich eine Weltreise, endlich das Land der Mitte, wir fühlten uns wie in Sektlaune. Wir liefen in die Stadt, zum in jeder Hinsicht geschichtsmächtigen Tian’anmen-Platz. Vor uns lag der Kaiserpalast, an dessen Eingang das überdimensionierte Mao-Bild thront. Wir waren angekommen. Die Pekingente verschmähten wir, nicht aber die wahrhaftig imposante Pekingoper. Für die Verbotene Stadt hatten wir genauso Zeit wie für den Sommerpalast, den Himmelstempel und die großen Parkanlagen. Wir wurden auch in Fabriken und zur traditionellen Medizin geschickt. Von Peking aus besuchten wir die Große Mauer, sicherlich so berühmt wie kaum etwas auf der Welt, aber die Faszination hielt sich überraschenderweise in Grenzen.
Natürlich ist China eine Diktatur, die mit drakonischen Strafen droht. Bezeichnenderweise haben wir auf der Straße davon kaum etwas mitbekommen, ganz im Gegensatz zu Ägypten, wo die Touristen andauernd Polizeikontrollen passieren mußten, zumindest im Hinterland. Ägypten erlebten wir als Polizeistaat, nicht China. (Was nicht heißt, daß dort heile Welt herrscht; unser studentischer Reiseführer in Shanghai versuchte uns auf plumpe Weise zu betrügen.) Uns überraschten das freudige, sonnige, sanguinische Naturell der meisten Chinesen auf der Straße, ihre kommunikative Art, ihr zwangloser Umgang untereinander, die Emanzipiertheit der Frauen, die Tai-Chi-Übungen und die Gesangsgruppen. Dieser Eindruck hielt sich in ganz Rot-China. Wir wurden auch regelmäßig angesprochen, sehr höflich, aber überhaupt nicht steif. Umgekehrt wurden wir als potentielle Käufer nicht andauernd angemacht. Nur einmal wollte ein »Künstler« uns unbedingt etwas verkaufen und wurde ausfällig, als wir ablehnten. Wir spürten etwas von einer vom Westen gänzlich verschiedenen Kultur, vom Fehlen des monotheistischen Gottes. Francesca sollte Jahre später den Buddhismus für sich entdecken. Wir dachten seither anders über die westliche Rationalität, die in Hegels System gipfelt.
Zu jener Zeit begann das chinesische Konsumzeitalter. Das bedeutete ein schroffes Nebeneinander von bitterer Armut sowie vorindustriellen Wohnverhältnissen und der schicksten Moderne (so der neue Flughafen in Hongkong oder der Jin Mao Tower in Shanghai, die neuen Shoppingmalls, die Bankenhochhäuser). Als wir von oben die wie Pilze aus dem Boden schießenden Wolkenkratzer von Shanghai sahen, meinte ich zu Francesca, man müsse hier Aktien kaufen. Die schiere Größe dieser Städte hatte für uns etwas Monströses, aber es stand uns nicht an, Wertungen vorzunehmen. Wir wurden stets ausgesprochen zuvorkommend behandelt und spürten, daß hier die kommende Supermacht erwacht.
Die Touristen erlebten wir von ihrer unangenehmen Seite. Im Restaurant an der Großen Mauer wurde eine größere ostdeutsche Reisegruppe verpflegt, welche die Unterscheidung zwischen »red wine« und »white wine« nicht verstand, so daß Francesca der armen chinesischen Bedienung beisprang und dolmetschte. Später traf sie auf der Toilette eine Frau, die sich beklagte, daß in China niemand deutsch spreche. Francesca stimmte dem ironisch zu, allerdings auf Italienisch. Im Frühstücksraum eines Hotels hörten wir eine ältere Französin in voller Lautstärke: »Die Chinesen haben überhaupt keine Kultur; die einzige Kultur, die sie haben, verdanken sie den Franzosen.« Das war heftig. Auf der Fahrt durch den für seine Karsthügel weltberühmten Lijiang-Fluß bei Guilin warfen Amerikaner spielenden Kindern im Wasser Eindollarscheine zu. Wir kamen auf unserer ersten Fernreise ins Nachdenken darüber, ob der Pessimismus von Schopenhauer nicht doch berechtigt ist.
Bei unserer Rückkehr erfuhren wir einen Kulturschock. Über die Vororte von Frankfurt fliegend, sahen wir, daß hierzulande jeder für sich ein Häuschen hat, undenkbar in China, dem Land der Wolkenkratzer; der Bahnbeamte am Servicepoint war so abweisend wie die Chinesen hilfsbereit, und im Zug wurden wir des Preises für die europäische Individuation inne: Die allermeisten schauten traurig drein, ihre je persönliche Leidensgeschichte hat die Gesichtszüge geprägt. Liegt es am Monotheismus? Wie auch immer, unsere erste ganz große Reise war ein Erfolg.
Die nächste größere Fahrt führte uns zu den Ursprüngen der abendländischen Kultur, nach Ägypten. Wieder hatte Francesca alles zusammengestellt: erst nach Luxor, von dort in den Süden, dann nach Kairo mit einem Abstecher auf die Sinaihalbinsel. In Luxor angekommen, gingen wir sofort in den Karnak-Tempel. Wir waren überwältigt von den Proportionen, die im Verhältnis zu den griechischen so viel größer dimensioniert sind, daß wir Menschen ganz klein und demütig werden. Francesca winkte mich zur Seite und fing plötzlich an, eine Wand zu dechiffrieren, so als ob sie eine Reiseleiterin sei, die sich hier auskennt. »Hast Du nicht gewußt, daß ich in Rom etwas Ägyptologie studiert habe?«, fragte sie. Nein, ich wußte das nicht. Am nächsten Tag ging es ins Tal der Könige mit den berühmten Todesgräbern, es war sehr aufregend, sie von innen zu sehen. Von Luxor fuhren wir hoch nach Dendara – genauso begeisternd wie der Karnaktempel, vielleicht sogar noch mehr.
Auf unserer Fahrt nach Assuan besichtigten wir den Tempel des Horus in Edfu, Kom Ombo, in Assuan das Sowjetisch-ägyptische Memorial mit dem Blick auf den Stausee und natürlich die Insel mit dem Philae-Tempel. Von dort ging es mit dem Flugzeug in den Süden, wo die Überlandstraßen für Touristen gesperrt sind. Die beiden Tempel von Abu Simbel gehören zum Eindrücklichsten, was wir je in unserem Leben sahen. Selbst die Pyramiden schienen Tags darauf harmlos dagegen. Erst mit Petra im März 2011 haben wir etwas Ebenbürtiges aus Menschenhand erlebt. Die drei Pyramiden von Gizeh erschienen beim ersten Anblick verhältnismäßig klein. Wir sind eben an hohe Gebäude gewöhnt. Je näher wir ihnen indessen kamen, desto bescheidener wurden wir. Sie sind in der Tat ein Wunder, bis heute. Wir durften in die Cheops-Pyramide eintreten und fühlten uns sehr geehrt. Der Besuch der Sphinx wurde überschattet von zwei Italienern, die, natürlich in ihrer Landessprache, fragten, ob denn der Besuch sich lohne, und dies ein paar hundert Meter von ihr entfernt. Francesca schämte sich maßlos. Wir bewegten uns in der Metropole Kairo ganz zwanglos, trafen einen guten Freund aus der römischen Zeit, der dort lebte. Von hier aus machten wir Ausflüge nach Saqqara, Memphis und zur al-Fayoum-Oase. Eingeplant war auch eine zweitägige Reise auf die Sinaihalbinsel, zum Katharinenkloster, mithin zu einem Bergmassiv, auf dem der Überlieferung nach Moses Gott traf. Das war für Francesca eine heilige Angelegenheit. Trotzdem haben wir diesen Berg nicht bestiegen; es wäre zu anstrengend gewesen. Francesca fand die Manuskripte im Kloster letztlich interessanter.
Unvergeßlich ist unsere Diskussion in der Cafeteria des Ägyptischen Museums, für das wir uns einen ganzen Tag Zeit nahmen. Anspielend auf die vieldiskutierte Kontroverse, ob der Westen nun eher von Jerusalem oder Athen, also den alttestamentarischen Geboten oder der griechischen Metaphysik geprägt sei, meinte ich, man könne diesen vermeintlichen Streit sehr gut verstehen, da doch hier in Ägypten sichtbar werde, daß das Land zwar eine atemberaubend lange Schriftkultur besaß, diese aber doch eine orientalische sei, die, so folgerte ich etwas naseweis, von der europäischen Kultur abgetrennt sei wie die indische oder andere asiatische. Francesca widersprach sofort, sie als Jüdin wisse um ihre Wurzeln, die eben weiter reichten als das Land Palästina. Ihr Volk war der ägyptischen Gefangenschaft entronnen.