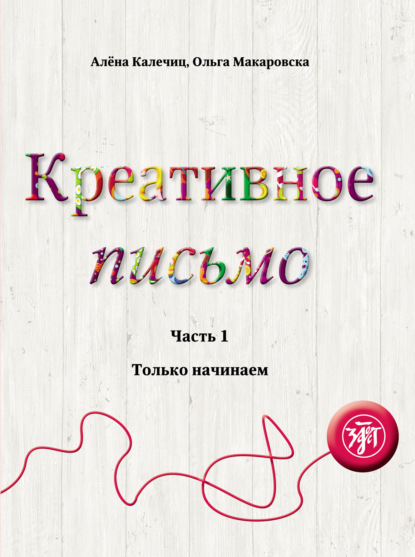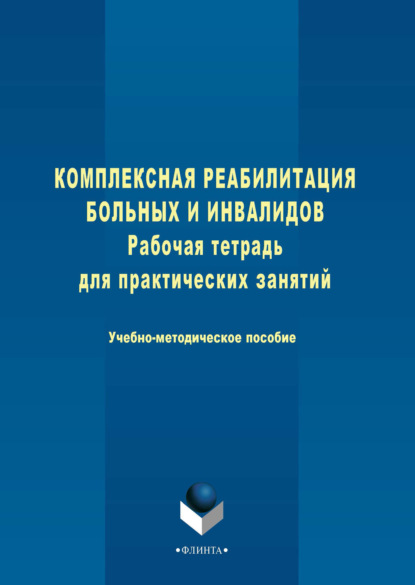Schweizer Heldengeschichten - und was dahintersteckt
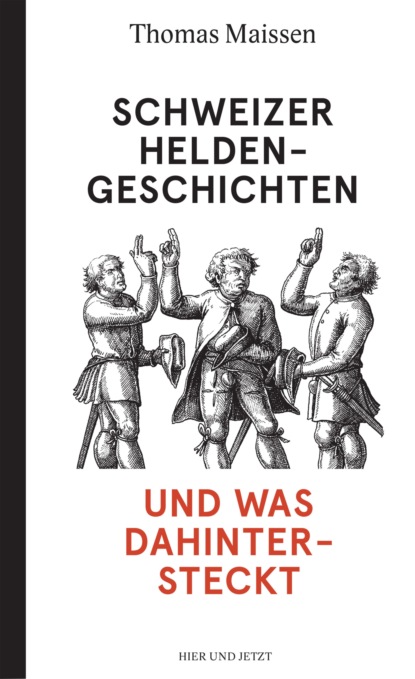
- -
- 100%
- +
Von diesem Urteil auszunehmen sind jedoch die weit über die Landesgrenzen hinaus wirkungsreichen Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft (1780–1808) des Schaffhauser Aufklärers Johannes (von) Müller. Er zog gleichsam die Summe aus den vielen Texten, die im 18. Jahrhundert neu zugänglich wurden, und ordnete diese in die Fragestellungen zu Landesbeschaffenheit, Volks- und Zeitgeist, Verfassungswandel und Vergänglichkeit ein, die Montesquieu und andere Aufklärer formuliert hatten und die in der Revolutionszeit hochaktuell waren. Müller stand selbst in den Diensten deutscher Fürsten und wurde 1791 vom Kaiser geadelt. Die Geschichte seiner Heimat, die er bei seinem Tod von den Helvetiern bis 1493 erzählt hatte, stilisierte er dagegen als kollektive Verwirklichung der Freiheit, die «unsere Väter durchaus und einmüthig», treu und tapfer, tugendhaft, patriotisch und christlich-fromm zu wahren wussten. Das so gezeichnete Vorbild der Alten sollte im Untergang der Alten Eidgenossenschaft und während der krisenhaften Helvetischen Republik volkspädagogisch Orientierung stiften. Nicht ein Fürst, sondern das schweizerische Volk in der durch die Alpen geprägten «Untilgbarkeit seines Nationalcharakters» war Hauptdarsteller und fand in einer freiheitlichen Verfassung seine wesensgemässe Bestimmung. Das trug im Umfeld von Französischer Revolution und Romantik zum enormen Erfolg des vielbändigen Werks vor allem in Deutschland bei.30 Schillers Wilhelm Tell beruhte auf dem «glaubenswerten Mann» Johannes Müller, wie er augenzwinkernd im Drama genannt wird, und über ihn auf Tschudi.
Dass v. Müller für Jahrzehnte die literarischen und moralischen Standards der Schweizer Geschichte gesetzt hatte, zeigte sich an den zahlreichen Fortsetzungen und Aktualisierungen seines Werks, die Robert Glutz-Blotzheim, Johann Jakob Hottinger, Louis Vulliemin und Charles Monnard in den Jahrzehnten bis 1851 verfassten. Letzterer übersetzte v. Müller auch ins Französische, und 1853 lagen umgekehrt diese Fortsetzungen auch auf Deutsch vor, sodass dem jungen Bundesstaat gleichsam eine zweisprachige Darstellung seiner Vorgeschichte bis ins frühe 19. Jahrhundert zur Verfügung stand. Die Schilderung des Gemeinsinns jenseits der Egoismen und der verbindenden christlichen Religion als dauerhafter sittlicher Basis trat an die Stelle von konfessionspolitischen Untertönen und Polemiken, auch wenn die Nationalgeschichte im 19./20. Jahrhundert eine Domäne von protestantischen Historikern blieb. Freiheit war ihr Leitmotiv, aber die elitären, religiösen und föderalistischen Autoren verstanden darunter keine Freiheit, die auf die nationale Demokratie enggeführt worden wäre. Die populäre Vermittlung v. Müllers und nicht zuletzt der Befreiungslegende war dagegen die Mission des aus Magdeburg eingewanderten liberalen Pädagogen und Politikers Heinrich Zschokke, über seine publizistische Tätigkeit für den Schweizerboten ebenso wie in Des Schweizerlands Geschichte für das Schweizervolk (1822). Sein Lob des Volkes, das sich seiner Überlieferung verpflichtet fühlen und von seinen Nachbarn abgrenzen solle, hatte einen grossen Erfolg und inspirierte vaterländische Feiern ebenso wie Volkslieder und Historiengemälde. Über die Sprachgrenze hinweg wirkte Zschokke ab 1849, als der liberale Freiburger Katholik Alexandre Daguet dessen Schweizergeschichte in einer französischen Bearbeitung vorlegte.
Ebenfalls ein Katholik, allerdings ein Konservativer, der Luzerner Joseph Eutych Kopp, verwarf 1835 in Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde nicht nur Tell, sondern auch den Rest der Befreiungslegende, wie sie v. Müller, Zschokke und andere besungen hatten, die der Urschweiz durch Herkunft und Mentalität viel ferner standen als Kopp. Seine Quelle war nicht mehr die ältere Historiografie, sondern das Archiv mit seinen Urkunden. Das entsprach der Verwissenschaftlichung der Geschichtsschreibung, wie sie vor allem in Deutschland betrieben wurde und die jede Epoche, mit Leopold von Ranke gesprochen, als «unmittelbar zu Gott» betrachtete. Das galt auch für das Mittelalter, das Kopp nicht nationalgeschichtlich auf eine Gründungsphase der Schweiz reduzieren wollte. Zu den Urkunden, die er edierte oder mit einem neuen Blick würdigte, gehörte auch der Bund von Uri, Schwyz und Unterwalden von 1291, dem er aber wenig Bedeutung beimass. Er zeichnete ein positives Bild von den Habsburgern, und in den mittelalterlichen Urkunden entdeckte er nicht die Vorgeschichte einer liberalen Schweiz, sondern eine offene Situation mit vielen Akteuren und zeitgebundenen, kurzfristigen Zielen.
Kopp begründete 1839 die Eidgenössischen Abschiede, die Sammlung der Beschlussprotokolle, die bei den Treffen der Eidgenossen und später der Tagsatzung angefertigt worden waren. Ein anderer Luzerner, Philipp Anton von Segesser, setzte diese Edition später fort, die als Langzeit-Editionsprojekt des Bundes schliesslich alle Abschiede bis ins Jahr 1848 umfassen sollte. Dieses Datum betrachteten die ersten Bearbeiter der Abschiede mit gemischten Gefühlen, die Alte Eidgenossenschaft dagegen nicht ohne Nostalgie. Segesser war der Anführer der katholisch-konservativen Verlierer des Sonderbundskriegs im schweizerischen Parlament und Verfasser von Werken vor allem zu Luzern, das ihm als Heimat näher stand als der neue Bundesstaat. Der Konfessionalismus und Föderalismus von Segesser und Kopp sowie ihre Bewunderung für imperiale Strukturen verweigerten sich durch den Rekurs auf sperrige Urkunden den zielgerichteten Nationalgeschichten der Liberalen. Letztere suchten in den neu greifbaren Quellen die Bestätigung dessen, was sie im Mythos vorgegeben fanden. Dessen Ursprung fanden die beiden Zürcher Historiker Gerold Meyer von Knonau und Georg von Wyss 1854 praktisch gleichzeitig im Weissen Buch von Sarnen, um sich dann über die Rolle des Entdeckers zu zerstreiten.
Von Wyss verwies zugleich die Gründungslegende der Waldstätte in das Reich der Phantasie, weil sie urkundlich nicht belegt war. Die «kritische Schule» verwirklichte sich nicht zuletzt dank Institutionen: Um die Jahrhundertmitte wurden an den jungen Universitäten historische Seminare gegründet, oft mit eigenen Professuren für die vaterländische Geschichte. Diese verdankten ihre Methode Studienjahren in Deutschland, wo der deutsche Historismus um Ranke die systematische Quellenkritik vorbildlich vermittelte. Neben kantonale traten nun nationale Gesellschaften und Zeitschriften, namentlich die Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz (1841) und ihr Jahrbuch, später die Zeitschrift für schweizerische Geschichte. Archive wurden als Teil der demokratischen Öffentlichkeit und Transparenz für das Publikum geöffnet. 1849 erhielt das 1798 gegründete Bundesarchiv in Bern seinen eindeutigen Auftrag. Manche Editionen von ungedruckten Quellen, nicht zuletzt der mittelalterlichen Chronistik, erblickten das Licht, finanziert von staatlichen Institutionen. Die Impulse waren dieselben wie in den anderen entstehenden Nationalstaaten Europas, die ihre Anfänge möglichst weit zurück ins Mittelalter verlegten. Sie wollten ihr Territorium und gegebenenfalls territoriale Ansprüche gegen aussen rechtfertigen und im Inneren eine Volksgemeinschaft postulieren, die sich nicht durch die wachsenden Klassengegensätze auseinanderdividieren liess. Ebenso wichtig war es für die Schweiz im Zeitalter der deutsch-französischen «Erbfeindschaft», die historischen Gemeinsamkeiten der verschiedenen Sprachgemeinschaften auf ihrem Territorium zu entdecken und für die «Willensnation» zu betonen.
Gerade wegen der internationalen Konkurrenz auch in den Geisteswissenschaften war Wissenschaftlichkeit gefragt. Die Historiografie wandte sich ab von der literarisch möglichst ansprechenden oder zumindest eingängigen Nacherzählung dessen, was andere Historiker schon überliefert hatten. Wichtig wurde die Erforschung von neuen Themen, die sich möglichst auf Urkunden und andere Realien aus der Untersuchungszeit stützte. Ein Winter mit niedrigem Wasserstand brachte am Zürichsee Reihen von Pfählen und andere Siedlungsreste zum Vorschein. Ferdinand Keller veröffentlichte auf dieser Grundlage 1854 Die keltischen Pfahlbauten in den Schweizerseen. Wie der Titel besagte, hatte man es bei den Pfahlbauten (die heutige Archäologen nicht mehr als solche ansehen) mit einem Phänomen zu tun, das (nur) für die «Schweiz» charakteristisch war. Zeitlich vor den Helvetiern und wissenschaftlich solider, da nicht nur bei Geschichtsschreibern belegt, trat so im jungen Bundesstaat eine nationale Urbevölkerung auf den Plan, die vor allem in populären Darstellungen ebenfalls als Projektionsfläche für helvetische Tugenden und Freiheitsliebe dienen konnte.
Als «Siegesfest der Wissenschaft» galt unter diesen Umständen, dass das Gründungsdatum 1307 für die Eidgenossenschaft, das Tschudi und nach ihm v. Müller überliefert hatten, dem Jahr 1291 weichen musste, dem frühesten urkundlichen Beleg für den Bund der Waldstätte.31 Dass dieser der – zudem «ewige» – Kern war, aus dem die Eidgenossenschaft durch Anschlüsse entstand, übernahm allerdings die liberale Geschichtsschreibung, die um 1891 neue Synthesen vorlegte. Drei befreundete reformierte Freisinnige aus der östlichen Schweiz akzeptierten die Resultate der «kritischen Schule» um Kopp, wollten aber zugleich in positivem Sinn umfassende Darstellungen der Nationalgeschichte schaffen: Karl Dändliker (Geschichte der Schweiz, 1883-84), Johannes Dierauer (Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1887–1917; auf Französisch übersetzt 1910–1913) und Wilhelm Oechsli (Die Anfänge der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1891). Oechslis Werk wurde begleitet von einer verfassungsgeschichtlichen Studie zu den Bundesverfassungen. Sie stammte aus der Feder von Carl Hilty, der die Schweizergeschichte als «Sittenlehre in nationalhistorischem Gewand» betrachtete, die sich nicht nur über die «bloss legendäre Darstellung», sondern auch über die «unfruchtbare Gelehrsamkeit» erheben müsse, also über die kritische und insofern destruktive Schule, als sie den «längst vergangenen Dingen» kein neues Leben einhauche. Als Moral aus der von Hegel inspirierten Fortschrittsgeschichte, welche den schweizerischen, politischen Volksgeist über die blosse Bluts- und Sprachgemeinschaft der anderen Nationen erhob, postulierte Hilty für Zeitgenossen und Nachfahren: «Die politische Selbständigkeit eines freiheitlich organisierten Volkes ist jedem anderen Gute für immer vorzuziehen».32
In einer Zeit, in der nationale Schlachtenfeiern wie in Sempach (1886) Aufsehen erregten und in Zürich das Schweizerische Landesmuseum mit Ferdinand Hodlers Marignano-Fresken eingeweiht wurde (1898), unterzogen sich die Historiker dem volkspädagogischen Auftrag unterschiedlich stark. Dändliker versuchte, die Wissenschaft mit der volkstümlichen Überlieferung auf der Suche nach dem «Geist der Freiheit und Volksherrschaft» in Übereinstimmung zu bringen. Er weigerte sich, «alles Hergebrachte zu negiren», sondern beliess der Legende ihre Berechtigung, wenn er einen historischen Kern erkennen konnte.33 Den Befreiungssagen am entferntesten stand Dierauer, der auf der Basis der Eidgenössischen Abschiede eine nüchterne und präzise Ereignisgeschichte vorlegte, die sich patriotischen Bedürfnissen verweigerte, wenn diese die «sorglose Überlieferung des Volkes» nachsichtig behandelte.34 Diese Strenge war geboten, denn Dierauers Bände erschienen in einer deutschen Reihe zur Geschichte der europäischen Staaten neben vielen anderen Nationalgeschichten, sodass er sich an internationalen Standards messen lassen musste. Oechsli verwarf die Befreiungslegende ebenfalls, deutete aber die mittelalterlichen Schlachten mit klarem Gegenwartsbezug als Kampf von «Bürgern und Bauern» gegen die Adelsmacht.35 Erneut am stärksten bei Dändliker, aber allen gemeinsam war der kritische Blick auf das Ancien Régime als einer Zeit der konfessionellen Konflikte, der aristokratischen Willkür und politischer Fremdbestimmung. Der Bundesstaat erschien in diesen Fortschrittsnarrativen einerseits als Verwirklichung aufklärerisch-liberaler Postulate, andererseits aber auch als Rückkehr zur Anerkennung und zum Respekt, den die mittelalterlichen Eidgenossen erfahren hatten. Diese Geschichtsvision wirkte nicht zuletzt über Popularisierungen wie jene von Johannes Sutz, Schweizer Geschichte für das Volk erzählt (1899), oder Emil Frey, Die Kriegstaten der Schweizer dem Volk erzählt (1904). Freys Schilderung, «wie die wetterharten Bauern und Hirten des schweizerischen Berglandes um ihrer Freiheit willen zum Schwert greifen», war programmatisch für ein Genre, das in der mehrbändigen Schweizer Kriegsgeschichte (1915–1923) ihren Höhepunkte erlebte: Auf Anregung des Generalstabschefs der Armee stellten führende Historiker die Entwicklung von den Helvetiern bis 1914 aus der militärischen Perspektive dar.36
Das gemässigt freisinnige Geschichtskonzept, insbesondere Oechslis Fixierung von 1291 als Gründungsdatum, integrierten an zentraler, staatsbegründender Stelle die katholisch-konservativen Verlierer des Sonderbundskriegs, also namentlich die «Urschweiz». Die Sieger von 1847/48 erkannten ihnen diesen Ehrentitel zu und orchestrierten damit den 1891 erfolgten Eintritt der Katholisch-Konservativen in den Bundesrat. Ebenfalls im historischen Umfeld zu verstehen ist die Geschichte der schweizerischen Neutralität des Zürcher Staatsarchivars Paul Schweizer. Er reagierte damit 1895 auf die Wohlgemuth-Krise, einen Spionagefall, der Bismarck zu Ausfällen gegen die Schweiz und ihre aussenpolitische Maxime veranlasste. Im Bemühen, sie auch historisch zu legitimieren, deutete Schweizer nach intensiven Archivrecherchen die frühesten Belege etwa für das «Stillesitzen» als eidgenössische Form der Neutralität.
Die liberale Geschichtsvision erlebte Fortsetzungen und Aktualisierungen etwa durch den Zürcher Professor Ernst Gagliardi, wogegen die konkurrierenden politischen Lager sie kaum in Frage stellten. Die katholisch-konservativen Historiker mochten keine alternative Perspektive auf die Nationalgeschichte entwerfen. Autoren der mit Geschichtslehrstühlen gut ausgestatteten Universität Freiburg, namentlich Joseph Hürbin (Handbuch der Schweizer Geschichte, 1900/06) oder Gaston Castella (Histoire de la Suisse, 1928), setzten nur bei konfessionellen Themen andere Duftnoten als ihre reformierten Vorläufer um Dierauer. Die meisten katholischen Historiker blieben wie der Nidwaldner Robert Durrer in ihrem föderalistisch-konfessionellen Lagerdenken auf Figuren wie Bruder Klaus und Carlo Borromeo ausgerichtet. Eine Ausnahme war allein die reaktionär-ständestaatliche Geschichtsvision des Freiburger Patriziers Gonzague de Reynold (La démocratie et la Suisse, 1929). Auf der Linken schrieb der Sozialdemokrat Robert Grimm seine Geschichte der Schweiz in ihren Klassenkämpfen nicht auf der Grundlage eigener Forschungen, sondern 1920 während seiner Haft nach dem Landesstreik. Er stützte sich vor allem auf Dändliker und Dierauer, doch betonte Grimm gegen die harmonisierende Sicht der Nationalgeschichte die vielen, oft gewaltsamen Konflikte als Motor der emanzipatorischen Entwicklung. Dazu zählte der Kampf der «Bauern» um 1300 gegen den «Adel», worin Grimm die liberale und konservative Narration übernahm. Auf eigenen Forschungen beruhte die Geschichte der Schweiz (1941) von Grimms Parteigenossen, dem Historiker und Nationalrat Valentin Gitermann. Es war ein aussergewöhnlicher Blick «ohne beschönigende Retouchen» auf die Nation, insofern der jüdische Flüchtling erst fünfjährig aus der Ukraine in die Schweiz gelangt war. Sein ausgewogenes Werk erntete neben Anerkennung auch scharfe Kritik, weil es nicht in der schweizerischen Geschichtsforschung wurzle und er die bündische Ausbildung des christlichen Volksstaats im Mittelalter nur eilig behandelt habe.37 Gitermanns materialistischer Ansatz, der grossen Persönlichkeiten sowie der Militär- und Geistesgeschichte wenig Raum widmete, galt als linke Methode. Das erklärt die Randstellung, welche die Wirtschafts- und Sozialgeschichte beibehielt, obwohl durchaus liberale Historiker wie William Rappard, Eduard Fueter oder Hans Nabholz in diesen Bereichen schweizergeschichtliche Beiträge leisteten. Sie verfassten allerdings keine Gesamtdarstellungen, und Erstere beide schrieben mit einem klaren Fokus nicht auf die mittelalterlichen Anfänge, sondern auf den Bundesstaat seit 1848.
Die Westschweizer schauten zwar gelegentlich mit föderalistischem Misstrauen, aber nach den Verwerfungen, die es im Ersten Weltkrieg zwischen den Sprachgruppen gegeben hatte, insgesamt sehr wohlwollend auf die Entwicklung vom Staatenbund zum und im liberalen Bundesstaat, der ihre Autonomie garantierte. Im Unterschied zu den Deutschschweizern beschrieben die Vertreter der Minderheit eher die Ausbildung staatlicher Strukturen in ihrem internationalen Umfeld denn die Entfaltung einer Nation aus sich selbst heraus. Von einem französischen «Joch» nach 1798 sprach aber auch der Journalist William Martin in seiner Histoire de la Suisse: Essai sur la formation d’une confédération d’états, die erstmals 1928 erschien und danach sehr oft neu aufgelegt wurde, für die neuere Zeit mit Ergänzungen von Pierre Béguin. Ähnliches gilt für die vielfach nachgedruckte Histoire de la Suisse (1944) von Charles Gilliard. Der liberal-reformierten, aber auch einer konservativ bernischen Tradition verpflichtet war die «Viermännergeschichte» von Hans Nabholz, Leonhard von Muralt, Richard Feller und Edgar Bonjour, womit erstmals Spezialisten die unterschiedlichen Epochenbeiträge schrieben. Nabholz war von diesen Autoren methodisch am differenziertesten und akzeptierte zwar die sagenhafte Überlieferung als «Verkörperung der Freiheitsidee», doch war ihm klar: «Unsere Darstellung von der Entstehung der Eidgenossenschaft weicht stark von dem Bilde ab, das jeder Schweizer von diesen Vorgängen lebendig vor Augen hat und das sich von Generation zu Generation weitervererbt.»38
Die Formulierungen zeigten bereits die Ausrichtung auch der Historikerzunft auf die Geistige Landesverteidigung der 1930er-Jahre. Die Diskrepanz zwischen dem Forschungsstand und den volkstümlichen Vorstellungen von der Schweizergeschichte war ihr bewusst. Doch der Appell an Freiheit und Opferbereitschaft hatte nichts Theoretisches, wenn ein völkisches Grossdeutschland im Norden drohte, von Süden der faschistische Irredentismus, der alle Italienischsprachigen in einem Staat vereinen wollte. Die Rede vom «Sonderfall» erfüllte nun eine existentielle Aufgabe. Sie legitimierte einen Staat, dessen Gemeinschaft nicht Blut und Sprache definierten, sondern Geschichte und, in Ernest Renans Worten, das alltägliche Plebiszit der Bürger. Die Einheit in der Vielfalt war in der Argumentation des federführenden Bundesrats Philipp Etter das Wichtigste: Viersprachigkeit, kulturelle Mittlerrolle, föderalistische Bundesstruktur, Gemeindeautonomie und Menschenwürde in einem christlichen Sinn. Gegenüber diesem Erbe der Alten Eidgenossenschaft traten die Errungenschaften von 1848 zurück: parlamentarische Demokratie, individuelle Freiheit und Gleichheit, eine liberale Wirtschaftsordnung. Definiert wurde der Sonderfall aussenpolitisch damit nicht nur in Abgrenzung zu den rechten und linken Totalitarismen, sondern auch zu den demokratisch legitimierten Volksfrontregimes in Frankreich und Spanien und den angloamerikanischen Modellen.
In gewisser Hinsicht hatte die schweizerische Historikerzunft Glück. Einer der Ihren, der Luzerner Katholik Karl Meyer, glaubte selbst an das, was er mit der Autorität eines Professors in Zürich verkündete: Die Befreiungserzählung einschliesslich der Tellensage war nicht Legende, sondern wahre Geschichte, und der einstige Widerstand genossenschaftlicher Kommunen gegen den fremden Adel gab das Modell für die Verteidigung des demokratischen Sonderfalls in der gegenwärtigen Bedrohung ab.39 Ähnlich erklärte der erwähnte Robert Durrer 1934 Winkelried gegen die «Pseudokritik des 19. Jahrh.» wieder zur historischen Figur.40 Dieser Rückschritt hinter Kopps hundert Jahre zuvor etablierte Quellenkritik provozierte klaren Widerspruch von fachkundigen Kollegen. Allein, Meyers Darlegungen fügten sich gut in die politische und gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass die Vergangenheit Identität und Kontinuität stiften solle. 1941 beging der Bundesrat in diesem Geist zusammen mit General Guisan den 650. Geburtstag der Schweiz im kurz zuvor eingeweihten Schwyzer Bundesbriefarchiv, um in den ernsten Stunden die Verpflichtung gegenüber den Ahnen und ihr Vorbild zivil und religiös zu unterstreichen.
Die biografische Erfahrung der Kriegsjahre und vor allem des militärischen Aktivdiensts prägte die grosse Zahl von schweizergeschichtlichen Texten, die nach 1945 verfasst wurden und sich oft an ein weiteres Publikum wandten, so die Schriften von Georg Thürer, eines Schülers von Karl Meyer (Bundesspiegel. Werdegang und Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1948). Es fällt auf, dass viele der Autoren nach oder neben ihrer historiografischen Tätigkeit politische Ämter übernahmen und sich somit in doppelter Hinsicht vaterländisch-gouvernemental betätigten. Gottfried Guggenbühl (Geschichte der Schweizer Eidgenossenschaft, 1947/48) war Zürcher Erziehungsrat; Peter Dürrenmatt (Schweizer Geschichte, 1957)vertrat den Kanton Basel-Stadt im Nationalrat; von den Autoren der wiederholt aufgelegten Illustrierten Geschichte der Schweiz (1958–1961) wirkte Karl Schib kurz als Kantonsrat und Sigmund Widmer als langjähriger Stadtpräsident von Zürich. Sie fügten sich in eine lange Reihe von Parlamentariern und Bundesräten ein, die Werke zur kantonalen oder nationalen Geschichte verfassten, wenn auch nicht unbedingt Gesamtdarstellungen. Bei den Bundesräten führte diese Tradition von Emil Freys erwähnten Kriegstaten der Schweizer (1904) über Markus Feldmann, den Koordinator der genannten Schweizer Kriegsgeschichte (1915–1923), bis Georges-André Chevallaz (Le défi de la neutralité, 1995, deutsch 1997).41 Vom Widerstandsgeist gegen den italienischen Faschismus und Irredentismus geprägt waren Guido Calgari und Mario Agliati, die 1969 eine Storia della Svizzera vorlegten.
Ihre Hauptwirkung verdankte die Nationalgeschichte, welche die Geistige Landesverteidung der 1930er-Jahre in den Kalten Krieg transportierte, allerdings weniger der Geschichtsschreibung, selbst wenn sie volkstümlich präsentiert wurde, als dem Schulunterricht und den pädagogischen Schriften etwa des Schweizerischen Jugendschriftenwerks SJW (so 650 Jahre Eidgenossenschaft, 1941). Der Lehrplan für die Berner Primarschulen, der von 1947 bis 1982 gültig war, hielt fest: «Die nationale Aufgabe erfüllt der Geschichtsunterricht in unserem Vaterlande dann, wenn er zum guten Eidgenossen erziehen hilft. Zum guten Eidgenossen gehört das eidgenössische Bewusstsein. Dieses beruht auf einer gewissen Kenntnis der Wesenszüge unseres Staates und unserer Geschichte, aber auch auf einem Empfinden der Unterschiede zwischen uns und den andern.»42 In einem für den Schulunterricht verfassten Buch, Wir wollen frei sein wie die Väter waren, forderte Franz Meyer 1961, den historischen Vorbildern zu folgen: «Auch wir sind bereit, für unser Vaterland Opfer zu bringen, für das Heimatland auf etwas zu verzichten, dem Lande einen Dienst zu erweisen und für die Heimat zu beten. Nur so verdienen wir es, in einem freien Lande leben zu dürfen.» Meyer rettete die mittelalterlichen Legenden zumindest in ihrem didaktischen Kern: «Wir wissen, dass die mündliche Überlieferung Fehler und Ungenauigkeiten enthalten kann. […] Und trotzdem sind diese Geschichten wahr. Das Volk der Hirten stand auf, starke Landammänner führten es, und mutige Helden setzten ihr Leben ein für die Freiheit dieses Volkes.»43 In der Wissenschaft waren solche Positionen nicht mehr haltbar, nachdem der Zürcher Professor Marcel Beck das Vorgehen Karl Meyers und seiner Schule zerzaust hatte. Der Beck-Schüler und Schriftsteller Otto Marchi popularisierte den Kenntnisstand 1971 mit seiner Schweizer Geschichte für Ketzer.
In der Schule dagegen machte die heroische Verteidigung der Freiheit gegen die Habsburger und andere fremde Bedrohungen lange den Hauptteil des schweizergeschichtlichen Unterrichts aus. Die Moral aus der Masslosigkeit der Söldner und der Niederlage von Marignano war die Neutralität, die als aussenpolitischer Grundzug danach die Narration bestimmte, unterbrochen nur durch Napoleon, der die «Franzosenzeit» um 1800 repräsentierte. Die internen Gegensätze wurden gleichsam von der harmonischen Versöhnung her erzählt und aufgefangen: vom Stanser Verkommnis bis zum «Friedensabkommen» in der Metallindustrie von 1937. Die schweizergeschichtlichen Schulbücher begannen sich erst seit den 1970er-Jahren allmählich zu ändern. Die Schweiz wurde als Teil ihrer europäischen Umwelt vorgestellt, ihre Vergangenheit nicht auf das Militärische reduziert, und bei der Behandlung der Helvetik (1798–1803) kamen nun auch positive Aspekte zur Sprache.44