Der Zauberberg. Volume 2
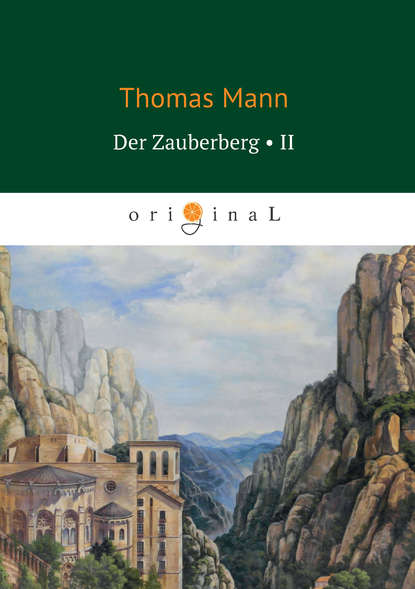
- -
- 100%
- +
"Sie verlangen wohl, daß ich Idealismus oder gar Religiosität darin erblicke? Es handelt sich um letzte, schwächliche Regun-gen des Restes von Selbsterhaltungsinstinkt, über den ein verur-teiltes Weltsystem noch verfügt. Die Katastrophe soll und muß kommen, sie kommt auf allen Wegen und auf alle Weise. Neh-men Sie die britische Staatskunst. Englands Bedürfnis, das indi-sche Glacis zu sichern, ist legitim. Aber die Folgen? Eduard weiß so gut wie Sie und ich, daß die Machthaber von Petersburg die mandschurische Scharte auswetzen müssen und die Ableitung der Revolution so notwendig brauchen wie das liebe Brot. Trotzdem lenkt er – er muß es wohl! – den russischen Ausdehnungsdrang nach Europa, weckt eingeschlummerte Riva-litäten zwischen Petersburg und Wien –"
"Ach, Wien! Sie sorgen sich um dieses Welthindernis, ver-mutlich, weil Sie in dem morschen Imperium, dessen Haupt es ist, die Mumie des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation erkennen!"
"Und Sie finde ich russophil, vermutlich aus humanistischer Sympathie mit dem Cäsaro-Papismus."
"Mein Herr, die Demokratie hat selbst vom Kreml mehr zu hoffen, als von der Hofburg, und es ist eine Schande für das Land Luthers und Gutenbergs –"
"Es ist außerdem wahrscheinlich eine Dummheit. Aber auch diese Dummheit ist ein Werkzeug der Fatalität –"
"Ach, gehen Sie mir mit der Fatalität! Die menschliche Ver-nunft braucht sich nur stärker zu wollen als die Fatalität, und sie ist es?"
"Gewollt wird immer nur das Schicksal. Das kapitalistische Europa will das seine."
"Man glaubt an das Kommen des Krieges, wenn man ihn nicht hinlänglich verabscheut!"
"Ihre Abscheu ist logisch abrupt, solange Sie ihn nicht beim Staate selbst beginnen lassen."
"Der nationale Staat ist das Prinzip des Diesseits, das Sie dem Teufel zuschreiben möchten. Machen Sie aber die Nationen frei und gleich, schützen Sie die – kleinen und schwachen vor Unter-drückung, schaffen Sie Gerechtigkeit, schaffen Sie nationale Grenzen …"
"Die Brennergrenze, ich weiß. Die Liquidation Österreichs. Wenn ich nur wüßte, wie Sie sie ohne Krieg zu bewerkstelligen gedenken!"
"Und ich wüßte wahrhaftig gern, wann jemals ich den nationalen Krieg verdammt haben soll."
"Ich höre doch wohl –"
"Nein, das muß ich Herrn Settembrini bestätigen", mischte sich Hans Castorp in den Disput, dem er im Gehen gefolgt war, indem er den jeweils Sprechenden mit schrägem Kopfe auf-merksam von der Seite betrachtet hatte. "Mein Vetter und ich haben ja schon manchmal den Vorzug gehabt, uns mit ihm über diese und ähnliche Dinge zu unterhalten, das heißt, natürlich lief es darauf hinaus, daß wir ihm zuhörten, wie er seine Mei-nungen entwickelte und alles klarstellte. Und da kann ich denn bestätigen, und auch mein Vetter hier wird sich daran erinnern, daß Herr Settembrini mehr als einmal mit großer Begeisterung von dem Prinzip der Bewegung und der Rebellion und der Weltverbesserung sprach, das ja an sich kein so ganz friedliches Prinzip ist, sollte ich meinen, und daß diesem Prinzip noch gro-ße Anstrengungen bevorständen, ehe es überall gesiegt haben werde und die allgemeine glückliche Weltrepublik stattfinden könne. Das waren seine Worte, wenn sie auch natürlich viel pla-stischer und schriftstellerischer waren als meine, das versteht sich von selbst. Was ich aber ganz genau weiß und wörtlich be-halten habe, weil ich als ausgepichter Zivilist direkt etwas dar-über erschrak, das war, daß er sagte, dieser Tag werde, wenn nicht auf Taubenfüßen, so auf Adlerschwingen kommen (über die Adlerschwingen erschrak ich, wie ich mich erinnere), und Wien müsse aufs Haupt geschlagen sein, wenn man das Glück in die Wege leiten wolle. Man kann also nicht sagen, daß Herr Settembrini den Krieg überhaupt verworfen hat. Habe ich recht, Herr Settembrini?"
"Ungefähr", sagte der Italiener kurz, indem er abgewandten Kopfes seinen Stock schwenkte.
"Schlimm", lächelte Naphta häßlich. "Da sind Sie von Ihrem eigenen Schüler kriegerischer Neigungen überführt. Assument pennas ut aquilae …"
"Voltaire selbst hat den Zivilisationskrieg bejaht und Fried-rich dem Zweiten den Krieg gegen die Türken empfohlen."
"Statt dessen verbündete er sich mit ihnen, he, he. Und dann die Weltrepublik! Ich unterlasse es, mich zu erkundigen, was aus dem Prinzip der Bewegung und der Rebellion wird, wenn das Glück und die Vereinigung hergestellt sind. In diesem Augen-blick würde die Rebellion zum Verbrechen …"
"Sie wissen sehr wohl, und auch diese jungen Herren wissen es, daß es sich um einen als unendlich gedachten Fortschritt der Menschheit handelt."
"Alle Bewegung ist aber kreisförmig", sagte Hans Castorp. "Im Raum und in der Zeit, das lehren die Gesetze von der Er-haltung der Masse und von der Periodizität. Mein Vetter und ich sprachen vorhin noch davon. Kann denn bei geschlossener Bewegung ohne Richtungsdauer von Fortschritt die Rede sein? Wenn ich abends so liege und den Zodiakus betrachte, das heißt: die Hälfte, die zu sehen ist, und an die alten weisen Völ-ker denke …"
"Sie sollten nicht grübeln und träumen, Ingenieur", unterbrach ihn Settembrini, "sondern sich entschlossen den Instink-ten Ihrer Jahre und Ihrer Rasse anvertrauen, die Sie zur Tätigkeit drängen müssen. Auch Ihre naturwissenschaftliche Bildung muß Sie der Fortschrittsidee verbinden. Sie sehen in ungemessenen Zeiträumen das Leben vom Infusor zum Menschen sich fort-und emporentwickeln, Sie können nicht zweifeln, daß dem Menschen noch unendliche Vervollkommnungsmöglichkeiten offen stehen. Versteifen Sie sich denn aber auf die Mathematik, so führen Sie Ihren Kreislauf von Vollkommenheit zu Voll-kommenheit und erquicken Sie sich an der Lehre unseres acht-zehnten Jahrhunderts, daß der Mensch ursprünglich gut, glück-lich und vollkommen war, daß nur die gesellschaftlichen Irrtü-mer ihn entstellt und verdorben haben, und daß er auf dem Wege kritischer Arbeit am Gesellschaftsbau wieder gut, glück-lich und vollkommen werden soll, werden wir –"
"Herr Settembrini versäumt, hinzuzufügen", fiel Naphta ein, "daß das Rousseausche Idyll eine vernünftlerische Verballhornung der kirchlichen Doktrin von der ehemaligen Staat – und Sündlosigkeit des Menschen ist, seiner ursprünglichen Gottes-unmittelbarkeit und Gotteskindschaft, zu der er zurückkehren soll. Die Wiederherstellung des Gottesstaates nach Auflösung aller irdischen Formen liegt aber dort, wo Erde und Himmel, Sinnliches und Übersinnliches sich berühren, das Heil ist trans-zendent, und was Ihre kapitalistische Weltrepublik anbelangt, lieber Doktor, so ist es recht sonderbar, Sie in diesem Zusam-menhang von 'Instinkt' reden zu hören. Das Instinktive ist durchaus auf Seiten des Nationalen, und Gott selbst hat den Menschen den natürlichen Instinkt eingepflanzt, der die Völker veranlaßt hat, sich in verschiedenen Staaten voneinander zu sondern. Der Krieg …"
"Der Krieg", rief Settembrini, "selbst der Krieg, mein Herr, hat schon dem Fortschritt dienen müssen, wie Sie mir einräu-men werden, wenn Sie sich gewisser Ereignisse aus Ihrer Lieb-lingsepoche, ich meine: wenn Sie sich der Kreuzzüge erinnern! Diese Zivilisationskriege haben die Beziehungen der Völker im wirtschaftlichen und handelspolitischen Verkehr aufs glücklich-ste begünstigt und die abendländische Menschheit im Zeichen einer Idee vereinigt."
"Sie sind sehr duldsam gegen die Idee. Desto höflicher will ich Sie dahin berichtigen, daß die Kreuzzüge nebst der Ver-kehrsbelebung, die sie zeitigten, nichts weniger als international ausgleichend gewirkt haben, sondern im Gegenteil die Völker lehrten, sich voneinander zu unterscheiden, und die Ausbildung der nationalen Staatsidee kräftig förderten."
"Sehr zutreffend, soweit das Verhältnis der Völker zur Kleri-sei in Frage kommt. Ja! damals begann das Gefühl staatlich na-tionaler Ehre sich gegen hierarchische Anmaßungen zu festi-gen …"
"Und dabei ist, was Sie hierarchische Anmaßung nennen, nichts als die Idee menschlicher Vereinigung im Zeichen des Geistes!"
"Man kennt diesen Geist, und man bedankt sich."
"Es ist klar, daß Ihre nationale Manie den weltüberwindenden Kosmopolitismus der Kirche verabscheut. Wenn ich nur wüßte, wie Sie den Abscheu vor dem Kriege damit zu vereinigen gedenken. Ihr antikisierender Staatskult muß Sie zum Ver-fechter positiver Rechtsauffassung machen, und als solcher …"
"Sind wir beim Recht? Im Völkerrecht, mein Herr, bleibt der Gedanke des Naturrechtes und allmenschlicher Vernunft leben-dig …"
"Pah, Ihr Völkerrecht ist abermals nichts als eine Rousseausche Verballhornung des ius divinum, das weder mit Natur noch Vernunft etwas zu schaffen hat, sondern auf Offenbarung beruht…"
"Streiten wir uns nicht um Namen, Professor! Nennen Sie ungehindert ius divinum, was ich als Natur – und Völkerrecht verehre. Die Hauptsache ist, daß über den positiven Rechten der Nationalstaaten ein höher-gültiges, allgemeines sich erhebt und die Schlichtung strittiger Interessenfragen durch Schiedsgerichte ermöglicht."
"Durch Schiedsgerichte! Wenn ich das Wort höre! Durch ein bürgerliches Schiedsgericht, das über Fragen des Lebens ent-scheidet, Gottes Willen ermittelt und die Geschichte bestimmt! Gott, soviel von den Taubenfüßen. Und wo bleiben die Adler-schwingen?"
"Die bürgerliche Gesittung –"
"Ei, die bürgerliche Gesittung weiß nicht, was sie will! Da schreien sie nach Bekämpfung des Geburtenrückganges, fordern, daß die Kosten der Kinderaufzucht und der Berufsvorbereitung verbilligt werden. Und dabei erstickt man im Gedränge, und al-le Berufe sind so überfüllt, daß der Kampf um den Eßnapf an Schrecken alle Kriege der Vergangenheit in den Schatten stellt. Freie Plätze und Gartenstädte! Ertüchtigung der Rasse! Aber wozu Ertüchtigung, wenn die Zivilisation und der Fortschritt wollen, daß kein Krieg mehr sei? Der Krieg wäre das Mittel ge-gen alles und für alles. Für die Ertüchtigung und sogar gegen den Geburtenrückgang."
"Sie scherzen. Das ist nicht mehr ernst. Unser Gespräch löst sich auf und tut es im rechten Augenblick. Wir sind zur Stelle", sagte Settembrini und zeigte den Vettern das Häuschen, vor dessen Zaunpforte sie hielten, mit dem Stock. Es lag nahe dem Eingang von "Dorf" an der Straße, von der nur ein schmales Vorgärtchen es trennte, und war bescheiden. Wilder Wein schwang sich aus bloßliegenden Wurzeln um die Haustür und streckte einen gebogenen, an die Mauer geschmiegten Arm gegen das ebenerdige Fenster zur Rechten hin, das Schaufenster eines kleinen Kramladens. Das Erdgeschoß sei des Krämers, er-klärte Settembrini. Naphtas Logis befinde sich eine Treppe hoch in der Schneiderei, und er selbst domiziliere im Dach. Es sei ein friedliches Studio.
Mit überraschend hervorgekehrter Liebenswürdigkeit gab Naphta der Hoffnung Ausdruck, daß weitere Begegnungen aus dieser folgen möchten. "Besuchen Sie uns", sagte er. "Ich würde sagen: Besuchen Sie mich, wenn Dr. Settembrini hier nicht ältere Rechte auf Ihre Freundschaft hätte. Kommen Sie, wann Sie wollen, sobald Sie Lust zu einem kleinen Kolloquium haben. Ich schätze den Austausch mit der Jugend, bin auch vielleicht nicht ohne alle pädagogische Überlieferung … Wenn unser Meister vom Stuhl" (er deutete auf Settembrini) "alle pädagogische Aufgelegtheit und Berufung dem bürgerlichen Humanis-mus vorbehalten will, so muß man ihm widersprechen. Auf bald also!"
Settembrini machte Schwierigkeiten. Es bestünden solche, sagte er. Die Tage des Leutnants hier oben seien gezählt, und der Ingenieur werde seinen Eifer im Kurdienst verdoppeln wollen, um ihm sehr bald in die Ebene nachfolgen zu können.
Die jungen Leute stimmten beiden zu, dem einen nach dem andern. Sie hatten Naphtas Einladung mit Verbeugungen aufge-nommen und erkannten im nächsten Augenblick die Bedenken Settembrinis mit Kopf und Schultern als berechtigt an. So blieb alles offen.
"Wie hat er ihn genannt?" fragte Joachim, als sie die Weg-schleife zum "Berghof" emporstiegen …
"Ich habe 'Meister vom Stuhl' verstanden", sagte Hans Ca-storp, "und denke auch eben darüber nach. Es ist wohl irgend so ein Witz; sie haben ja sonderbare Namen füreinander. Settembrini nannte Naphta 'princeps scholasticorum', – auch nicht übel. Die Scholastiker, das waren ja wohl die Schriftgelehrten des Mittelalters, dogmatische Philosophen, wenn du willst. Vom Mittelalter war ja denn auch verschiedentlich die Rede, – wobei mir einfiel, wie Settembrini gleich am ersten Tage sagte, es mute manches mittelalterlich an bei uns hier oben: wir ka-men darauf durch Adriatica von Mylendonk, durch den Namen. – Wie hat er dir gefallen?"
"Der Kleine? Nicht gut. Er sagte manches, was mir gefiel. Schiedsgerichte sind natürlich eine Duckmäuserei. Aber er selbst hat mir wenig gefallen, und da kann einer noch so viel Gutes sagen, was habe ich davon, wenn er selbst ein zweifelhafter Kerl ist. Und zweifelhaft ist er, das kannst du nicht leugnen. Allein schon die Geschichte mit dem 'Orte der Beiwohnung' war entschieden bedenklich. Und dabei hat er ja eine Judenna-se, sieh ihn dir doch an! So miekerig von Figur sind auch immer nur die Semiten. Hast du denn ernstlich vor, den Mann zu be-suchen?"
"Selbstverständlich werden wir ihn besuchen!" erklärte Hans Castorp. "Die Miekerigkeit, – das ist nur das Militär, das da aus dir spricht. Aber die Chaldäer hatten auch solche Nasen und waren doch höllisch auf dem Posten, nicht bloß in den Ge-heimwissenschaften. Naphta hat auch was von Geheimwissenschaft, er interessiert mich nicht wenig. Ich will auch nicht be-haupten, daß ich heute schon klug aus ihm geworden bin, aber wenn wir öfter mit ihm zusammenkommen, so werden wir es vielleicht, und ich halte es gar nicht für ausgeschlossen, daß wir überhaupt klüger werden bei dieser Gelegenheit."
"Ach, Mensch, du wirst ja immer klüger hier oben, mit dei-ner Biologie und Botanik und deinen unhaltbaren Wendepunkten. Und mit der 'Zeit' hattest du es gleich am ersten Tage zu tun. Und dabei sind wir doch hier, um gesünder, und nicht um gescheiter zu werden, – gesünder und ganz gesund, damit sie uns endlich in Freiheit setzen und als geheilt ins Flachland ent-lassen können!"
"Auf den Bergen wohnt die Freiheit!" sang Hans Castorp leichtsinnig. "Sage mir erst mal, was Freiheit ist", fuhr er sprechend fort. "Naphta und Settembrini stritten vorhin ja auch dar-über und kamen zu keiner Einigung. "Freiheit ist das Gesetz der Menschenliebe!' sagt Settembrini, und das klingt nach seinem Vorfahren, dem Carbonaro. Aber so tapfer der Carbonaro war, und so tapfer unser Settembrini selber ist…"
"Ja, er wurde ungemütlich, als auf persönlichen Mut die Rede kam."
" … so glaube ich doch, daß er vor manchem Angst hat, wo-vor der kleine Naphta nicht Angst hat, verstehst du, und daß seine Freiheit und Tapferkeit ziemlich etepetete sind. Meinst du, daß er Mut genug hätte, de se perdre ou même de se laisser dé-périr?"
"Was fängst du an, französisch zu sprechen?"
"Nur so … Die Atmosphäre hier ist ja so international. Ich weiß nicht, wer mehr Gefallen daran finden müßte: Settembrini, von wegen der bürgerlichen Weltrepublik, oder Naphta mit seinem hierarchischen Kosmopolis. Ich habe scharf aufgepaßt, wie du siehst, aber klar ist die Sache mir nicht geworden, ich fand im Gegenteil, die Konfusion war groß, die herauskam bei ihren Reden."
"Das ist immer so. Das wirst du immer so finden, daß bloß Konfusion herauskommt beim Reden und Meinungen haben, Ich sage dir ja, es kommt überhaupt nicht drauf an, was für Meinungen einer hat, sondern darauf, ob einer ein rechter Kerl ist. Am besten ist, man hat gleich gar keine Meinung, sondern tut seinen Dienst."
"Ja, so kannst du sagen, als Landsknecht und rein formale Existenz, die du bist. Bei mir ist es was andres, ich bin Zivilist, ich bin gewissermaßen verantwortlich. Und mich regt es auf, solche Konfusion zu sehen, wie daß der eine die internationale Weltrepublik predigt und den Krieg grundsätzlich verabscheut, dabei aber so patriotisch ist, daß er partout die Brennergrenze verlangt und dafür einen Zivilisationskrieg führen will, – und daß der andere den Staat für Teufelswerk hält und von der all-gemeinen Vereinigung am Horizonte flötet, aber im nächsten Augenblick das Recht des natürlichen Instinktes verteidigt und sich über Friedenskonferenzen lustig macht. Unbedingt müssen wir hingehen, um klug daraus zu werden. Du sagst zwar, wir sollen hier nicht klüger werden, sondern gesünder. Aber das muß sich vereinigen lassen, Mann, und wenn du das nicht glaubst, dann treibst du Weltentzweiung, und so was zu treiben, ist immer ein großer Fehler, will ich dir mal bemerken."
Vom Gottesstaat und von übler Erlosung
Hans Castorp bestimmte in seiner Loge ein Pflanzengewächs, das jetzt, da der astronomische Sommer begonnen hatte und die Tage kürzer zu werden begannen, an vielen Stellen wucherte: die Akelei oder Aquilegia, eine Ranunkulazeenart, die stauden-artig wuchs, hochgestielt, mit blauen und veilchenfarbnen, auch rotbraunen Blüten und krautartigen Blättern von geräumiger Fläche. Die Pflanze wuchs da und dort, massenweis aber na-mentlich in dem stillen Grunde, wo er sie vor nun bald einem Jahre zuerst gesehen: der abgeschiedenen, wildwasserdurch-rauschten Waldschlucht mit Steg und Ruhebank, wo sein voreiligfreizügiger und unbekömmlicher Spaziergang von damals geendigt hatte, und die er nun manchmal wieder besuchte.
Es war, wenn man es weniger unternehmend anfing, als er damals getan, nicht gar so weit dorthin. Stieg man vom Ziel der Schlittlrennen in "Dorf" ein wenig die Lehne hinauf, so war der malerische Ort auf dem Waldwege, dessen Holzbrücken die von der Schatzalp kommende Bobbahn überkreuzten, ohne Umwege, Operngesang und Erschöpfungspausen in zwanzig Minuten zu erreichen, und wenn Joachim durch dienstliche Pflichten, durch Untersuchung, Innenphotographie, Blutprobe, Injektion oder Gewichtsfeststellung ans Haus gefesselt war, so wanderte Hans Castorp wohl bei heiterer Witterung nach dem zweiten Frühstück, zuweilen auch schon nach dem ersten dort-hin, und auch die Stunden zwischen Tee und Abendessen be-nutzte er wohl zu einem Besuch seines Lieblingsortes, um auf der Hank zu sitzen, wo ihn einst das mächtige Nasenbluten überkommen, dem Geräusche des Gießbachs mit schrägem Kopfe zu lauschen und das geschlossene Landschaftsbild um sich her zu betrachten, sowie die Menge von blauer Akelei, die nun wieder in ihrem Grunde blühte.
Kam er nur dazu? Nein, er saß dort, um allein zu sein, um sich zu erinnern, die Eindrücke und Abenteuer so vieler Monate zu überschlagen und alles zu bedenken. Es waren ihrer viele und mannigfaltige, – nicht leicht zu ordnen dabei, denn sie er-schienen ihm vielfach verschränkt und ineinanderfließend, so daß das Handgreifliche kaum vom bloß Gedachten, Geträumten und Vorgestellten, zu sondern war. Nur abenteuerlichen We-sens waren sie alle, in dem Grade, daß sein Herz, beweglich, wie es hier oben vom ersten Tage an gewesen und geblieben war, stockte und hämmerte, wenn er ihrer gedachte. Oder ge-nügte bereits die Vernunftüberlegung, daß die Aquilegia hier, wo ihm einst in einem Zustand herabgesetzter Lebenstätigkeit Pribislav Hippe leibhaftig erschienen war, nicht immer noch, sondern schon wieder blühte, und daß aus den "drei Wochen" demallemächst ein rundes Jahr geworden sein würde, um sein bewegliches Herz so abenteuerlich zu erschrecken?
Übrigens bekam er kein Nasenbluten mehr auf seiner Bank am Wildwasser, das war vorbei. Seine Akklimatisation, die Joachim ihm sogleich als schwierig hingestellt und die ihre Schwierigkeit denn auch bewährt hatte, war vorgeschritten, sie mußte nach elf Monaten als vollendet gelten, und Weiterge-hendes in dieser Richtung war kaum zu gewärtigen. Der Che-mismus seines Magens hatte sich geregelt und angepaßt, Maria Mancini schmeckte, die Nerven seiner ausgetrockneten Schleimhäute kosteten längst wieder empfänglich die Blume dieses preiswerten Fabrikats, das er sich nach wie vor, wenn der Vorrat zur Neige ging, mit einer Art von Pietätsgefühl aus Bremen verschrieb, obgleich sehr einladende Ware sich in den Schaufenstern des internationalen Kurortes empfahl. Bildete Maria nicht eine Art von Verbindung zwischen ihm, dem Ent-rückten, und dem Flachlande, der alten Heimat? Unterhielt und bewahrte sie dergleichen Beziehungen nicht wirksamer, als etwa die Postkarten, die er dann und wann nach unten an die Onkel richtete, und deren Abstände voneinander in demselben Maße größer geworden waren, als er sich unter Annahme hiesiger Be-griffe eine großartigere Zeitbewirtschaftung zu eigen gemacht hatte? Es waren meistens Ansichtskarten, der größeren Gefällig-keit halber, mit hübschen Bildern des Tales im Schnee wie in sommerlicher Verfassung, und sie boten für Schriftliches nur eben soviel Raum, als nötig war, um die neueste ärztliche Ver-lautbarung zu überliefern, das Ergebnis einer Monats – oder General-untersuchung verwandtschaftlich zu melden, das heißt also: etwa mitzuteilen, daß akustisch wie optisch eine unverkennbare Besserung zu verzeichnen gewesen, daß er aber noch nicht ent-giftet sei, und daß die leichte Übertemperatur, in der er immer noch stehe, von den kleinen Stellen komme, die eben noch vorhanden seien, aber bestimmt ohne Rest verschwinden wür-den, wenn er Geduld übe, so daß er dann keinesfalls wiederzu-kommen brauche. Er durfte sicher sein, daß darüber hinausge-hende briefstellerische Leistungen von ihm nicht verlangt und erwartet wurden; es war keine humanistisch rednerische Sphäre, an die er sich wandte; die Antworten, die er erhielt, waren ebensowenig ergußhafter Art. Sie begleiteten meistens die geld-lichen Subsistenzmittel, die ihm von zu Hause zukamen, die Zinsen seines väterlichen Erbes, die sich in hiesiger Münze so vorteilhaft ausnahmen, daß er sie niemals verzehrt hatte, wenn eine neue Lieferung eintraf, und bestanden in einigen Zeilen Maschinenschrift, gezeichnet James Tienappel mit Grüßen und Genesungswünschen vom Großonkel und manchmal auch von dem seefahrenden Peter.
Die Verabfolgung der Injektionen, so meldete Hans Castorp nach Hause, hatte der Hofrat neuestens unterbrochen. Sie beka-men diesem jungen Patienten nicht, verursachten ihm Kopf-schmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme und Müdigkeit, hatten die "Temperatur" zunächst erhöht und dann nicht beseitigt. Sie glühte als trockene Hitze subjektiv fort in seiner rosen-roten Miene, als Mahnung daran, daß die Akklimatisation für diesen Sprößling der Tiefebene und ihrer feuchtfröhlichen Me-teorologie doch eben wohl hauptsächlich in der Gewöhnung daran bestand, daß er sich nicht gewöhnte, – was übrigens Rha-damanthys ja selber nicht tat, der immer blaue Backen hatte. "Manche gewöhnen sich nie", hatte Joachim gleich gesagt, und dies schien Hans Castorps Fall. Denn auch das Genickzittern, das ihn hier oben bald nach der Ankunft zu belästigen begon-nen, hatte sich nicht wieder verlieren wollen, sondern stellte sich im Gehen, im Gespräch, ja selbst hier oben am blau blü-henden Orte seines Nachdenkens über den Komplex seiner Abenteuer unvermeidlich ein, so daß ihm die würdige Kinn-stütze Hans Lorenz Castorps beinahe schon zur festen Gewohn-heit geworden war, – nicht ohne ihn selbst, wenn er sie benütz-te, an die Vatermörder des Alten, die Interimsform der Ehrenkrause, an das blaßgoldene Rund der Taufschale, an den from-men Ur-Ur-Laut und ähnliche Verwandtschaften unter der Hand zu erinnern und ihn so zum Überdenken seines Lebens-komplexes neuerdings hinzuleiten.
Pribislav Hippe erschien ihm nicht mehr leibhaftig, wie vor elf Monaten. Seine Akklimatisation war vollendet, er hatte kei-ne Visionen mehr, lag nicht mit stillgestelltem Leibe auf seiner Bank, während sein Ich in ferner Gegenwart weilte – nichts mehr von solchen Zufällen. Deutlichkeit und Lebendigkeit dieses Erinnerungsbildes, wenn es ihm denn vorschwebte, hielten sich in normalen, gesunden Grenzen, und im Zusammenhang damit zog dann Hans Castorp wohl aus seiner Brusttasche das gläserne Angebinde, das er dort in einem gefütterten Briefum-schlag und hierauf in der Brieftasche verwahrt hielt: ein Täfel-chen, das, wenn man es in gleicher Ebene mit dem Erdboden hielt, schwarz-spiegelnd und undurchsichtig schien, aber, gegen das Himmelslicht aufgehoben, sich erhellte und humanistische Dinge vorwies: das transparente Bild des Menschenleibes, Rip-penwerk, Herzfigur, Zwerchfellbogen und Lungengebläse, dazu das Schlüssel – und Oberarmgebein, umgeben dies alles von blaßdunstiger Hülle, dem Fleische, von dem Hans Castorp in der Faschingswoche vernunftwidrigerweise gekostet hatte. Was Wunder, daß sein bewegliches Herz stockte und stürzte, wenn er das Angebinde betrachtete und dann fortfuhr, "alles" zu überschlagen und zu bedenken, gelehnt an die schlicht gezim-merte Lehne der Ruhebank, die Arme gekreuzt, den Kopf zur Schulter geneigt, im Geräusche des Gießwassers und angesichts der blaublühenden Akelei?

