Der Zauberberg. Volume 2
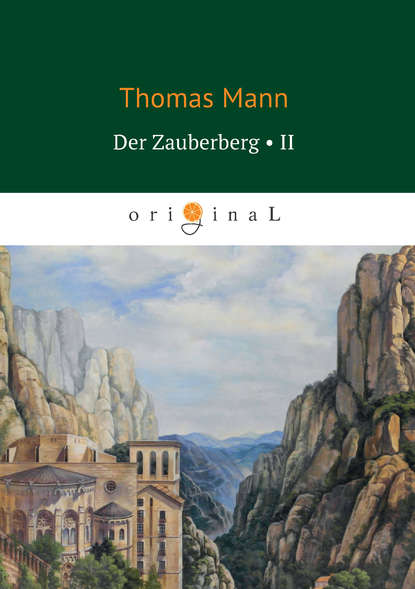
- -
- 100%
- +
Das Hochgebild organischen Lebens, die Menschengestalt, schwebte ihm vor, wie in jener Frost – und Sternennacht anläß-lich gelehrter Studien, und an ihre innere Anschauung knüpften sich für den jungen Hans Castorp so manche Fragen und Unter-scheidungen, mit denen sich abzugeben der gute Joachim nicht verpflichtet sein mochte, für die aber er als Zivilist sich verant-wortlich zu fühlen begonnen hatte, obwohl auch er im Flach-lande drunten ihrer niemals ansichtig geworden war und ver-mutlich nie ansichtig würde geworden sein, wohl aber hier, wo man aus der beschaulichen Abgeschiedenheit von fünftausend Fuß auf Welt und Kreatur hinabblickte und sich seine Gedanken machte, – vermöge einer durch lösliche Gifte erzeugten Steigerung des Körpers auch wohl, die als trockene Hitze im Antlitz brannte. Er dachte an Settembrini im Zusammenhang mit jener Anschauung, an den pädagogischen Drehorgelmann, dessen Va-ter in Hellas zur Welt gekommen, und der die Liebe zum Hochgebild als Politik, Rebellion und Eloquenz erläuterte, in-dem er die Pike des Bürgers am Altar der Menschheit weihte; dachte auch an den Kameraden Krokowski und an das, was er seit einiger Zeit im verdunkelten Zimmergelaß mit ihm trieb, besann sich über das doppelte Wesen der Analyse und wie weit sie der Tat und dem Fortschritte förderlich sei, wie weit dem Grabe verwandt und seiner anrüchigen Anatomie. Er rief die Bilder der beiden Großväter neben – und gegeneinander auf, des rebellischen und des getreuen, die Schwarz trugen aus unter-schiedlichen Gründen, und erwog ihre Würde; ging ferner mit sich zu Rate über so weitläufige Komplexe wie Form und Frei-heit, Geist und Körper, Ehre und Schande, Zeit und Ewigkeit, – und unterlag einem kurzen, aber stürmischen Schwindel bei dem Gedanken, daß die Akelei wieder blühte und das Jahr in sich selber lief.
Er hatte ein sonderbares Wort für diese seine verantwortliche Gedankenbeschäftigung am malerischen Orte seiner Zurückge-zogenheit: er nannte sie "Regieren", – gebrauchte dies Spiel-und Knabenwort, diesen Kinderausdruck dafür, als für eine Un-terhaltung, die er liebte, obwohl sie mit Schrecken, Schwindel und allerlei Herztumulten verbunden war und seine Gesichts-hitze übermäßig verstärkte. Doch fand er es nicht unschicklich, daß die mit dieser Tätigkeit verbundene Anstrengung ihn nötig-te, sich der Kinnstütze zu bedienen, denn diese Haltung stimm-te wohl mit der Würde überein, die das "Regieren" angesichts des vorschwebenden Hochgebildes ihm innerlich verlieh.
"Homo Dei" hatte der häßliche Naphta das Hochgebild ge-nannt, als er es gegen die englische Gesellschaftslehre verteidigte. Was Wunder, daß Hans Castorp um seiner zivilistischen Ver-antwortlichkeit willen und im Regierungsinteresse sich gehalten fand, mit Joachim bei dem Kleinen Besuch zu machen? Settem-brini sah es ungern, – dies deutlich zu spüren, war Hans Castorp schlau und dünnhäutig genug. Schon die erste Begegnung war dem Humanisten unangenehm gewesen, er hatte sie offensicht-lich zu verhindern gestrebt und die jungen Leute, namentlich aber ihn selbst – so sagte sich das durchtriebene Sorgenkind – vor der Bekanntschaft mit Naphta pädagogisch hüten wollen, obgleich ja er für seine Person mit ihm verkehrte und disputier-te. So sind die Erzieher. Sich selber gönnen sie das Interessante, indem sie sich ihm "gewachsen" nennen; der Jugend aber ver-bieten sie es und verlangen, daß sie sich dem Interessanten nicht "gewachsen" fühle. Ein Glück nur, daß es dem Drehorgelmann im Ernst überhaupt nicht zustand, dem jungen Hans Castorp et-was zu verbieten, und daß er ja auch gar nicht den Versuch dazu gemacht hatte. Der Sorgenzögling brauchte seine Dünnhäutigkeit nur zu verleugnen und Unschuld vorzuschützen, so hinder-te nichts ihn, der Einladung des kleinen Naphta freundlich zu folgen, – was er denn auch getan hatte, mit dem wohl oder übel sich anschließenden Joachim, wenige Tage nach dem ersten Zu-sammentreffen, an einem Sonntagnachmittag, nach dem Haupt-liegedienst.
Es waren wenige Minuten Wegs vom Berghof hinunter zum Häuschen mit der weinumkränzten Haustür. Sie traten ein, lie-ßen den Zugang zum Krämerladen zur Rechten liegen und er-klommen die schmale braune Stiege, die sie vor eine Etagentür führte, neben deren Klingel lediglich das Namensschild Luka-ceks, des Damenschneiders, angebracht war. Die Person, die ih-nen öffnete, war ein halbwüchsiger Knabe in einer Art von Livree, gestreifter Jacke und Gamaschen, ein Dienerchen, kurz-geschoren und rotbackig. Ihn fragten sie nach Herrn Professor Naphta und prägten ihm, da sie mit Karten nicht ausgestattet waren, ihre Namen ein, die er Herrn Naphta – er gebrauchte keinen Titel – zu nennen ging. Die dem Eingang gegenüberlie-gende Zimmertür stand offen und gewährte Einblick in die Schneiderei, wo des Feiertags ungeachtet Lukajek mit unterge-schlagenen Beinen auf einem Tische saß und nähte. Er war bleich und kahlköpfig; von einer übergroßen, abfallenden Nase hing ihm der schwarze Schnurrbart mit saurem Ausdruck zu Sei-ten des Mundes herab.
"Guten Tag!" wünschte Hans Castorp.
"Grütsi", antwortete der Schneider mundartlich, obgleich das Schweizerische weder zu seinem Namen noch zu seinem Äuße-ren paßte und etwas falsch und sonderbar klang.
"So fleißig?" fuhr Hans Castorp nickend fort… "Es ist ja Sonntag!"
"Eilige Arbeit", versetzte Lukaçek kurz und stichelte.
"Ist wohl was Feines", vermutete Hans Castorp, "was rasch gebraucht wird, für eine Reunion oder so?"
Der Schneider ließ diese Frage eine Weile unbeantwortet, biß den Faden ab und fädelte neu ein. Nachträglich nickte er.
"Wird es hübsch?" fragte Hans Castorp noch. "Machen Sie Ärmel dran?"
"Ja, Ärmel, es ist für eine Olte", antwortete Lukaçek mit stark böhmischem Akzent. Die Rückkehr des Dienerchens unterbrach dies durch die Tür geführte Gespräch. Herr Naphta lasse bitten, näher zu treten, meldete er und öffnete den jungen Leuten eine Tür, zwei oder drei Schritte weiter rechts, wobei er auch noch eine zusammenfallende Portiere vor ihnen aufzuheben hatte. Die Eintretenden empfing Naphta, in Schleifenschuhen auf moosgrünem Teppich stehend.
Beide Vettern waren überrascht durch den Luxus des zwei-fenstrigen Arbeitszimmers, das sie aufgenommen hatte, ja ge-blendet durch Überraschung; denn die Dürftigkeit des Häus-chens, seiner Treppe, seines armseligen Korridors ließ derglei-chen nicht entfernt erwarten und verlieh der Eleganz von Naphtas Einrichtung durch Kontrastwirkung etwas Märchenhaftes, was sie an und für sich kaum besaß und auch in den Augen Hans Castorps und Joachim Ziemßens nicht besessen hätte. Im-merhin, sie war fein, ja glänzend, und zwar so, daß sie trotz Schreibtisch und Bücherschränken den Charakter des Herrenzimmers eigentlich nicht wahrte. Es war zuviel Seide darin, weinrote, purpurrote Seide: die Vorhänge, die die schlechten Türen verbargen, waren daraus, die Fenster-Überfälle und eben-so die Bezüge der Meubles-Gruppe, die an einer Schmalseite, der zweiten Tür gegenüber, vor einem die Wand fast ganz be-spannenden Gobelin angeordnet war. Es waren Barockarmstüh-le mit kleinen Polstern auf den Seitenlehnen, um einen runden, metallbeschfagenen Tisch gruppiert, hinter dem ein mit Seiden-plüschkissen ausgestattetes Sofa desselben Stiles stand. Die Bü-cherspinde nahmen die Wandpartien neben den beiden Türen ein. Sie waren, wie der Schreibtisch, oder vielmehr der mit einem gewölbten Rolldeckel versehene Sekretär, der zwischen den Fenstern Platz gefunden hatte, in Mahagoni gearbeitet, mit Glastüren, hinter die grüne Seide gespannt war. Aber in dem Winkel links von der Sofagruppe war ein Kunstwerk zu sehen, eine große, auf rot verkleidetem Sockel erhöhte bemalte Holzplastik, – etwas innig Schreckhaftes, eine Pietà, einfältig und wirkungsvoll bis zum Grotesken: die Gottesmutter in der Hau-be, mit zusammengezogenen Brauen und jammernd schief ge-öffnetem Munde, den Schmerzensmann auf ihrem Schoß, eine im Größenverhältnis primitiv verfehlte Figur mit kraß heraus-gearbeiteter Anatomie, die jedoch von Unwissenheit zeugte, das hängende Haupt von Dornen starrend, Gesicht und Glieder mit Blut befleckt und berieselt, dicke Trauben geronnenen Blutes an der Seitenwunde und den Nägelmalen der Hände und Füße. Dies Schaustück verlieh dem seidenen Zimmer nun freilich einen besonderen Akzent. Auch die Tapete, über den Bücher-schränken und an der Fensterwand sichtbar, war übrigens offen-bar eine Leistung des Mieters: das Grün ihrer Längsstreifen war das des weichen Teppichs, der über die rote Bodenbespannung gebreitet war. Nur der niedrigen Decke war wenig zu helfen gewesen. Sie war kahl und rissig. Doch hing ein kleiner vene-zianischer Lüster daran herab. Die Fenster waren mit cremefar-benen Stores verhüllt, die bis zum Boden reichten.
"Da haben wir uns zu einem Kolloquium eingefunden!" sag-te Hans Castorp, während seine Augen mehr an dem frommen Schrecknis im Winkel, als an dem Bewohner des überraschen-den Zimmers hafteten, der es anerkannte, daß die Vettern Wort gehalten hätten. Er wollte sie mit gastlichen Bewegungen seiner kleinen Rechten zu den seidenen Sitzen leiten, aber Hans Castorp ging geradewegs und gebannt auf die Holzgruppe zu und blieb, Arme in die Hüften gestemmt, mit seitwärts geneigtem Kopf davor stehen.
"Was haben Sie denn da!" sagte er leise. "Das ist ja schreck-lich gut. Hat man je so ein Leiden gesehn? Etwas Altes, natür-lich?"
"Vierzehntes Jahrhundert", antwortete Naphta. "Wahrscheinlich rheinischer Herkunft. Es macht Ihnen Eindruck?"
"Enormen", sagte Hans Castorp. "Das kann seinen Eindruck auf den Besucher denn doch wohl gar nicht verfehlen. Ich hätte nicht gedacht, daß etwas zugleich so häßlich – entschuldigen Sie – und so schön sein könnte."
"Erzeugnisse einer Welt der Seele und des Ausdrucks", ver-setzte Naphta, "sind immer häßlich vor Schönheit und schön vor Häßlichkeit, das ist die Regel. Es handelt sich um geistige Schönheit, nicht um die des Fleisches, die absolut dumm ist. Übrigens, auch abstrakt ist sie", fügte er hinzu. "Die Schönheit des Leibes ist abstrakt. Wirklichkeit hat nur die innere, die des religiösen Ausdrucks."
"Das haben Sie dankenswert richtig unterschieden und ange-ordnet", sagte Hans Castorp. "Vierzehntes?" versicherte er sich … "Dreizehnhundertsoundso? Ja, das ist das Mittelalter, wie es im Buche steht, ich erkenne gewissermaßen die Vorstel-lung darin wieder, die ich mir in letzter Zeit vom Mittelalter gemacht habe. Ich wußte eigentlich nichts davon, ich bin ja ein Mann des technischen Fortschritts, soweit ich überhaupt in Fra-ge komme. Aber hier oben ist mir die Vorstellung des Mittelal-ters verschiedentlich nahegebracht worden. Die ökonomistische Gesellschaftslehre gab es damals noch nicht, soviel ist klar. Wie hieß der Künstler denn wohl?"
Naphta zuckte die Achseln.
"Was liegt daran?" sagte er. "Wir sollten danach nicht fragen, da man auch damals, als es entstand, nicht danach fragte. Das hat keinen wunderwie individuellen Monsieur zum Autor, es ist anonym und gemeinsam. Es ist übrigens sehr vorgeschrittenes Mittelalter, Gotik, Signum mortificationis. Sie finden da nichts mehr von der Schonung und Beschönigung, mit der noch die romanische Epoche den Gekreuzigten darstellen zu müssen glaubte, keine Königskrone, keinen majestätischen Triumph über Welt und Martertod. Alles ist radikale Verkündigung des Leidens und der Fleischesschwäche. Erst der gotische Ge-schmack ist der eigentlich pessimistisch-asketische. Sie werden die Schrift Innonzenz' des Dritten, 'De miseria humanae condi-tionis', nicht kennen, – ein äußerst witziges Stück Literatur. Sie stammt vom Ende des zwölften Jahrhunderts, aber erst diese Kunst liefert die Illustrationen dazu."
"Herr Naphta", sagte Hans Castorp nach einem Aufseufzen, "mich interessiert jedes Wort von dem, was Sie da hervorheben. "Signum mortificationis' sagten Sie? Das werde ich mir merken. Vorher sagten Sie etwas von "anonym und gemeinsam', was auch der Mühe wert scheint, darüber nachzudenken. Sie vermu-ten leider richtig, daß ich die Schrift des Papstes – ich nehme an, daß Innozenz der Dritte ein Papst war – nicht kenne. Habe ich richtig verstanden, daß sie asketisch und witzig ist? Ich muß ge-stehen, ich habe mir nie vorgestellt, daß das so Hand in Hand gehen könnte, aber wenn ich es ins Auge fasse, so leuchtet es mir ein, natürlich, eine Abhandlung über das menschliche Elend bietet zum Witz schon Gelegenheit, auf Kosten des Fleisches, Ist die Schrift denn erhältlich? Wenn ich mein Latein zusammen-nähme, vielleicht könnte ich sie lesen."
"Ich besitze das Buch", antwortete Naphta, mit dem Kopf nach einem der Schränke weisend. "Es steht Ihnen zur Verfügung. Aber wollen wir uns nicht setzen? Sie sehen die Pietà auch vom Sofa aus. Eben kommt unser kleines Vespermahl …"
Es war das Dienerchen, das Tee brachte, dazu einen hübschen silberbeschlagenen Korb, worin in Stücke geschnittener Baum-kuchen lag. Hinter ihm aber, durch die offene Tür, wer trat be-schwingten Schrittes mit "Sapperlot!!" "Accidenti!" und feinem Lächeln herein? Das war Herr Settembrini, wohnhaft eine Trep-pe höher, der sich einfand, in der Absicht, den Herren Gesell-schaft zu leisten. Durch sein Fensterchen, sagte er, habe er die Vettern kommen sehen und rasch noch eine enzyklopädische Seite heruntergeschrieben, die er eben unter der Feder gehabt, um sich dann ebenfalls hier zu Gaste zu bitten. Nichts war na-türlicher, als daß er kam. Seine alte Bekanntschaft mit den Berg-hofbewohnern berechtigte ihn dazu, und dann war auch sein Verkehr und Austausch mit Naphta, trotz tiefgehender Meinungsver-schiedenheiten, ja offenbar überhaupt sehr lebhaft, – wie denn der Gastgeber ihn leichthin und ohne Überraschung als Zugehörigen begrüßte. Das hinderte nicht, daß Hans Castorp von seinem Kommen sehr deutlich einen doppelten Eindruck gewann. Erstens, so empfand er, stellte Herr Settembrini sich ein, um ihn und Joachim, oder eigentlich kurzweg ihn, nicht mit dem häßlichen kleinen Naphta allein zu lassen, sondern durch seine Anwesenheit ein pädagogisches Gegengewicht zu schaffen; und zweitens war klar ersichtlich, daß er gar nichts da-gegen hatte, sondern die Gelegenheit recht gern benutzte, den Aufenthalt in seinem Dach auf eine Weile mit dem in Naphtas seidenfeinem Zimmer zu vertauschen und einen wohlservierten Tee einzunehmen: er rieb sich die gelblichen, an der Kleinfin-gerseite des Rückens mit schwarzen Haaren bewachsenen Hän-de, bevor er Zugriff, und speiste mit unverkennbarem, auch lo-bend ausgesprochenem Genuß von dem Baumkuchen, dessen schmale, gebogene Scheiben von Schokoladenadern durchzogen waren.
Das Gespräch fuhr noch fort, sich mit der Pietà zu beschäftigen, da Hans Castorp mit Blick und Wort an dem Gegenstand festhielt, wobei er sich an Herrn Settembrini wandte und diesen gleichsam mit dem Kunstwerk in kritischen Kontakt zu setzen suchte, – während ja der Abscheu des Humanisten gegen diesen Zimmerschmuck deutlich genug in der Miene zu lesen war, mit der er sich danach umwandte: denn er hatte sich mit dem Rük-ken gegen jenen Winkel gesetzt. Zu höflich, um alles zu sagen, was er dachte, beschränkte er sich darauf, Fehlerhaftigkeiten in den Verhältnissen und den Körperformen der Gruppe zu beanstanden, Verstöße gegen die Naturwahrheit, die weit entfernt seien, rührend auf ihn zu wirken, da sie nicht frühzeitlichem Unvermögen, sondern bösem Willen, einem grundfeindlichen Prinzip entsprängen, – worin Naphta ihm boshaft zustimmte. Gewiß, von technischem Ungeschick könne nicht entfernt die Rede sein. Es handle sich um bewußte Emanzipation des Geistes vom Natürlichen, dessen Verächtlichkeit durch die Verweige-rung jeder Demut davor religiös verkündet werde. Als aber Settembrini die Vernachlässigung der Natur und ihres Studiums für menschlich abwegig erklärte und gegen die absurde Form-losigkeit, der das Mittelalter und die ihm nachahmenden Epo-chen gefrönt hätten, das griechisch-römische Erbe, den Klassi-zismus, Form, Schönheit, Vernunft und naturfromme Heiter-keit, die allein die Sache des Menschen zu fördern berufen seien, in prallen Worten zu erheben begann, mischte Hans Castorp sich ein und fragte, was denn aber bei solcher Bewandtnis mit Plotinus los sei, der sich nachweislich seines Körpers ge-schämt, und mit Voltaire, der im Namen der Vernunft gegen das skandalöse Erdbeben von Lissabon revoliert habe? Absurd? Das sei auch absurd gewesen, aber wenn man alles recht überle-ge, so könne man seiner Ansicht nach das Absurde recht wohl als das geistig Ehrenhafte bezeichnen, und die absurde Natur-feindschaft der gotischen Kunst sei am Ende ebenso ehrenhaft gewesen wie das Gebaren der Plotinus und Voltaire, denn es drücke sich dieselbe Emanzipation von Fatum und Faktum darin aus, derselbe unknechtische Stolz, der sich weigere, vor der dummen Macht, nämlich vor der Natur abzudanken …
Naphta brach in Lachen aus, das sehr an den bewußten Teller erinnerte und in Husten endigte. Settembrini sagte vornehm:
"Sie schädigen unseren Wirt, indem Sie so witzig sind, und erweisen sich also undankbar für dies köstliche Gebäck. Ist Dankbarkeit überhaupt Ihre Sache? Wobei ich voraussetze, daß Dankbarkeit darin besteht, von empfangenen Geschenken einen guten Gebrauch zu machen …"
Da Hans Castorp sich schämte, setzte er scharmant hinzu:
"Man kennt Sie als Schalk, Ingenieur. Ihre Art, das Gute freundschaftlich zu necken, läßt mich keineswegs an Ihrer Liebe zu ihm verzweifeln. Sie wissen selbstverständlich, daß nur die-jenige Auflehnung des Geistes gegen das Natürliche ehrenhaft zu nennen ist, die die Würde und Schönheit des Menschen im Auge hat, nicht diejenige, welche, wenn sie seine Entwürdigung und Erniedrigung nicht bezweckt, sie doch jedenfalls nach sich zieht. Sie wissen auch, welche entmenschte Greuel, welche mordgierige Unduldsamkeit die Epoche, der das Artefakt da hinter mir sein Dasein verdankt, gezeitigt hat. Ich brauche Sie nur an den entsetzlichen Typ der Ketzerrichter, an die blutige Figur eines Konrad von Marburg etwa, zu erinnern und an seine infame Priesterwut gegen alles, was der Herrschaft des Überna-türlichen entgegenstand. Sie sind weit entfernt, Schwert und Scheiterhaufen als Instrumente der Menschenliebe anzuerken-nen …"
"In deren Dienst dagegen", äußerte Naphta, "arbeitete die Maschinerie, mit der der Konvent die Welt von schlechten Bür-gern reinigte. Alle Kirchenstrafen, auch der Scheiterhaufen, auch die Exkommunikation, wurden verhängt, um die Seele vor ewiger Verdammnis zu retten, was man von der Vertilgungslust der Jakobiner nicht sagen kann. Ich erlaube mir, zu bemerken, daß jede Pein – und Blutjustiz, die nicht dem Glauben an ein Jen-seits entspringt, viehischer Unsinn ist. Und was die Entwürdigung des Menschen betrifft, so fällt ihre Geschichte exakt mit der des bürgerlichen Geistes zusammen. Renaissance, Aufklä-rung und die Naturwissenschaft und Ökonomistik des neun-zehnten Jahrhunderts haben nichts, aber auch nichts zu lehren unterlassen, was irgend tauglich schien, diese Entwürdigung zu fördern, angefangen mit der neuen Astronomie, die aus dem Zentrum des Alls, dem erlauchten Schauplatz, wo Gott und Teufel um den Besitz des beiderseits heiß begehrten Geschöpfes kämpften, einen gleichgültigen kleinen Wandelstern machte und der großartigen kosmischen Stellung des Menschen, auf der übrigens die Astrologie beruhte, vorderhand ein Ende bereitete."
"Vorderhand?" Herrn Settembrinis Miene hatte, wie er es lauernd fragte, selber etwas von der eines Ketzerrichters und Inquisitors, der darauf wartet, daß der Aussagende sich im un-zweifelhaft Sträflichen verfange.
"Allerdings. Für ein paar hundert Jahre", bestätigte Naphta kalt. "Eine Ehrenrettung der Scholastik steht, wenn nicht alles täuscht, auch in dieser Beziehung bevor, sie ist schon im vollen Gange. Kopernikus wird von Ptolemäus geschlagen werden. Die heliozentrische These begegnet nachgerade einem geistigen Wi-derstand, dessen Unternehmungen wahrscheinlich zum Ziele führen werden. Die Wissenschaft wird sich philosophisch genö-tigt sehen, die Erde in alle Würden wieder einzusetzen, die das kirchliche Dogma ihr wahren wollte."
"Wie? Wie? Geistiger Widerstand? Philosophisch genötigt sehen? Zum Ziele führen? Welche Art von Voluntarismus spricht aus Ihnen? Und die voraussetzungslose Forschung? Die reine Erkenntnis ? Die Wahrheit, mein Herr, die mit der Freiheit so innig verbunden ist, und deren Blutzeugen, aus denen Sie Beleidiger der Erde machen wollen, diesem Stern vielmehr zur ewigen Zierde gereichen?"
Herr Settembrini hatte eine gewaltige Art, zu fragen. Hoch-aufgerichtet saß er und ließ seine ehrenhaften Worte auf den kleinen Herrn Naphta niedersausen, am Ende die Stimme so mächtig hochziehend, daß man wohl hörte, wie sicher er war, daß des Gegners Antwort hierauf nur in beschämtem Schweigen bestehen könne. Er hatte ein Stück Baumkuchen zwischen den Fingern gehalten, während er sprach, legte es aber nun auf den Teller zurück, da er nach dieser Fragestellung nicht hinein-beißen mochte.
Naphta erwiderte mit unangenehmer Ruhe:
"Guter Freund, es gibt keine reine Erkenntnis. Die Rechtmäßigkeit der kirchlichen Wissenschaftslehre, die sich in Augustins Satz 'Ich glaube, damit ich erkenne' zusammenfassen läßt, ist völlig unbestreitbar. Der Glaube ist das Organ der Erkenntnis und der Intellekt sekundär. Ihre voraussetzungslose Wissen-schaft ist eine Mythe. Ein Glaube, eine Weltanschauung, eine Idee, kurz: ein Wille ist regelmäßig vorhanden, und Sache der Vernunft ist es, ihn zu erörtern, ihn zu beweisen. Es läuft immer und in allen Fällen auf das 'Quod erat demonstrandum' hinaus. Schon der Begriff des Beweises enthält, psychologisch genom-men, ein stark voluntaristisches Element. Die großen Scholasti-ker des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts waren einig in der Überzeugung, daß in der Philosophie nicht wahr sein könne, was vor der Theologie falsch sei. Lassen wir die Theologie aus dem Spiel, wenn Sie wollen, aber eine Humanität, die nicht anerkennt, daß in der Naturwissenschaft nicht wahr sein kann, was vor der Philosophie falsch ist, das ist keine Humanität. Die Argumentation des heiligen Offiziums gegen Galilei lautete da-hin, daß seine Sätze philosophisch absurd seien. Eine schlagendere Argumentation gibt es nicht."
"Eh, eh, die Argumente unseres armen, großen Galilei haben sich als stichhaltiger erwiesen! Nein, lassen Sie uns ernsthaft re-den, Professore! Beantworten Sie mir vor diesen beiden auf-merksamen jungen Leuten die Frage: Glauben Sie an eine Wahrheit, an die objektive, die wissenschaftliche Wahrheit, der nachzustreben oberstes Gesetz aller Sittlichkeit ist, und deren Triumphe über die Autorität die Ruhmesgeschichte des Menschengeistes bilden?!"
Hans Castorp und Joachim wandten die Köpfe von Settembrini zu Naphta, der erstere schneller, als der andere. Naphta antwortete:
"Ein solcher Triumph ist nicht möglich, denn die Autorität ist der Mensch, sein Interesse, seine Würde, sein Heil, und zwischen ihr und der Wahrheit kann es keinen Widerstreit geben. Sie fallen zusammen."
"Die Wahrheit wäre demnach –"
"Wahr ist, was dem Menschen frommt. In ihm ist die Natur zusammengefaßt, in aller Natur ist nur er geschaffen und alle Natur nur für ihn. Er ist das Maß der Dinge und sein Heil das Kriterium der Wahrheit. Eine theoretische Erkenntnis, die des praktischen Bezuges auf die Heilsidee des Menschen entbehrt, ist dermaßen uninteressant, daß jeder Wahrheitswert ihr abzu-sprechen und ihre Nichtzulassung geboten ist. Die christlichen Jahrhunderte waren völlig einig über die menschliche Uner-heblichkeit der Naturwissenschaft. Lactantius, den Konstantin der Große zum Lehrer seines Sohnes wählte, fragte gerade her-aus, welche Seligkeit er denn gewinnen werde, wenn er wisse, wo der Nil entspringt, oder was die Physiker vom Himmel fa-seln. Das beantworten Sie ihm einmal! Wenn man die platoni-sche Philosophie jeder anderen vorzog, so darum, weil sie sich nicht mit Naturerkenntnis, sondern mit der Erkenntnis Gottes abgab. Ich kann Sie versichern, die Menschheit ist im Begriff, zu diesem Gesichtspunkt zurückzufinden und einzusehen, daß es nicht Aufgabe wahrer Wissenschaft ist, heillosen Erkenntnissen nachzulaufen, sondern das Schädliche oder auch nur ideell Be-deutungslose grundsätzlich auszuscheiden und mit einem Worte Instinkt, Maß, Wahl zu bekunden. Es ist kindisch, zu meinen, die Kirche habe die Finsternis gegen das Licht verteidigt. Sie tat dreimal wohl daran, ein 'voraussetzungsloses' Streben nach Erkenntnis der Dinge, das heißt: ein solches, das sich der Rück-sicht auf das Geistige, auf den Zweck der Heilserwerbung ent-schlägt, für strafbar zu erklären, und was den Menschen in Finsternis geführt hat und immer tiefer führen wird, ist vielmehr die 'voraussetzungslose', die aphilosophische Naturwissenschaft."
"Sie lehren da einen Pragmatismus", erwiderte Settembrini, "den Sie nur ins Politische zu übertragen brauchen, um seiner ganzen Verderblichkeit ansichtig zu werden. Gut, wahr und ge-recht ist, was dem Staate frommt. Sein Heil, seine Würde, seine Macht ist das Kriterium des Sittlichen. Schön! Damit ist jedem Verbrechen Tür und Tor geöffnet, und die menschliche Wahrheit, die individuelle Gerechtigkeit, die Demokratie – sie mö-gen sehen, wo sie bleiben …"

