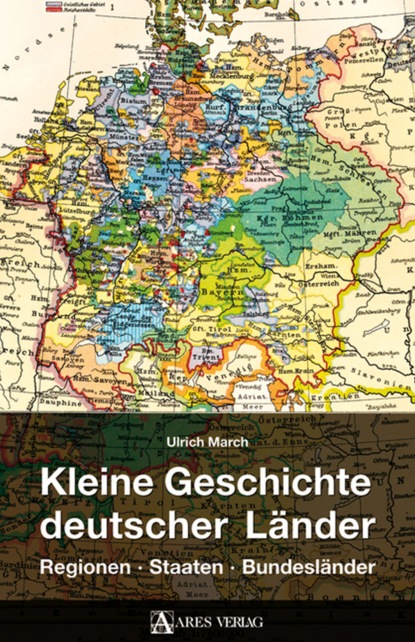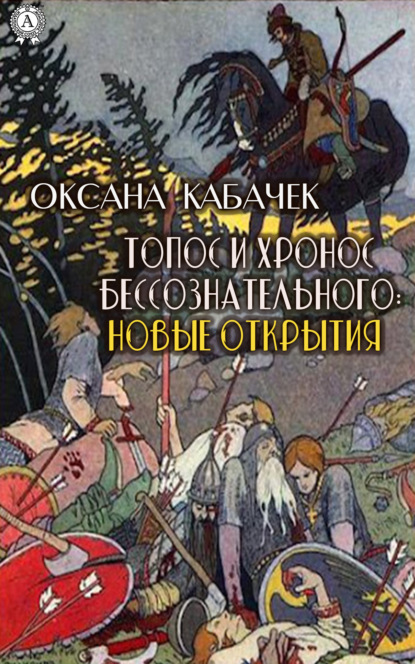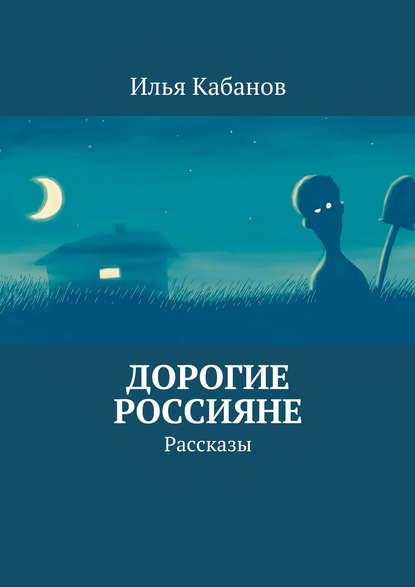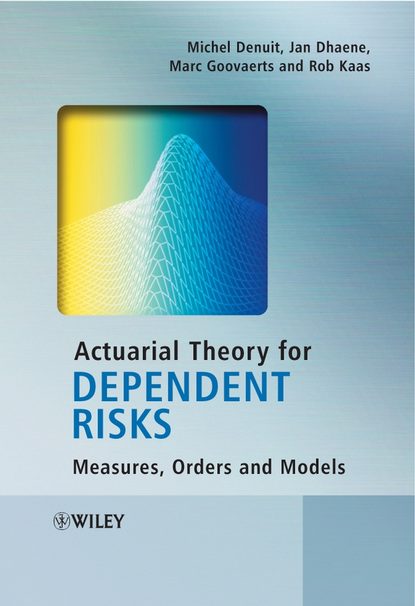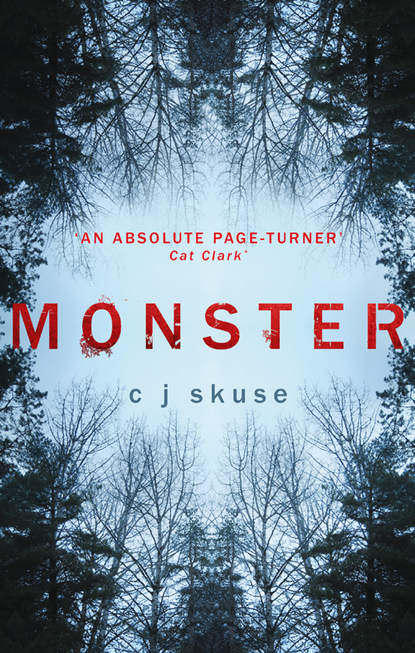- -
- 100%
- +
Zum Erzbistum Magdeburg gehören die Bistümer Brandenburg, Havelberg, Merseburg, Meißen und Zeitz-Naumburg. Infolgedessen entstehen im gesamten Bereich der mittleren Elbe repräsentative Dombauten. Dies geschieht, auch in Magdeburg, bereits in ottonischer Zeit, doch sind die Vorgängerbauten der heutigen Dome nur bruchstückhaft erhalten.
Die ältere Geschichte des Erzbistums Magdeburg läßt sich nicht anders als im europäischen Zusammenhang darstellen. Anlaß der Gründung ist die Verbreitung des Christentums in Osteuropa; dabei wirken Kräfte nicht nur aus dem Reich, sondern auch aus Westeuropa mit. Der erste Erzbischof Adalbert, ein Mönch von St. Maximin in Trier, gilt nach seiner Ernennung als „Bischof der Russen“, verfügt aber auch über enge Verbindungen nach Frankreich. St. Maximin ist das Mutterinstitut des Magdeburger Benediktinerklosters St. Mauritius, aus dessen Besitz die Grundausstattung des neuen Erzbistums stammt, und die Trierer Mönche unterhalten lebhafte Beziehungen zur Rhôneregion, wo der Kult des heiligen Mauritius besonders gepflegt wird.
Durch den Slawenaufstand des Jahres 983, den zunehmenden Einfluß der von Byzanz ausgehenden orthodoxen Mission in Rußland und schließlich durch den Verlust des ursprünglich zu Magdeburg gehörenden Bistums Posen und die Gründung eines eigenen polnischen Erzbistums im Jahre 1000 verliert das Elbestift seine von Otto dem Großen festgelegte Bestimmung und einen Großteil seiner Bedeutung. Mit dem Beginn der Ostsiedlung im 12. Jahrhundert erlebt es jedoch noch einmal einen beachtlichen Aufschwung als Ausgangspunkt für die Siedlungsbewegung und für zahlreiche Kirchen- und Klostergründungen. Auch der heutige Magdeburger Dom ist damals entstanden, und zwar unter Erzbischof Adalbert II. (1205–1232), der in Paris studiert hat, ein Kenner der frühen französischen Gotik ist und den neuen Baustil nun erstmals in den Bereich der mittleren Elbe überträgt.
Der Prämonstratenserorden, 1120 von Norbert von Xanten gegründet, nimmt seinen Ausgang vom Kloster „Unserer Lieben Frauen“ in Magdeburg. Er sieht seine Aufgabe vor allem in der Slawenmission und verbreitet sich im gesamten östlichen Mitteleuropa. Seine Kirchen haben etwas Burgenartiges: strenge Baugliederung, hoch aufragendes Westwerk, flankierende Türme. Die Klosterkirche von Jerichow und der Havelberger Dom lassen noch heute etwas von der Gesinnung erahnen, die hinter einer solchen Architektur steht.
Die Kulturleistung Ostsachsens und der Harzlandschaft beschränkt sich aber nicht nur auf Religion, Kunst und Architektur. Bedeutsam sind auch die Literatur und die Geschichtsschreibung, in der ein starkes regionales Identitätsbewußtsein zum Ausdruck kommt. Widukind von Corvey und Thietmar von Merseburg, die Chronisten der ottonischen Zeit, schreiben voller Stolz über die politischen Erfolge Sachsens und seiner Dynastie und fühlen sich in diesem Sinne ganz als Norddeutsche, auch wenn ihre Geschichtsschreibung sich auf das gesamte Reich bezieht. Das gleiche gilt für die Nonne und Dichterin Roswitha von Gandersheim. Sie fühlt sich, wie ihr Gedicht „De gestis imperatoris Ottonis I.“ zeigt, ganz ihrer Heimat und deren großem Sohn verbunden. Sie behandelt aber auch, und zwar auf hohem Niveau, in ihren geistlichen Stücken und in sechs Dramen zahlreiche Gegenstände, die sie als Kennerin der europäischen Geschichte und Literatur ausweisen. Roswitha schreibt in lateinischer Sprache und gilt als herausragende literarische Vertreterin der „ottonischen Renaissance“.
Auch nach dem Ende der ottonischen und der salischen Epoche bleibt der Harz-Elbe-Raum eine wichtige Kulturregion. Bemerkenswert ist hier vor allem der Sachsenspiel Eikes von Repgow, der zum ersten Mal das niederdeutsche Gewohnheitsrecht systematisch darstellt. Von überregionaler Bedeutung ist ferner das Magdeburger Stadtrecht, das die bürgerlich-freiheitliche Stadtverfassung Magdeburgs ebenso widerspiegelt wie das Lübische Recht diejenige Lübecks. Während letztes jedoch auf den Küstenraum der Ostsee beschränkt bleibt, breiten sich das Magdeburger Recht und seine ostpreußische Variante, die „Kulmer Handfeste“, bis über die Weichsel nach Osten hin aus. Das Magdeburger Recht ist damit ein bedeutendes Phänomen der europäischen Stadtkultur.
All dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die wirklich große Zeit der Region mit dem Ende der ottonischen Dynastie vorbei ist. Nie wieder sind Orte wie Quedlinburg und Magdeburg die Zentren deutscher und europäischer Politik gewesen, nie wieder werden Rang und Rolle des Magdeburger Erzstifts von den Menschen so hoch eingeschätzt wie in der Zeit Ottos des Großen und des ersten „Bischofs der Russen“. Zwar behält die Stadt Magdeburg als wichtigster Elbübergang für den Handelsverkehr in West-Ost-Richtung große Bedeutung, doch auch damit ist es nach der nahezu totalen Zerstörung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg vorbei. Erst seit dem 18. Jahrhundert gewinnt Magdeburg wieder eine gewisse Bedeutung: als wichtigste Festung im Westen des Königreichs Preußen, als Verwaltungs- und Industriestadt. Heute ist Magdeburg Hauptstadt des wieder errichteten Landes Sachsen-Anhalt, doch ist das alte Stadtbild durch die Zerstörungen des Dreißigjähren Krieges und des Zweiten Weltkrieges unwiderruflich zerstört.
D. Für Kirche und Reich (Erzbistümer Köln, Mainz und Trier)
Christliches Leben hat es in Köln, Mainz und Trier schon in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten gegeben, seit Anfang des 4. Jahrhunderts sind Bischöfe bezeugt. Die Tradition der drei rheinischen Erzbistümer reicht also viel weiter zurück als die der übrigen Erzdiözesen Salzburg, Hamburg-Bremen und Magdeburg. Dies ist der Grund dafür, daß die westdeutschen Kirchenprovinzen während des ganzen Mittelalters eine Vorrangstellung in der Kirchenorganisation des Reiches eingenommen haben.
Alle drei Erzbischöfe sind zunächst einmal Inhaber eines geistlichen Amtes, das sich nicht nur auf die eigene Diözese beschränkt, sondern die untergeordneten Bistümer mit umfaßt. Sie bauen sich zweitens auf der Grundlage der politischen Privilegien, die sie genießen, im Laufe des Hochmittelalters jeweils mittelgroße Territorien auf, sind also zugleich weltliche Herrscher – seit etwa 1200 Landesherren in einem geschlossenen Territorium. Drittens sind sie entscheidend an der Gestaltung der Reichspolitik beteiligt; vor allem der Erzbischof von Mainz ist während des ganzen Hochmittelalters einer der wichtigsten Berater des Königs und damit einer der mächtigsten Männer des Reiches. Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts gestalten sie nicht nur die deutsche, sondern die europäische Politik mit.
Als weltliche Herrscher und als Berater in der Reichspolitik verhalten sich die angesehensten deutschen Kirchenfürsten nicht anders als andere Politiker: ehrgeizig und machtbewußt, mitunter skrupellos und intrigant. Wie alle Bischöfe sind sie geistliche Hirten, Waffenträger und oberste Gerichtsherrn zugleich; sie gehören darüber hinaus dem exklusivsten gesellschaftlichen und politischen Führungszirkel an. Dies alles läßt sich damals auch in den Augen der Bevölkerung durchaus mit dem religiösen Auftrag vereinbaren, da die beiden Universalgewalten, Reich und Kirche, wenn auch mit unterschiedlichen Mitteln, dasselbe Ziel anstreben: ein Reich des Friedens und des Evangeliums.
Am ungebrochensten ist die kirchliche Kontinuität vom Altertum zum Mittelalter in Trier, wo die Liste der Bischöfe auch in den turbulenten Zeiten der Völkerwanderung und der fränkischen Landnahme keine Lücken aufweist. Den Trierer Erzbischöfen gelingt es in erstaunlich kurzer Zeit, ein Territorium im Bereich der unteren Mosel zu errichten, dessen Grenzen im Raum Koblenz den Rhein weit nach Osten überschreiten. Aber die Moselstraße hat nicht die Bedeutung der Rheinschiene, und im Vergleich zu Köln und Mainz liegt Trier bereits randlich, nicht weit von der deutsch-französischen Sprachgrenze entfernt. Die wenigen Bistümer der verhältnismäßig kleinen Kirchenprovinz, Metz, Toul und Verdun, befinden sich alle auf französischsprachigem Gebiet.
Dies alles sind Gründe dafür, daß die Erzdiözese Trier nicht ganz mit Köln und Mainz mithalten kann. Gleichwohl ist der Trierer Einfluß auf die Reichspolitik besonders seit der Einbeziehung Burgunds in das Imperium (1033) bedeutend. Den Erzbischöfen von Trier obliegt nämlich die Leitung der Kanzlei für das Königreich Burgund, so daß sie die Politik in diesem Reichsteil maßgeblich mitbestimmen. Mit dem Amt ist außerdem die Nähe zum jeweiligen Herrscher und damit der Einfluß auf die Gesamtpolitik verbunden, auch und besonders bei den Königswahlen. In dem siebenköpfigen Kursfürstenkollegium, das seit 1356 den deutschen König und römischen Kaiser wählt, haben die Trierer Erzbischöfe den dritthöchsten Rang, obwohl die vier Laienfürsten dieses Gremiums über wesentlich größere Territorien gebieten.
Deutlich stärker ist die politische Position der Kölner Erzbischöfe bereits seit Beginn der deutschen Geschichte. Erzbischof Brun (953–965), der jüngste Sohn Heinrichs I., ist seinem Bruder, Kaiser Otto dem Großen, treu ergeben und spielt die entscheidende Rolle bei der Durchsetzung des Reichs-Kirchen-Systems in Westdeutschland. Als Herzog von Lothringen verfügt er über politische Möglichkeiten, die weit über sein Amt und seine Diözese hinausreichen. Er hat diese Möglichkeiten genutzt, um den hohen rheinischen Klerus zur Reichstreue und zur Loyalität gegenüber dem König zu erziehen, und damit wesentliche Grundlagen der künftigen Reichspolitik geschaffen. Der Aufstieg des Kölner Erzstifts hält auch nach Bruns Tode an: 1028 erhalten die Erzbischöfe das Recht der Königskrönung und -salbung, 1031 übernehmen sie die Leitung der Reichskanzlei für Italien, 1180 werden sie Herzöge von Westfalen und damit de iure Nachfolger der Welfen im Westen des alten sächsischen Stammesherzogtums.
Die Königssalbung, die im Aachener Münster, gleichsam in Gegenwart des dort bestatteten Karls des Großen stattfindet, muß man mit den Augen des Mittelalters betrachten, wenn man ihre politische Bedeutung ermessen will. Der Kölner Erzbischof, der diese Zeremonie vornimmt, wird dadurch zu einer „heilsvermittelnden Instanz“ für die Reichspolitik. Durch die Leitung der für Reichsitalien zuständigen Kanzlei gewinnen die Erzbischöfe maßgeblichen Einfluß auf die kaiserliche Rom- und Italienpolitik. Die Erhebung in den Herzogsstand schließlich belohnt die reichstreue Haltung des Stifts, gerade auch in den vorangegangenen Kämpfen mit Heinrich dem Löwen. Sie ist zugleich die Krönung der erzbischöflichen Territorialpolitik, die zunächst zur Herrschaftsbildung in einem linksrheinischen Gebietsstreifen zwischen Neuss und Andernach führt, in staufischer Zeit aber weit darüber hinausreicht, vor allem in den südwestfälischen Raum.
Einige Kölner Erzbischöfe gehören zu den bedeutendsten Köpfen mittelalterlicher Politik, vor allem Anno II. (1056–1075), Rainald von Dassel (1059–1067) und Philipp von Heinsberg (1167–1191). Erzbischof Anno öffnet seine Diözese der von Cluny ausgehenden kirchlichen Reformbewegung und gibt der „Kölner Sakrallandschaft“ durch den Bau oder Umbau zahlreicher Gotteshäuser ihr heutiges Gesicht. Sein Zeitgenosse Adam von Bremen beschreibt die damalige Kölner Kirche wie folgt: „Sie war vorher schon groß gewesen; er machte sie so bedeutend, daß sie über jeden Vergleich mit einer anderen Kirche des Reichs erhaben war.“

Rainald von Dassel (1120–1167), Erzbischof von Köln und Kanzler Kaiser Friedrich Barbarossas (Büste am Drei-Königs-Schrein im Kölner Dom)
In der Reichsgeschichte ist Anno vor allem durch den „Staatsstreich von Kaiserswerth“ bekannt geworden. Im Jahre 1062 läßt er den damals zwölfjährigen späteren Kaiser Heinrich IV. von einem bei der Pfalz Kaiserswerth (nördlich von Düsseldorf) ankernden Schiff entführen und wird auf diese Weise der mächtigste Fürst des Reiches. Zwar muß er diese Stellung bald an seinen Amtsbruder Adalbert von Bremen abtreten, doch beauftragt der junge König ihn 1072 noch einmal mit der Reichsregentschaft. Trotz seiner Sympathie für die cluniazensische Reformbewegung, die zur Machtsteigerung der Kirche und zum Investiturstreit zwischen Papst und Kaiser führt, hat Anno ebenso wie seine Nachfolger in politischer Hinsicht unbeirrt die Interessen des Reichs vertreten – ohne den Rückhalt der rheinischen Erzdiözesen hätten Heinrich IV. und Heinrich V. den Investiturstreit kaum führen können.
In der großen Politik hat Rainald von Dassel die bedeutendste Rolle aller Kölner Erzbischöfe gespielt. Als Leiter der Italien-Kanzlei ist er für die Konzeption und bis zu seinem Tod auch für die praktische Durchführung der Papst- und Rompolitik Barbarossas zuständig. Unter dem Schlagwort „Honor Imperii“ zielt er ebenso konsequent wie kompromißlos auf die Wiederherstellung der im Investiturstreit und im staufisch-welfischen Bürgerkrieg weitgehend verlorengegangenen Hoheit des Kaisers über Reichsitalien, ohne seine Gegner – die Kurie, die oppositionellen Fürsten und die aufblühenden lombardischen Städte – jemals über seine Zielsetzung im Unklaren zu lassen. Schon vor Beginn der eigentlichen Auseinandersetzung steckt er die Fronten klar ab. Auf dem Reichstag von Besançon hat er in seiner Zuständigkeit für Italien eine Grußbotschaft des Papstes verlesen, in der das Reich als „beneficium“ des Heiligen Stuhls bezeichnet wird. Rainald von Dassel übersetzt das Wort mit „Lehen“ – nicht aus zwingenden sprachlichen Gründen, sondern in wohlkalkulierter politischer Absicht: Die Teilnehmer des Reichstags reagieren daraufhin mit äußerster Empörung.
Da die Italienpolitik für Barbarossa einen sehr hohen Stellenwert hat, ist der Erzbischof durch sein Reichsamt dermaßen stark in Anspruch genommen, daß er sich kaum um seine Diözese kümmern kann. Seine bedeutendste Leistung für das Erzstift besteht darin, daß er die Gebeine der Heiligen Drei Könige, die ihm der Kaiser nach der Zerstörung Mailands überläßt, nach Köln bringt. Sie werden bis heute in einem Prunkschrein des Domes aufbewahrt und tragen viele Jahrhunderte lang zur religiösen Bedeutung Kölns bei.
Gleichsam nebenbei errichtet Rainald von Dassel als „Legat für Tuscien“ in der Toskana eine zweite ausgedehnte Herrschaft, kann dieses Werk aber nicht zu Ende führen, da er wie viele Angehörige des deutschen Heeres 1167 vor Rom einer Malariaseuche erliegt. Sein Nachfolger als Erzbischof und Kanzler, Philipp von Heinsberg, ist bei aller Konsequenz im grundsätzlichen politisch flexibler als Rainald und hat maßgeblichen Anteil daran, daß die Hoheit des Reiches über Italien – wenn auch mit gewissen Abstrichen – schließlich mit diplomatischen Mitteln erreicht wird. 1180 erhält der Erzbischof, der zu den wichtigsten Verbündeten des Kaisers im Kampf gegen Heinrich den Löwen gehört, nicht nur den Titel eines Herzogs von Westfalen, sondern auch die Gebiete um Soest und Werl, zu denen später noch die Grafschaft Arnsberg kommt. In den Folgejahren baut er unter enormem finanziellen Aufwand das gesamte Kölner Herrschaftsgebiet zu einem geschlossenen Territorium aus, zahlreiche Burgen werden damals neu errichtet oder modernisiert. Als Philipp 1191 – ein Jahr nach dem ihm stets sehr nahestehenden Kaiser – stirbt, ist er der mächtigste Reichsfürst nördlich der Alpen.
Oberhaupt der Reichskirche, „Primas Germaniae“, ist jedoch nicht der Kölner, sondern der Mainzer Erzbischof. Seine Kirchenprovinz reicht von den Vogesen bis zur Altmühl, von Graubünden bis zur Lüneburger Heide und umfaßt damit den weitaus größten Teil des deutschen Altsiedellandes. Zwölf Diözesen sind dem Mainzer Erzbistum unterstellt, die Mehrzahl der deutschen Bistümer. Auch die territorialpolitischen Ambitionen der Mainzer Erzbischöfe sind weiter gespannt als die der meisten anderen geistlichen Fürsten. Das Kerngebiet ihrer Herrschaft stellen alte Besitzungen im Nahe-, Main- und Rheingau dar, die teilweise auf die karolingische Zeit zurückgehen. Zusätzlich erwerben sie im Laufe der Zeit entferntere Gebiete im nordhessisch-thüringischen Raum, unter anderem die Wetterau, das Eichsfeld und die Stadt Erfurt mit Umgebung.
Von spätmerowingischer bis spätstaufischer Zeit, also ein halbes Jahrtausend lang, haben die Mainzer Erzbischöfe eine zentrale, einige von ihnen eine überragende Rolle in der Reichspolitik gespielt. Bonifatius führt zwar noch nicht den Titel eines Erzbischofs, schafft aber mit seiner große Teile Deutschlands erfassenden kirchlichen Organisationsarbeit die Grundlagen für die spätere Entwicklung seines Sprengels. Im Zeitalter des niedergehenden ostfränkischen Reiches reicht die politische Autorität der Mainzer Erzbischöfe an die der schwachen karolingischen Könige heran, besonders während des Pontifikats des Erzbischofs Hatto (891–913).
Im Zusammenhang mit dem Reichs-Kirchen-System bauen die Erzbischöfe ihre politische Stellung weiter aus. Seit 975 üben sie das Amt des Erzkanzlers mit Zuständigkeit für das gesamte deutsche Reich aus. Sie stehen damit an der Spitze der wichtigsten Reichsbehörde, halten sich ständig in der Nähe des Königs auf und üben damit entsprechenden Einfluß aus. Zugleich behaupten sie die Schlüsselstellung, die sie seit der ausgehenden Karolingerzeit bei den Königswahlen haben und die noch in der „Goldenen Bulle“, dem Reichsgrundgesetz von 1356, ausdrücklich bestätigt wird: Der Mainzer Erzbischof, der den höchsten Rang unter den sieben Kurfürsten einnimmt, leitet die Wahl und gibt als erster seine Stimme ab.
Gestützt auf diese Befugnisse, haben die Erzbischöfe von Mainz eine wesentliche Rolle in der deutschen Geschichte des Mittelalters gespielt, auch wenn sie nach der Katastrophe des staufischen Hauses nur noch gelegentlich an ihre alte Bedeutung anknüpfen können. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang vor allem drei Pontifikate des 12. und 13. Jahrhunderts, nämlich die der Erzbischöfe Adalbert (1111–1137), Christian (1167–1183) und Siegfried II. (1200–1230). Adalbert betreibt eine nachhaltige Territorialpolitik und schafft die Voraussetzungen für die spätere erzbischöfliche Landesherrschaft, während sich Christian fast ausschließlich um die Reichspolitik kümmert; nach dem Tod Rainalds von Dassel wird er zum wichtigsten politischen Berater Kaiser Barbarossas. Unter Siegfried II. schließlich erreicht das Erzbistum Mainz den Höhepunkt seiner politischen Geschichte. Er verfügt zwar bei weitem nicht über das größte Territorium des Reiches, gehört aber zu den politisch einflußreichsten Männern seiner Zeit.
E. Königsland am Rhein (Nördliche Oberrhein-Region)
Das Einzugsgebiet des Rheins ist seit jeher eine völkerverbindende Region gewesen, der Strom selbst ist nicht nur im Bewußtsein der unmittelbaren Anwohner tief verankert. Schon in frühgeschichtlicher Zeit bietet sich hier die Möglichkeit, die verkehrsfeindliche Mittelgebirgsschwelle in Nord-Süd-Richtung zu überwinden. Vom Oberlauf des Rheins aus sind die nach Italien führenden Alpenpässe zu erreichen, auf dem Weg über die Burgundische Pforte auch das Rhônetal, das für den Nord-Süd-Verkehr bis heute eine ähnliche Bedeutung hat.
An zwei Stellen, am Nord- und am Südrand des Rheinischen Schiefergebirges, kreuzen bedeutende Ost-West-Verbindungen die Rheinschiene. Es ist kein Zufall, daß die Schwerpunkte bereits der römischen Aktivität im Raum Xanten – Köln einerseits, in Mainz andererseits gelegen haben, von hier aus hat man versucht, lippe- und mainaufwärts in das Innere Germaniens vorzudringen. Später folgen die Fernverbindungen Paris – Metz – Frankfurt – Leipzig und Köln – Hannover – Magdeburg – Berlin diesen Trassen, so daß die Kreuzungspunkte schon aus verkehrsgeographischen Gründen stets ihre Bedeutung behalten haben.
Erben der Römer im nördlichen Oberrheingebiet sind zunächst die Burgunder, die hier zu Beginn des 5. Jahrhunderts ein Reich mit der Hauptstadt Worms errichten. An diese Zeit erinnert noch das Nibelungenlied, dessen erster Teil in Worms spielt. Auch der im zweiten Teil geschilderte Untergang der Burgunder hat insofern einen historischen Kern, als das burgundische Reich 436 dem gemeinsamen Angriff von Römern und Hunnen erliegt. Auch die Bedeutung der Rheinschiene kommt in dem Lied zum Ausdruck: Siegfried, der „Held aus Niederland“, wird als Königssohn in Xanten geboren, und zur Werbung um Brunhild fahren er und König Gunther rheinabwärts zur Nordsee und nach Island.

Der Dom zu Speyer: Größter Sakralbau der Romanik
An die Stelle der Burgunder treten zunächst die Alemannen, die mit den Franken um die Herrschaft im heutigen Frankreich rivalisieren, von diesen aber 496 in die Schranken verwiesen und nach Süden abgedrängt werden. In karolingischer Zeit sind erhebliche Teile des nördlichen Oberrheingebietes fränkisches Königsland, besonders in der Umgebung der hier errichteten Pfalzen von Ingelheim und Tribur, die das System der hessischen Königspfalzen (Fritzlar, Hersfeld, Fulda, Frankfurt, Gelnhausen) nach Süden abrunden. Vor allem in der Pfalz Ingelheim, die wohl in den Jahren um 780 erbaut wird, hat sich Karl der Große gerne aufgehalten; in Tribur finden wiederholt Reichsversammlungen statt.
Nicht weit von der alten Burgunderhauptstadt Worms, wo die Karolinger ebenfalls über erhebliche Besitzungen verfügen, wird 764 ein Benediktinerkloster gegründet, das Karl der Große wenig später nach Lorsch verlegt, zur Reichsabtei erhebt und großzügig ausstattet; die Besitzungen der Abtei reichen später von Utrecht bis Basel. Während des ganzen Hochmittelalters stellt das 1232 an das Mainzer Erzstift, später an die Pfalz gefallene Kloster Lorsch ein Kulturzentrum ersten Ranges dar; die hier besonders gepflegte Reichsgeschichtsschreibung („Lorscher Annalen“) kann sich auf eine der größten Bibliotheken des Abendlandes stützen.
Daß die Gegend seit alters her den Charakter einer Königslandschaft hat, geht auch daraus hervor, daß das Kerngebiet des Erzbistums Mainz, der bedeutendsten Herrschaft dieses Raumes, zum guten Teil auf ehemaligem Königsland liegt. So fällt die Masse des Reichsguts um Rüdesheim, Eltville und Lorsch im Laufe des 9. Jahrhunderts an Mainz, und noch Otto II. vergibt 983 beträchtliche Ländereien um Bingen und im Rheingau an das Erzstift.
Im Zeitalter der Salierkaiser stellt dann das Oberrheingebiet das eigentliche Kernland des Reiches dar, insbesondere der Worms- und der Speyergau. Hier liegen in massiver Konzentration die Hausgüter der salischen Dynastie, die 1024 mit Konrad II. für ein Jahrhundert auf den deutschen Thron gelangt. Als Graf im Speyergau verfügt Konrad in der Region zwischen Kaiserslautern und dem Rheingau über umfangreiche Herrschaftsrechte und ausgedehnten Eigenbesitz, so daß die Region fortan eine wichtige politische Basis für die Reichsgewalt darstellt.
Dies zeigt sich zum Beispiel während des Investiturstreits, als ein großer Teil der Reichsfürsten und des hohen Reichsklerus von Heinrich IV. (1066–1106) abfällt und dieser sich weitgehend auf die Gebiete seiner unmittelbaren Herrschaft stützen muß. Dabei zieht er auch die Bewohner von Worms und Speyer heran, denen er so weitgehende Rechte erteilt, daß sich diese Orte zu den ersten Städten im Rechtssinne entwikkeln können. Am nördlichen Oberrhein wird damit eine neue Epoche der Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte eingeleitet. Die sich damals konstituierende Bürgerschaft der beiden Städte steht jeweils in scharfem politischen Gegensatz zu ihrem bisherigen bischöflichen Herrn, so daß die Allianz zwischen König und Bürgertum im beidseitigen Interesse liegt und infolgedessen über die Regierungszeit Heinrichs IV. hinaus andauert. 1074, 1104 und 1111 erhalten die beiden Städte Privilegien, die ihnen die völlige Emanzipation von ihren Stadtherren und den Aufstieg zu Freien Reichsstädten ermöglichen. Schon in der Salierzeit wird die dann später von den Staufern systematisch betriebene Städtepolitik eingeleitet – der Versuch, das rasch aufsteigende Bürgertum, seine erheblichen finanziellen Ressourcen und die damit verbundenen politischen und militärischen Möglichkeiten für die Reichspolitik zu nutzen.
Im Speyergau, der Wiege der Salierdynastie, wird zwischen 1030 und 1061 auch deren Grabstätte errichtet, der Dom zu Speyer. Es handelt sich um eine gewaltige dreischiffige Basilika mit Querhaus – der größte romanische Kirchenbau Deutschlands und eines der bedeutendsten Baudenkmäler des Abendlandes. Insgesamt acht Könige und Kaiser haben hier ihre letzte Ruhe gefunden, unter ihnen noch Rudolf von Habsburg (1273–1293), der, als er sein Ende kommen fühlt, in bewußter Anknüpfung an die Tradition seiner Vorgänger nach Speyer reitet. Der Dom bringt die Leitvorstellungen des hohen Mittelalters zum Ausdruck: die Majestät Gottes und die gemeinsame Zielsetzung der seinen Heilsplan erfüllenden Universalgewalten Reich und Kirche.