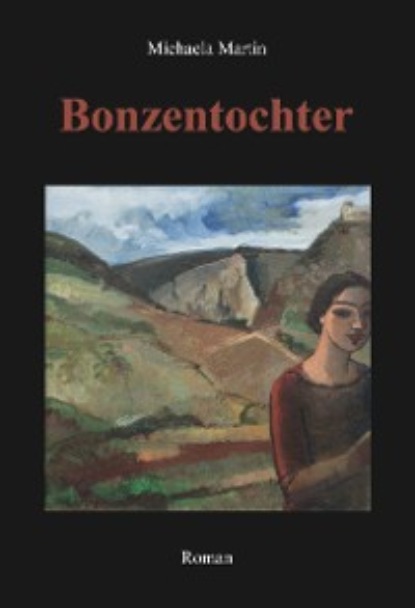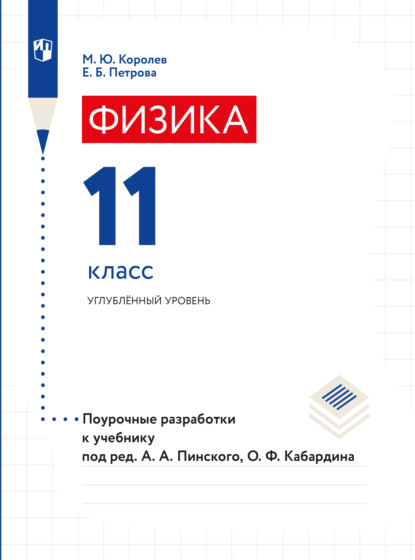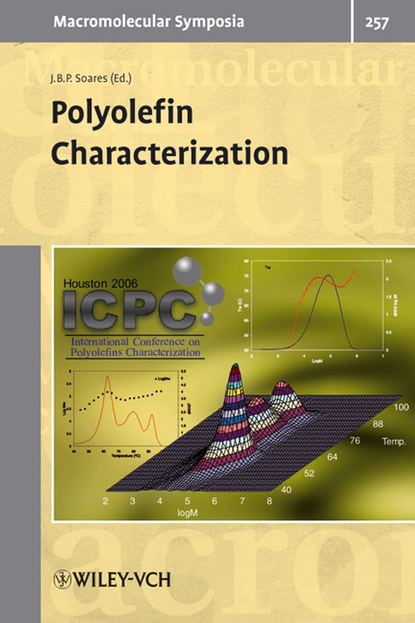- -
- 100%
- +
Herr und Frau Völlinger leiden an Hautreizungen, die sie verzweifeln lassen. Bis heute hat kein Arzt ein Mittel gegen den ständigen Juckreiz gefunden. Völlingers haben sich inzwischen an jeder Stelle ihres Körpers blutig gekratzt. Der arme Herr Völlinger sieht mit seiner blutig gekratzten Nase und den geschwollenen Augen inzwischen aus, als hätte er sich mit Max Schmeling einen Boxkampf geliefert. Die ganze Familie tut mir aufrichtig leid. Vor allem, da Völlingers inzwischen pleite sind. Das Schicksal der jungen Familie stand sogar schon in der Presse im Lokalteil der Abendzeitung.
Damit kam etwas Schwung in die ganze Angelegenheit.
Einen Tag nach dem Erscheinen des Artikels hat der Vorstand der Firma Bauinvest persönlich bei Kains angerufen. Er wollte wissen, ob man die Sache nicht beschleunigen könnte, schon wegen der schlechten Presse. Kains, dem die Angelegenheit auch schwer im Magen liegt, regte einen außergerichtlichen Vergleich an, was allerdings mit Kosten verbunden gewesen wäre.
Davon wollte der Vorstand nichts wissen: „Dann sollen sie doch klagen. Wenn sie ihr Geld zum Fenster rauswerfen wollen, dann ist das ihre Sache. Der Prozess kommt die teuer zu stehen, die werden sich noch wundern!“
Der zaghafte Versuch von Kains, den Vorstand zum Einlenken zu bewegen, indem er auf die imageschädigende Wirkung des Zeitungsartikels hinwies, wischte dieser mit den Worten weg: „Ach was, nichts ist so alt wie Presse von gestern. Es bleibt dabei, wir zahlen nicht, sollen sie doch klagen!“
Recht haben und Recht bekommen ist offensichtlich zweierlei, so viel kann man bei diesem Prozess lernen. Diese Erkenntnis ist schmerzlich, aber wahr.
Inzwischen hat die U-Bahn den Tunnel verlassen, ab Studentenstadt Freimann fährt sie wieder oberirdisch. Noch zwei Haltestellen und ich bin zu Hause, Kieferngarten ist meine Hausstation. Es wird also Zeit, dass ich meine trüben Gedanken beiseiteschiebe und mich den wirklich schönen Dingen des Lebens zuwende, dem geruhsamen Wochenende, welches unmittelbar vor der Türe steht. Der Wetterbericht hat fantastisches Wetter vorausgesagt. Während ich meine Tasche und Jacke zusammenpacke, denke ich: Heute kann kommen, was will, mich erschüttert nichts mehr. Schaumbad, ich komme!
Ich betrachte mein Spiegelbild in der Fensterscheibe der U-Bahn. Als ich mir gestern Abend die Zähne geputzt habe, habe ich mit Schrecken festgestellt, dass sich unzählige kleine Mundfalten über meiner Oberlippe gebildet haben. Außerdem macht sich zwischen meinen Augenbrauen eine tiefe Furche breit, beides verleiht meinem Gesicht einen griesgrämigen, abweisenden Ausdruck. Man wird im Alter nicht schöner, so viel steht fest. Dass der Verfall bei mir schon mit 25 Jahren anfängt, beunruhigt mich sehr. Ich habe Angst, dass ich mit 30 Jahren aussehe wie Mutter Theresa nach ihrem jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz für die Armen in Indien. Um diesem Schicksal zu entgehen, muss ich dem sichtbaren Verfall unverzüglich entgegenwirken, das habe ich gestern Abend noch entschieden. Den Anfang macht heute eine Gesichtspackung, die nach einer zehnminütigen Einwirkzeit eine deutlich sichtbare Glättung der beanspruchten Haut bewirken soll. Ich hoffe, die Packung hält, was die Werbung verspricht.
Die letzten zwölf Monate sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich habe viele Überstunden im Büro gemacht. Ich arbeite gerne, denn erstens macht mir mein Job Spaß und zweitens können wir das Geld nach dem Umzug aus dem Appartement in der Studentenstadt in eine größere Zweizimmerwohnung in Kieferngarten gut gebrauchen. Der Umzug hat Geld gekostet und die Miete ist auch viel teurer. Es ist eine für Münchner Verhältnisse zwar sehr faire Miete, aber trotzdem für zwei Studenten und eine Schülerin, die auf BAföG oder Unterhaltszahlungen vom Vater angewiesen sind, sehr teuer.
So kurz vor dem Examen fordert die Uni ihren Tribut. Wenn ich nicht Gefahr laufen will, durch das erste Examen zu rauschen, muss ich mein Lernpensum drastisch steigern und samstags zu den Klausurenkursen gehen, was mehr als lästig ist. Immer wenn ich auf dem Weg zur Uni bin und den vielen gutgelaunten Menschen auf der Leopoldstraße begegne, tue ich mir selbst aufrichtig leid. Ich bedauere mich, weil ich die nächsten fünf Stunden in einem muffigen Hörsaal sitzen muss und mein Hirn mit der Lösung eines Falles quäle, der in der Regel nur einen sehr niedrigen Unterhaltungswert hat. Die Lösung muss sauber unter den einschlägigen Gesetzestext subsumiert, soll heißen, begründet werden, und zwar brillant formuliert auf etwa zehn Seiten. Leider hat sich inzwischen herausgestellt, dass meine Handschrift mein größter Feind ist. Zwei Klausuren wurden mit „nicht ausreichend“ bewertet, weil die Prüfer meine Schrift nicht lesen konnten und die Arbeit deshalb erst überhaupt nicht korrigiert haben. In diesen Momenten hasse ich mein Studium. Aber es hilft ja alles nichts, da muss ich die nächsten Monate noch durch. Nach dem Examen wird alles besser. Keine Vorlesungen, keine Klausuren.
Seit über einem Jahr wohnt Sylvie, meine zehn Jahre jüngere Schwester, bei uns in München. Mein Freund Klaus und ich haben zwei Jahre lang in einem schönen Ehepaar-Appartement in der Studentenstadt Freimann gewohnt, obwohl wir nicht verheiratet sind. Es war ein glatter Glücksfall, dass diese Wohnung gerade frei stand, als Klaus und ich auf der Suche nach einer Bleibe waren. Statt zwei getrennten Appartements bot uns die nette Frau von der Studentenstadtverwaltung diese schöne kleine Zweizimmerwohnung an. Natürlich haben wir sofort zugegriffen und waren sicher, dass wir in der Wohnung bis zum Ende unseres Studiums bleiben würden. Man darf drei Jahre in der Studentenstadt wohnen. Damit möglichst viele Studenten in den Genuss einer günstigen Wohnung kommen, ist die Wohnzeit begrenzt. Ich finde das durchaus gerecht und deshalb richtig. Ich habe das Leben in der Studentenstadt geliebt. Die Wohnung hatte zwei Zimmer, plus kleines Duschbad. Groß genug für zwei Personen, leider zu klein für drei, besonders wenn eine Person erst 14 Jahre alt ist und spätestens ab 22 Uhr schlafen sollte. Die Lage der Studentenstadt ist fantastisch. Direkt am Englischen Garten gelegen, der Aumeister, einer der traditionsreichsten Münchner Biergärten, nur einen Steinwurf entfernt, keine fünf Minuten mit der U-Bahn zur Uni. Wir hatten viel Spaß in der Studentenstadt. Es war immer etwas los. Es gab mehrere Discos und eine nette Bar im obersten Stock des Hanns-Seidel-Hauses, mit einem traumhaften Blick über ganz München.
Als Sylvie letztes Jahr nach München zog, lebten wir noch rund fünf Monate zu dritt in dem kleinen Appartement in der Studentenstadt. Es wurde uns aber sehr schnell klar, dass das auf Dauer nicht gut gehen konnte. Wenn drei Leute lernen müssen, dann braucht jeder einen Schreibtisch. Dafür war die Wohnung aber viel zu klein, also sind wir auf die Suche nach einer neuen, größeren Wohnung gegangen. Weil die meisten unserer Freunde im Münchner Norden oder Schwabing leben, suchten wir schwerpunktmäßig eine Wohnung in diesen Stadtbezirken. Wir hatten Glück. Eine kleine Annonce im Nordanzeiger klang vielversprechend. Die Zweizimmerwohnung in Freimann in einem Zweifamilienhaus in einer ruhigen Seitenstraße ist fast doppelt so groß wie unsere alte und wie für uns gemacht. Sie hatte nur den Nachteil, dass die Vermieter im Erdgeschoss des Hauses lebten, was für mich nach ständiger Kontrolle roch. Aus taktischen Gründen hatte ich der Vermieterin am Telefon nicht gebeichtet, dass wir ein unverheiratetes Studentenpaar mit kleiner Schwester waren. Konstellationen dieser Art waren in den siebziger Jahren bei Münchner Vermietern nicht sehr gefragt, was ich sogar verstehen kann. Dennoch lief alles ganz anders ab als gedacht.
Unsere zukünftige Vermieterin, Frau Braun, begrüßte uns so herzlich, als hätte sie ihr Leben lang auf uns gewartet. Eine ungewöhnliche, offene Frau, die meine Vorurteile über die konservativen Münchner schon bei der ersten Begegnung über den Haufen warf. Offensichtlich hatte sie sofort Gefallen an meiner Schwester gefunden. Ein paar Wochen später gestand sie mir, dass sie Sylvie an ihre Tochter Marie erinnert. Nach einer halben Stunde waren wir uns über die Konditionen einig und vier Wochen später zogen wir in unser neues Heim. Seitdem leben wir zu dritt in unserem neuen Zuhause in München Freimann, zwei Haltestellen von der Studentenstadt entfernt.
Bis heute läuft unser Zusammenleben besser als gedacht, Es ist alles eitle Harmonie, was ich uns nicht zugetraut hätte, wenn ich ehrlich bin. Sylvie hat ihr eigenes Zimmer, in dem sie tun und lassen kann, was sie will. Die Wohnung ist wunderbar hell und die Vermieter sind sehr nett.
Jetzt hätte ich vor lauter Träumereien fast meine Haltestelle verpasst! Es ist wirklich nicht zu glauben, dass mich die Aussicht auf zwei Stunden Einsamkeit in der Badewanne mit Gesichtspackung, etwas Musik und Wein, so ins Träumen versetzen kann, dass ich das Aussteigen vergesse. Mit mir ist es wirklich weit gekommen. Meine Anforderungen an ein bisschen Glück sind mittlerweile sehr bescheiden. „Nächster Halt: Kieferngarten. Endstation!“ schallt es in gewohnt bayerisch-nasalem Dialekt aus dem U-Bahnlautsprecher, als ich aussteige.
Drei Minuten später stehe ich vor unserer Gartentüre. Ich nehme die Post aus dem Briefkasten und klemme sie mir unter den Arm. Wie jeden Tag fängt danach die Suche nach dem Haustürschlüssel in meiner Handtasche an. Die Tasche ist schick und auch praktisch, weil sie sehr groß ist, nur findet man leider nichts in ihr. Ich wühle mit der rechten Hand in meiner Tasche, die ich mir über die Schulter gehängt habe, als mir die Hälfte meiner Post auf den Boden fällt.
„So ein Mist!“, stöhne ich laut auf und suche hektisch nach meinem Haustürschlüssel. Ich bin kurz davor, den gesamten Tascheninhalt auf dem Boden auszuleeren, als meine Finger endlich die metallische Kühle meiner Schlüssel spüren. Inzwischen habe ich auch einen starken Druck auf meiner Blase. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber sobald ich unser Toilettenfenster von außen sehe, muss ich ganz dringend. Es ist zwar albern, aber wahr: Immer, wenn ich auf unser Haus zugehe, bemühe ich mich mittlerweile geradezu zwanghaft, nicht zu unserer Wohnung hinaufzusehen, aus lauter Angst, dass mein Blick unser Badezimmerfenster streift, bevor ich meinen Schlüssel in der Hand halte. Es gibt nämlich nichts Unwürdigeres, als wenn man dringend auf die Toilette muss und deshalb mit verschränkten Beinen leicht zappelnd vor seiner verschlossenen Gartentüre steht, weil man minutenlang nach seinem Schlüssel sucht. Diese erniedrigende Situation habe ich in meinem Leben schon mehrfach durchlebt und werde deshalb fast panisch, wenn ich vor einer verschlossenen Haustüre stehe und sich meine Blase meldet.
Als ich den Schlüssel endlich in der Hand habe, bücke ich mich, um die heruntergefallene Post aufzuheben. Ich will sie mir gerade wieder unter den linken Arm klemmen, als ein weißes DIN A4 Blatt zu Boden flattert.
„Das gibt es doch nicht, jetzt langt‘s mir aber!“, fluche ich.
Langsam werde ich hektisch, denn der Druck meiner Blase steigt beständig. Ich hebe das Blatt auf und registriere dabei, dass auf dem Blatt Papier schwarze Buchstaben aufgeklebt sind.
„Ich hasse Werbung!“ Entnervt stöhne ich auf und unternehme gleichzeitig einen weiteren Versuch, die gesamte Post unter meinem linken Arm zu deponieren, damit ich endlich mit der rechten Hand die Haustüre aufsperren kann. Dieses Mal klappt es auch und kurz darauf stehe ich in unserer Wohnung. Ich werfe die Post auf den Küchentisch, die Tasche auf den Stuhl und renne ins Bad. Gerettet, in letzter Sekunde.
Der Griff zum Wasserhahn der Badewanne ist mühelos von der Toilette aus zu erreichen. Mechanisch lasse ich Wasser in die Badewanne ein. Als mir der Geruch des Badesalzes in die Nase steigt, ist der Ärger verflogen. Jetzt kommt der gemütliche Teil des Tages, daran kann mich nichts und keiner mehr hindern.
Bevor ich in mein Dampfbad steige, höre ich gewohnheitsmäßig den Anrufbeantworter ab. Klaus hat angerufen. Er informiert mich darüber, dass er in seiner Mittagspause Lebensmittel eingekauft hat, damit ist unsere Versorgung für das Wochenende gerettet. Erleichtert denke ich seit Langem wieder einmal: „Er ist der Beste!“
Klaus und ich haben uns vor fünf Jahren an der Uni kennengelernt. Am Tag der Einschreibung standen wir nebeneinander in einer Menschenschlange. Hunderte von Studenten vor uns, die alle dasselbe wollten: den Immatrikulations-Stempel. In Anbetracht der Länge der Schlange konnte es leicht Stunden dauern, bis ich an die Reihe kommen sollte.
Da ich keine Lust hatte, die Zeit stumm zu verbringen, riskierte erst einmal einen Blick zu meinen direkten Nachbarn auf meiner rechten Seite.
„Leute gucken“ gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, damit kann ich Stunden verbringen. Ich schaue mir die Menschen an und male mir aus, was es für Typen sind, welches Leben sie wohl führen.
Der Kollege rechts neben mir war von der Sorte: „Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was!“ Ich schätzte, dass er das Abitur über den zweiten, vielleicht sogar dritten Bildungsweg gemacht hatte. Später sollte sich herausstellen, dass ich mit meiner Einschätzung Recht gehabt hatte. Der Knabe studierte Jura und hatte die gleichen Kurse wie ich belegt. Manfred war sein Name. Er war deutlich älter als die anderen Studenten, ich schätzte, dass er schon an der 30 knabberte. Er hatte leider so gar nichts von einem flotten Studenten. Hätte ich ihn in der U-Bahn das erste Mal getroffen, hätte ich ihn in die Kategorie Bankangestellter, Versicherungsfachmann oder Siemens-Mitarbeiter, mittlere Laufbahn, eingeordnet. Er hatte eine Glatze, einen kleinen Bauchansatz, trug Cordhose und Sandalen mit Socken.
Ich gestehe freimütig, dass ich ein Mensch bin, der seine Vorurteile hütet wie einen Augapfel. Manche Enttäuschung bleibt mir dadurch erspart. Beweisen kann ich es natürlich nicht, aber mit meinen Vorurteilen liege ich nur selten daneben. Bereits mehrfach bestätigt wurde mein Vorurteil, wonach Männer in Cordhosen, Socken und Sandalen schreckliche Spießer oder Muttersöhnchen sind, darauf gehe ich inzwischen jede Wette ein. Manfred gehörte zur letzten Sorte. In den Jahren unseres gemeinsamen Studiums hatte ich ihn zigmal mit Frau Mama und Dackel zur Uni kommen sehen. Selbst zur Prüfung hatte ihn die Mama begleitet und gewartet, bis der liebe Bub in den Gemäuern des Justizpalasts verschwand.
Mein Nachbar zur Linken war zwar auch kein Robert Redford, aber doch deutlich attraktiver. Dunkelhaarig, schlank, 186 cm groß und Brillenträger. Zugegeben, die Brille war scheußlich, aber das konnte man leicht korrigieren. Gegen Bauchansatz und Glatze ist Frau hingegen machtlos. Klaus sah auf jeden Fall wie einer aus, der auch ohne Anleitung seiner Mutter den Hörsaal findet. Ich beschloss, ihn anzureden. Es sollte keine plumpe Anmache sein, deshalb suchte ich einen intelligenten Vorwand.
Ich zog meine Immatrikulationspapiere aus der Tasche und einen Kugelschreiber und sprach ihn mit meinem liebenswertesten Lächeln an: „Kannst du mir sagen, wie die Uni hier heißt?“
Seine Antwort verblüffte mehr, als dass sie mich weiter brachte: „Wieso?“
„Weil man den Namen der Uni hier oben in das Formular eintragen muss und ich gestehen muss, dass ich ihn nicht weiß.“
Erst als ich die Begründung für meine Frage lieferte, fiel mir selber auf, wie peinlich sie war.
Der Mann an meiner Seite ließ sich jedoch nicht anmerken, ob er mich gleich unter der Rubrik „Frau, blond und doof“ einordnete, denn er antworte ganz freundlich: „Ach so, natürlich. Das ist hier die Ludwig-Maximilians-Universität.“
Nach einer kleinen Pause fügte er zur Sicherheit hinzu:
„Von München.“
Er war offensichtlich der Meinung, dass jemand, der den Namen der Uni nicht wusste, auf der er beabsichtigte, die nächsten fünf Jahre zu verbringen, möglicherweise auch den Namen des Ortes nicht wusste, an dem er sich gerade befand. Egal für wie blöd er mich hielt, es hielt ihn nicht davon ab, mit mir eine sehr anregende Unterhaltung zu beginnen.
Nach fast zwei Stunden hatte ich einiges von ihm erfahren. Er war 22 Jahre alt, kam aus der schönen Pfalz und war zwei Wochen zuvor aus der Bundeswehr entlassen worden, wo er die letzten zwei Jahre als Zeitsoldat verbracht hatte.
Die Bundeswehrzeit brachte ihm bei mir gleich Minuspunkte ein. Als überzeugte Pazifistin war ich grundsätzlich gegen die Bundeswehr und ganz besonders gegen ihre Soldaten. Ein weiteres von mir gepflegtes Vorurteil war: „Soldaten sind alles fremdbestimmte Befehlsempfänger und Säufer und deshalb blöd.“ Gekannt hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt keinen Soldaten persönlich. Deshalb ja auch das Bekenntnis zu einem Vorurteil.
Klaus schien meine unausgesprochene Abneigung gegen die Bundeswehr zu spüren, denn er sah sich unaufgefordert veranlasst, mir den Grund für seine zwei freiwilligen Jahre beim Bund zu erläutern. Er war der Jüngste von fünf Geschwistern, sein Vater war selbstständiger Sattlermeister gewesen, inzwischen aber schon in Rente, seine Mutter eine gute katholische Hausfrau. Das Geld war immer knapp im Hause Koch. Klaus beabsichtigte, Betriebswirtschaft zu studieren und brauchte etwas Geld. Während der zwei Jahre beim Bund konnte er gut für sein Studium sparen. Zeitsoldaten verdienten nämlich deutlich mehr als die normalen Wehrdienstleistenden, die nur sechs Monate weniger für das Vaterland im Einsatz waren, aber deutlich weniger Sold erhielten.
Sein Lebenslauf und seine familiäre Situation erklärten mir zwar seine Entscheidung, gutheißen konnte ich diese trotzdem nicht. Dennoch fand ich, meinem Vorurteil zum Trotz, Klaus gleich sympathisch, wenn ich mich auch nicht gleich in ihn verliebte.
Klaus gestand mir ein paar Wochen später, dass es bei ihm Liebe auf den ersten Blick gewesen war, wovon ich selbst aber nichts merkte. Das mag daran gelegen haben, dass ich, zumindest noch mit halbem Herzen an meinem Freund Jürgen hing, der allerdings im fernen Marburg studieren wollte. Die Beziehung zu Jürgen dauerte schon fast zwei Jahre und hielt überhaupt nur deshalb so lange, weil wir ständig getrennt waren. Ich lebte bis zum Abitur in der Nähe von Frankfurt, er in Marburg. Jürgen und ich passten einfach nicht zusammen, das wussten alle anderen von Anfang an und wir beide ahnten es inzwischen auch. Nach dem Abitur war uns jedenfalls klar geworden: Keiner liebte den anderen so sehr, als dass er auf seinen Lieblingsstudienort verzichtet hätte. Meiner war München, was jeder verstehen konnte, und seiner eben Marburg, warum auch immer. Heute weiß ich, der Grund hieß Gesine und wurde 18 Monate später seine erste Ehefrau. So weit waren wir aber im Oktober 1972 noch nicht und deshalb tat sich Klaus erst einmal schwer mit mir, obwohl er sich von Anfang an sehr anstrengte.
Nachdem wir unsere vollständigen Immatrikulationsunterlagen persönlich bei der zuständigen Verwaltungsstelle eingereicht hatten, beschlossen wir, zur Belohnung erst einen Kaffee trinken und danach ins Kino zu gehen. Es war „Der Diktator“ von Charly Chaplin. Der Film ist heute noch Kult und gefiel uns beiden sehr. Wir stellten eine erste Gemeinsamkeit fest, unsere Begeisterung für Kino. Am späten Nachmittag trennten wir uns mit den Worten: „Man sieht sich!“
Zugegeben eine sehr optimistische Form der Verabredung in Anbetracht der Tatsache, dass München rund eine Millionen Einwohner hat und circa 20.000 davon Studenten sind. Aber es stellte sich sehr bald heraus, dass Klaus nicht umsonst bei der Bundeswehr gewesen war, denn er ging in der darauffolgenden Woche generalstabsmäßig vor. Ich hatte ihm erzählt, dass ich im Münchner Osten zur Untermiete wohnte und deshalb immer mit der Straßenbahn der Linie 4 und der U-Bahn zur Uni fuhr. Also was tat mein Bundeswehr geschulter neuer Verehrer Klaus? Er informierte sich darüber, wann die Grundkurse für Juristen stattfanden und stellte sich dann an die Straßenbahnhaltestelle Perusastraße und wartete auf mich. Am dritten Tag hatte er Erfolg. Er stand schon an der Haltestelle, als ich kam und strahlte mir entgegen. Ich freute mich auch, ihn so unerwartet und bald wiederzusehen, denn ich kannte noch nicht so viele Menschen in München, mit denen ich mich so anregend unterhalten konnte wie mit Klaus. Leider hatte Klaus an diesem Tag viel Pech gehabt. Er hatte seinen Haustürschlüssel am Morgen zu Hause liegen lassen und konnte deshalb nicht in seine Studentenbude, bis sein Vermieter von der Arbeit nach Hause kam. Das konnte aber noch leicht zwei bis drei Stunden dauern. Es regnete fürchterlich und wir waren beide trotz Schirm schon ziemlich durchnässt. Deshalb schlug ich ihm spontan vor, mit zu mir nach Hause zu kommen: „Ich koche uns einen Tee oder Kaffee und wir quatschen einfach. Wir kriegen die Zeit schon rum, bis dein Vermieter nach Hause kommt.“
Klaus war sichtlich dankbar über meinen Vorschlag, denn er sagte sofort zu, wenn auch unter dem kleinen Vorbehalt: „Aber du musst mir versprechen, dass ich nächste Woche einmal für dich kochen darf, als kleines Dankeschön dafür, dass du mir heute Asyl gewährst.“
Klaus hatte instinktiv meinen schwächsten Punkt getroffen, nämlich meine große Leidenschaft für gutes Essen. Meine beiden Eltern konnten sehr gut kochen, ich hingegen leider nicht. Das Essen in der Mensa war ungenießbar und das in den Münchner-Kneipen unbezahlbar. Deshalb litt ich unter einer starken Unterversorgung an warmen Mahlzeiten, seitdem ich in München lebte. Ich war für jedes Angebot, das diesen leidigen Zustand unterbrach, sehr dankbar.
Erstaunlicherweise bin ich nie auf die Idee gekommen, Klaus zu fragen, warum er an diesem Tag an der Haltestelle Perusa-straße der Linie 4 stand. Er fuhr nämlich immer mit der S-Bahn in eine ganz andere Richtung und das wusste ich auch. Als er mich viele Wochen und warme Mahlzeiten später über seine Strategie aufklärte, war ich sehr gerührt, vor allem aber sehr geschmeichelt über so viel Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt gehörte Jürgen endgültig der Vergangenheit an, sodass ich mich auch gefühlsmäßig einem neuen Mann zuwenden konnte. Seit über fünf Jahren sind wir jetzt ein Paar, seit drei Jahren leben wir zusammen und seit einem Jahr zu dritt mit meiner kleinen Schwester Sylvie.
Als ich Klaus meinen Eltern vorstellte, sah ich ihren Mienen sofort an, dass sie von ihm alles andere als begeistert waren. Als geübte Tochter bemerkte ich es an den Blicken, die sie sich gegenseitig zuwarfen. Dabei gab es an Klaus auf den ersten Blick überhaupt nichts auszusetzen. Gegenüber meinen Verflossenen hatte er einen sichtbaren Vorteil, er war nämlich deutlich größer als ich, mit 1,86 m überragte er mich um fast zehn Zentimeter. Er hatte keine Glatze, keinen Bauch und er kaute nicht an den Fingernägeln, die dazu noch sauber waren. Dreckige, abgefressene Fingernägel sind bei meinen Eltern ein K.o.-Kriterium. Klaus konnte perfekt mit Messer und Gabel essen, was insbesondere für meinen Vater besonders wichtig war, schließlich hatte er seinen Töchtern schon mit knapp fünf Jahren beigebracht, wie man Hähnchen mit Messer und Gabel zerteilt und isst. Ich denke heute noch mit Grauen an die vielen Übungsstunden in unserer Lieblingskneipe im Dorf. Einmal in der Woche ging es zum Hähnchenessen in unsere Dorfkneipe „Zur glücklichen Henne“. Wenn unser Vater uns in die Anatomie des deutschen Huhns einweihte und uns freundlich zum Zerlegen des knusprigen Hähnchens mit Messer und Gabel aufforderte, hielt unsere Mutter jedes Mal den Atem an. Es dauerte nicht lange und eine ihrer drei Töchter stellte die Frage nach dem „Warum“: „Warum müssen nur wir das Hähnchen mit Messer und Gabel essen? Alle anderen Menschen um uns herum essen es doch auch einfach mit den Fingern!“ Unser Vater antwortete über Jahrzehnte, so lange dauerte es nämlich, bis auch die Jüngste die Anatomie des deutschen Grillhähnchens begriffen hatte, immer gleich: „Erstens sind wir nicht „andere Leute“, sondern die Familie Schneider und die isst Hähnchen mit Messer und Gabel und zweitens werdet ihr es mir noch einmal danken, dass ihr frühzeitig anständige Tischmanieren gelernt habt.“ Aus heutiger Sicht, fast 20 Jahre später, gebe ich ihm Recht. Vor kleineren Missgeschicken blieben wir alle nicht verschont, auch unser Vater nicht. Der eine oder andere Hähnchenschenkel flog schon mal eine letzte Runde und landete auf dem Boden, statt in unserem Magen. Die anderen Gäste verfolgten das Schauspiel aus sicherer Distanz mit einer Mischung aus Mitleid und Bewunderung.
Klaus allerdings hat eine ganz besondere Eigenschaft, die in unserer Familie nicht besonders ausgeprägt ist. Er kann gut zuhören und er quatscht nicht dazwischen, wenn sich andere Leute unterhalten, sondern wartet, bis man ihn aufmunternd anschaut. Allein wegen dieser Eigenschaft hätten ihn meine Eltern eigentlich lieben müssen. Ich vermute jedoch, dass sie ihm diese Rücksichtnahme als Schwäche auslegten. Tatsache ist, dass Klaus im Kreis unserer Familie deutlich weniger Gesprächsanteile hat als alle anderen Familienmitglieder. Wenn er allerdings zu Wort kommt, dann verschafft er sich auch Gehör. Er redet nur, wenn er gefragt wird oder wenn er etwas von „Bedeutung“ zu sagen hat. Meist sitzt er schweigend in unserer Runde, was meine Mutter zu der Bewertung veranlasste: „Der arme Klaus!“