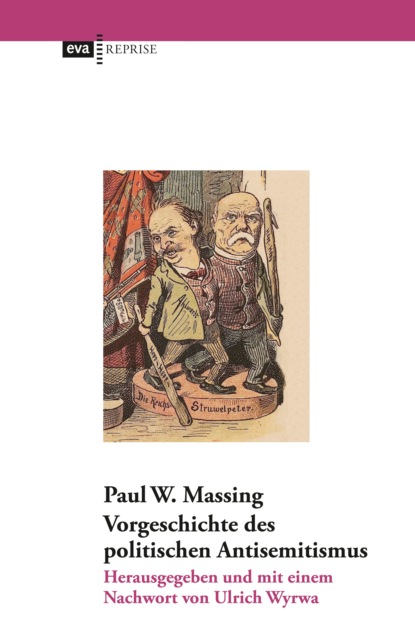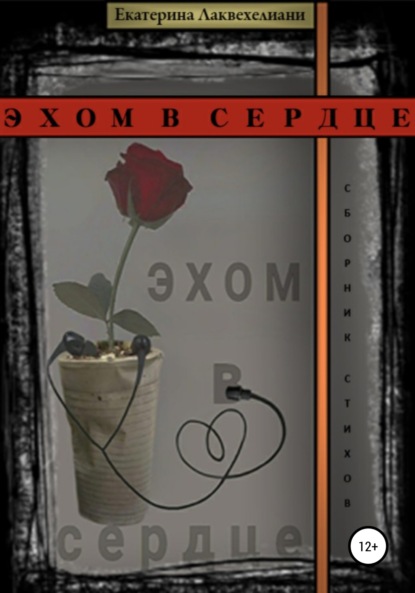- -
- 100%
- +
»Wir achten die Juden als unsere Mitbürger und ehren das Judentum als die untere Stufe der göttlichen Offenbarung. Aber wir glauben fest, daß ein Jude weder in religiöser noch in wirtschaftlicher Hinsicht ein Führer deutscher Arbeiter sein kann. Die Christlich-soziale Arbeiterpartei schreibt das Christentum auf ihre Fahne …«63)
Wer um die Arbeiter warb, durfte sich nicht auf eine offen antisemitische Agitation einlassen. Seit die Sozialdemokratie ihren Anhängern einhämmerte, daß es gleichgültig sei, ob ihre Ausbeuter jüdische oder christliche Kapitalisten seien und daß eine Judenhetze nur antirevolutionäre Zwecke verfolge, waren den Arbeitern antisemitische Demagogen verdächtig. Tatsächlich hatte der ungehemmte Antisemitismus seiner eigenen Parteigänger Stoecker häufig in Verlegenheit gesetzt, und er mußte ihre Ausbrüche auf seinen Parteiversammlungen mehr als einmal eindämmen. Erst am 19. September 1879, als die Aussichtslosigkeit des Versuchs, die Sozialdemokratie zu schwächen, offenbar geworden war, startete er seinen ersten unverbrämten antisemitischen Angriff mit einer Rede über »Unsere Forderungen an das moderne Judentum« (64).
Die Rede verschlug dem politischen Leben Berlins den Atem. Stoeckers Agitation bekam neuen Auftrieb, seine schwache Partei erwies sich plötzlich als eine Kraft, mit der man rechnen mußte. Von 1879 bis in die Mitte der achtziger Jahre hielt die sogenannte Berliner Bewegung, mit Stoecker als ihrem hervorragendsten Führer, die Hauptstadt in Aufruhr. Ihr Gedankengut war ein Gemisch aus christlichsozialen, konservativen, orthodox-protestantischen, antisemitischen, sozialreformerischen und staatssozialistischen Elementen. Das Konservative Zentralkomitee wurde ihr Hauptquartier; Handwerker, Büroangestellte, Studenten, untere Beamte, kleine Geschäftsleute und andere Mittelständler stellten den größten Teil ihrer Anhängerschaft.
Das Ziel, das Stoecker sich gesetzt hatte, trieb ihn dazu, den Antisemitismus zum Mittelpunkt seiner Agitation zu machen. Zwar war es ihm mißlungen, die Sozialdemokratische Partei zu verdrängen oder ihre Wählerschaft zu spalten, aber die Regierung hatte sich dieser Bedrohung auf ihre eigene Weise entledigt. 1878 war die Sozialdemokratie für gesetzwidrig erklärt worden; sie konnte nur noch unterirdisch weiterarbeiten. Der politische Liberalismus war jetzt der Hauptgegner, und im Kampf gegen »jüdischen Liberalismus« gab es keine bessere Waffe als Antisemitismus. Hinzu mag gekommen sein, daß Stoecker aus Furcht, von anderen Agitatoren überflügelt zu werden, den antisemitischen Kurs einschlug. Sein Freund und Biograph Oertzen stellt fest: »Die Notwendigkeit des Kampfes [gegen die Juden] ergab sich aus dem überschäumenden Interesse, das er erweckte. Tausende von Zeitungsartikeln, hunderte von Broschüren, ungezählte starke Bücher wurden verfaßt, um die [jüdische] Frage zu erörtern und klare Ziele herauszuarbeiten.«65)
Stoecker selber betrachtete sich nie als Antisemiten; sein erklärtes Ziel war, die Flamme des Christentums in den Herzen seiner Anhänger zu schüren und seine Bewegung auf den Felsen des christlichen Glaubens zu gründen, nicht auf den Haß gegen die Juden. Am 23. September 1880 schrieb er dem Kaiser:
»Im übrigen habe ich in allen meinen Reden gegen das Judentum offen erklärt, daß ich nicht die Juden angreife, sondern nur dies frivole, gottlose, wucherische, betrügerische Judentum, das in der Tat das Unglück unseres Volkes ist.«66)
Offenbar aber lockten seine antijüdischen Attacken und seine mittelständlerischen Forderungen mehr Zuhörer an als der christliche Inhalt seiner Reden (66a). Stoeckers Biograph Frank ermittelte aus Polizeiakten, wie stark der Besuch verschiedener seiner Veranstaltungen war67):
DATUM THEMA BESUCHERZAHL 5. März1880 König Hiskia und der Fortschritt 1000 9. April1880 Die Judenfrage 2 000 30. April1880 Ist die Bibel Wahrheit? 500 24. September 1880 Die Judenfrage 2 000 19. November1880 Das Dasein Gottes 1000 17. Dezember1880 Das Alte und Neue Testament 700 21. Januar1881 Das Handwerk einst und jetzt 2 500 28. Januar1881 Die Sünden der schlechten Presse 3 000 4. Februar1881 Die Judenfrage 3 000 11. Februar1881 Obligatorische Unfallversicherung 3 000Wie tief die öffentliche Meinung aufgerührt war von dem Kampf gegen die Juden, geht aus der zeitgenössischen Literatur hervor. Wawrzinek stellt in seiner Studie »Die Entstehung der deutschen Antisemitenparteien (1873–1890)«68) eine Bibliographie von über fünfhundert Büchern, Broschüren und Artikeln aus jener Zeit zusammen, die sich ausschließlich mit der »Judenfrage« beschäftigen. Was sich in diesen Jahren in Berlin ereignete, wirkt wie ein Vorspiel zu dem, was fünfzig Jahre später geschehen sollte. Zwei Berichte – einer aus christlicher, der andere aus jüdischer Feder – mögen das politische Klima der Reichshauptstadt veranschaulichen. 1885 schrieb ein Berliner Mitarbeiter der Christlichen Monatsschrift in Barmen:
»Welche Wendung in Berlin vor sich gegangen ist, kann nur derjenige würdigen, der die Stadt zehn Jahre nicht gesehen und plötzlich wieder hineinversetzt wird. Er würde schon staunen, wenn er in ein kleines bescheidenes Restaurant eintritt und hier den ›Reichsboten‹ nicht bloß ausgelegt, sondern auch von dem kleinen Handwerker und Arbeiter begierig gelesen findet. Er müßte, bei den Erinnerungen an ehemals, wo man in diesen Kreisen das reaktionäre Blatt samt seinem Leser zur Tür hinausgeworfen hätte, sich geradezu an die Stirn fassen, ob er nicht träumt. Er würde dasselbe tun müssen, wenn er die Zeitungsfrau in das Hintergebäude drei oder vier Treppen hoch das ›Deutsche Blatt‹ tragen sieht. Ist denn da oben unter dem Dach nicht mehr die exklusive Domäne der ›Volkszeitung‹? Woher der Eindringling? Nun, er kommt von Stoecker und keinem anderen. Er hat die Umwandlung bewirkt. Der Fremde, der zehn Jahre lang Berlin nicht gesehen hat, sieht plötzlich gegen Abend das Gedränge in den Straßen eines Stadtviertels immer dichter werden. Er läßt sich vom Strom mit fortreißen und kommt in eine konservative Wahlversammlung. Tausende sind versammelt, Tausende müssen aus Mangel an Platz draußen zurückgehalten werden. Alle Stände sind vertreten, vom Arbeiter hinauf bis zum Offizier in Zivil und bis zu dem auf einer Tribüne hinter einer Säule sich nur schlecht verbergenden Minister. Es geht ein lebhaftes Geflüster durch die des Redners harrende Versammlung. Mit einemmal wird es still, dann atemlos still und dann wieder stürmisch laut. Hofprediger Stoecker ist in den Saal getreten, und ein donnerndes Hoch aus den Tausenden von Kehlen, ein Hoch, das nicht enden will, empfängt den populärsten Mann Berlins, einen Hofprediger! Der Fremde denkt nach, er verweilt mit seinen Gedanken bei jener konservativen Versammlung, die er vor zehn Jahren besucht hatte. Er hat davon noch die Empfindung einer Krankenstube. Vornehmer war die damalige Versammlung, aber klein und gichtbrüchig. Wer hat dieses Wunder vollbracht?«69)
Der andere Bericht stammt von dem nationalliberalen Reichstagsabgeordneten Bamberger; als er 1883 von einer mehrmonatigen Auslandsreise nach Berlin zurückkehrte, schrieb er angeekelt in sein Tagebuch:
»Gleich in den ersten Tagen hörte ich im Vorübergehen zweimal gemeine Äußerungen über Juden, ohne daß damit eine Absicht auf mich im Spiele war, sondern nur weil mein Ohr sie erhaschte. Einmal waren es sogar Arbeiter. Jetzt, nach längerem Aufenthalt, ist man wieder aguerri. Ich sage, man muß nicht hinaus, damit der Gestank nicht weicht, wenn man einmal die Nase voll hat. Lüftet man sich, so muß man das Experiment von neuem durchmachen.«70)
Warum fand Stoeckers Agitation gerade um diese Zeit so großen Widerhall? Gründe für die Dynamik des Antisemitismus können nur in der Dynamik der Gesellschaft gefunden werden. 1870 war ganz Deutschland freihändlerisch71). In erster Linie war Preußen damals bestrebt, Beschränkungen des Binnenhandels aus dem Wege zu räumen und die dafür notwendige Einheitlichkeit der Gesetzgebung zu erreichen. Jeder Schritt zur wirtschaftlichen Einheit Deutschlands bedeutete einen preußischen Sieg im Kampf um die »kleindeutsche« Lösung.
Als Großproduzenten von Exportgetreide traten die preußischen Konservativen natürlich für Freihandel ein. »Der Schutzzoll ist der Schutz gegen die Freiheit der Inländer, da zu kaufen, wo es ihnen am wohlfeilsten und bequemsten scheint, also ein Schutz des Inlandes gegen das Inland.« Diese typisch manchester-liberale Gesinnung vertrat im Oktober 1849 ein Junker vor dem preußischen Abgeordnetenhaus – es war Bismarck72). Wie überall führte auch in Deutschland die Industrialisierung zu erhöhtem Verbrauch von Konsumgütern, also zu steigenden Getreide- und Bodenpreisen. Die Preissteigerung Anfang der siebziger Jahre veranlaßte Agrarier, mehr Land unter den Pflug zu nehmen und Verarbeitungsbetriebe anzugliedern. Die dafür nötigen Investitionen verschafften sie sich durch Aufnahme von Krediten. Dann brach der Markt zusammen. In anderen europäischen Ländern und in Übersee war es nicht anders; auch in den Vereinigten Staaten wurden die Landwirte von ihren Gläubigern – den Bankiers der Ostküste – bedrängt und mußten den Staat um Intervention bitten, aber ihre Beschwerden gegen »Wall Street« hatten nicht den antijüdischen Unterton, der die Beschuldigungen der deutschen Landwirte gegen die »Börsenmächte« charakterisierte.
Teilweise war das Fallen der Getreidepreise durch die Industriekrise in Deutschland verursacht, teilweise aber auch durch die Überflutung des ungeschützten deutschen Marktes mit amerikanischem und russischem Weizen. In Deutschland wie überhaupt in Mittel- und Westeuropa herrschte in der Landwirtschaft die intensive Bodenbearbeitung. Um die Mitte des Jahrhunderts hatten wissenschaftliche und technische Fortschritte diesem Verfahren weiteren Aufschwung gegeben. Die hohen Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse führten zu neuen Investitionen, um den Bodenertrag zu steigern. Seit den siebziger Jahren mußte die intensive Bebauungsweise mit der extensiven Methode in Konkurrenz treten, die sich auf den grenzenlos erscheinenden Flächen freien Landes in Übersee entwickelt hatte. Eisenbahn und Dampfer ermöglichten es jetzt, die amerikanische Ernte zu konkurrenzfähigen Preisen nach Europa zu werfen. Deutschland begann, Getreide einzuführen. Hatten die konservativen Grundbesitzer anfangs nur zögernd nach Schutzzollpolitik gerufen, so taten sie das seit der Mitte der siebziger Jahre mit steigendem Nachdruck.
In der Industrie fand eine ähnliche Entwicklung statt. Durch die Einverleibung von Elsaß-Lothringen war Deutschland in den Besitz von profitablen, technisch fortgeschrittenen Industrien gelangt. Die dortige Textilindustrie zum Beispiel verfügte über mehr als einhalbmal so viele Baumwollspindeln und über fast die gleiche Zahl mechanischer Webstühle wie das ganze Reich73). Deutschland hatte auch Eisenerzvorkommen in Lothringen und Kalilager im Elsaß erworben, beide von größtem Wert für die Entwicklung der deutschen Schwerindustrie. Damals glaubte man so fest an die Vorteile des Freihandels, daß die Meistbegünstigungsklausel in den Friedensvertrag mit Frankreich aufgenommen wurde. Um seinen internationalen Handelsverpflichtungen nachkommen zu können, hob Deutschland 1873 den Einfuhrzoll für Roheisen, Schrott und Schiffbaumaterial auf. Der Zoll, der auf Halbfabrikaten und Maschinen lag, wurde ermäßigt, nach vier Jahren sollte er ganz wegfallen. Diese Freihandelspolitik fand die Unterstützung der Konservativen. Einer von ihnen erklärte 1873 im Reichstag: »Nächst dem Brot und Fleisch ist nichts wichtiger als freies Eisen.« Im selben Jahre nahmen mehrere hundert landwirtschaftliche Vereinigungen an einer Riesendemonstration teil, die gegen die Beibehaltung des Zolles auf Roheisen protestierte74).
Kaum erst war die deutsche Schwerindustrie fähig geworden, mit der von Großbritannien, ihrem überlegenen Rivalen in Europa, zu konkurrieren (75), als die Engländer sich durch die internationalen Stagnationstendenzen veranlaßt sahen, in den ungeschützten deutschen Markt einzudringen. Die erhöhte Konkurrenz überzeugte daraufhin manchen eingefleischten Manchesterliberalen, daß eine »nationale« Handelspolitik an die Stelle des international orientierten Freihandels treten müsse. Der Ruf nach neuen Zöllen auf Eisen- und Stahlprodukte gesellte sich den Stimmen der bedrängten Landwirte zu.
Ohne gegenseitige Unterstützung konnten weder die Getreide produzierenden Junker noch die Schwerindustrie hoffen, die Schutzzollgesetzgebung durchzusetzen. Zwar wünschten die Industriellen niedrige Preise für Nahrungsmittel und die Agrarier niedrige Preise für Industrieprodukte, aber schließlich mußten beide Gruppen sich überzeugen, daß ein Kompromiß unumgänglich war. Um ihrer eigenen Interessen willen unterstützten die Agrarier die Schutzzollforderungen der Schwerindustrie, und die Schwerindustrie ihrerseits förderte der Landwirtschaft genehme Zolltarife. 1878 war mit der Annahme eines neuen Zolltarifs die kurze Ära des Freihandels beendigt und zugleich der Grundstein gelegt für das politische Bündnis zwischen Schwerindustrie und Großagrariern, das fortan Deutschlands wirtschaftliche und soziale Entwicklung lenken und seine auswärtige Politik entscheidend beeinflussen sollte.
Schutzzöllnerische Wirtschaftspolitik gab es nicht nur in Deutschland, aber in keinem anderen Industrieland zeitigte sie so drastische politische Folgen. Der Zusammenbruch der Freihandelsidee untergrub das Prestige des politischen Liberalismus, der ja mit den Freihandelsparteien eng verbunden war. Konservative Tendenzen konnten ihren Einfluß in dem Maße vergrößern, in dem der Obrigkeitsstaat seine Macht erweiterte. Der politische Druck, den die Anhänger des Schutzzolls auf die Regierung ausübten, störte den Reichskanzler wenig, obwohl er sich selber einst zu den Prinzipien des Wirtschaftsliberalismus bekannt hatte. Niemals ließ sich Bismarck durch ideologische Neigungen oder politische Verpflichtungen von seinem eigentlichen Ziel, dem Ausbau der zentralisierten Reichsgewalt, ablenken. Wo es um dieses Ziel ging, scheute er vor nichts zurück. 1866 hatte er die preußischen Konservativen vor den Kopf gestoßen, indem er den König von Hannover entthronte und damit die geheiligten Rechte der Dynastien in Frage stellte; 1872 hatte er die ostpreußischen Junker verstimmt, indem er mit einer neuen Kreisordnung ihre alten Vorrechte in der ländlichen Selbstverwaltung aufhob; er hatte seine Gegner gedemütigt, indem er einen »Pairsschub« vornahm, das heißt fünfundzwanzig neue Mitglieder des Herrenhauses vom König ernennen ließ, um sein Reformgesetz durchzusetzen; er hatte konservative kirchliche Kreise verärgert, indem er hohe katholische Würdenträger einsperren ließ, als er zu der Überzeugung gekommen war, daß die Sonderinteressen der katholischen Kirche die Reichsautorität bedrohten. Während all dieser Jahre waren die Liberalen dem Kanzler treu geblieben, voller Jubel über jeden Schritt, mit dem er die Einheit des Reiches und die Zentralisierung der Regierung förderte. Dennoch gab es ein Spannungsfeld: selbst während der Jahre engster Zusammenarbeit führten die Liberalen einen stillen Krieg mit Bismarck um die Struktur der zentralistischen Regierung, um die Frage der autokratischen oder parlamentarischen Herrschaftsform.
Eine schwerwiegende Konzession an demokratische Forderungen war dem Kanzler 1867 abgerungen worden, als er mit den Nationalliberalen über die künftige Reichsverfassung verhandelte, nämlich das Recht des Reichstages, die Regierungsausgaben zu bewilligen. Man konnte es Bismarck nicht vergessen, daß er sich 1862 im »Verfassungskonflikt« mit dem preußischen Landtag kurzerhand über die Ablehnung seines Haushaltsplanes hinweggesetzt und vier Jahre lang ohne Etatbewilligung regiert hatte. Nach der Reichsgründung stellte sich bald heraus, wodurch des Kanzlers autokratische Hand zurückgehalten wurde: er brauchte eine Reichstagsmehrheit, die seiner Heeresvorlage zustimmte.
Es war schon zu Reibungen zwischen Bismarck und seinen nationalliberalen Freunden gekommen, als er 1869 eine Anleihe forderte, um die Flotte des Norddeutschen Bundes auszubauen. Ein Kompromiß beendete diesen Konflikt, und 1871 stimmten die Nationalliberalen dafür, daß der Reichstag, wie Bismarck wünschte, den Heeresetat auf vier Jahre im voraus genehmigte. 1874 mußte wieder eine Entscheidung getroffen werden; die Nationalliberalen waren zwar bereit, die von der Regierung beantragten zusätzlichen Ausgaben zu bewilligen, Bismarck jedoch verlangte ein »Äternat«, das heißt eine Blankoermächtigung der Regierung für Heeresausgaben auf unbestimmte Zeit. Dem Reichstag sollte nur das Recht verbleiben, die Stärke der Friedensarmee gesetzlich festzulegen, um dann innerhalb dieser Grenzen alle Ausgaben dem Ermessen der Regierung zu überlassen. Die Annahme dieses Vorschlags durch die Nationalliberalen hätte dem Parlament sein wichtigstes Vorrecht genommen: die jährliche Kontrolle des Staatshaushaltes, wozu nicht einmal der rechte Flügel des deutschen Liberalismus bereit war. Statt dessen wurde ein neuer Kompromißvorschlag ausgehandelt: das »Septennatsgesetz« erteilte dem Kanzler die Ermächtigung, die er dem Reichstag auf immer abzuzwingen versucht hatte, in abgeschwächter Form auf sieben Jahre. Diese Vorausgenehmigung wurde mit 224 gegen 146 Stimmen angenommen. Des nationalen Prestiges wegen hatten viele Fortschrittler, die Nationalliberalen aber ohne Ausnahme dafür gestimmt.
Das Septennat – es wurde 1880 erneuert – bedeutete einen Sieg für Bismarck, aber der Kampf um seine Annahme hatte wieder den Sprung im Unterbau des Reiches bloßgelegt: die Unvereinbarkeit des Prinzips des Obrigkeitsstaates mit dem der Mehrheitsherrschaft, ein Gegensatz, der sich auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zeigte. Jede Äußerung gegen die Staatsautorität, sei es in der Kunst, der Politik, der Erziehung oder den Sozialwissenschaften, wurde als Bedrohung des Regimes angesehen. Besonders die liberale und sozialistische Presse ging dem Kanzler gegen den Strich und erregte leidenschaftlichen Haß in allen konservativen, christlichsozialen und »national gesinnten« Kreisen, denen die ganze »jüdische Journaille« als Nährboden autoritätsfeindlicher Gesinnung galt. Kritik an der Obrigkeit mußte als umstürzlerisch und unpatriotisch verdammt werden.
Dennoch weigerte sich der Reichstag 1874 und 1876, Gesetzesvorlagen des Kanzlers zuzustimmen, mit denen er die sozialdemokratische Presse zum Schweigen bringen wollte. Schnell war die junge sozialistische Arbeiterbewegung angewachsen, trotz aller Hindernisse, die ihr die Regierung in den Weg legte. Ende der siebziger Jahre schon mußte der Bismarcksche Staat in der Sozialdemokratischen Partei seinen wichtigsten und gefährlichsten Gegner sehen. Einer der Hauptgründe des Kanzlers für den Kurswechsel in seiner Innenpolitik war sein Entschluß, sich dieser revolutionären Bedrohung zu entledigen. Aber solange die beiden liberalen Parteien, Fortschrittler und Nationalliberale, sich gegen jede Ausnahmegesetzgebung sträubten, konnte Bismarck sein antisozialistisches Programm nicht durchsetzen. Der Widerstand der Liberalen mußte gebrochen werden.
Bismarck gelangte zum Ziel mit Hilfe eines politischen Zwischenfalls, bei dem es ihm meisterhaft gelang, sich die wirtschaftliche Unzufriedenheit, kulturelle Erbitterung und politische Furcht, die im deutschen öffentlichen Leben lauerten, zunutze zu machen. Am 11. Mai 1878 verübte der Klempnergeselle Hödel, ein Halbirrer, der kurze Zeit der Christlichsozialen Partei angehört hatte, jetzt aber von der Polizei als Sozialdemokrat bezeichnet wurde, ein mißglücktes Attentat auf Kaiser Wilhelm I. Das war die Gelegenheit, auf die Bismarck gewartet hatte. Als der Kanzler von dem Mordanschlag unterrichtet wurde, soll er triumphierend ausgerufen haben: »Jetzt haben wir sie.« »Die Sozialdemokraten, Durchlaucht?«, wurde er gefragt. »Nein«, antwortete er, »die Liberalen.«76)
Sofort brachte der Kanzler im Reichstag eine Gesetzesvorlage ein, die auf das Verbot der Sozialdemokratischen Partei hinzielte. Die Liberalen, glaubte er, könnten es sich jetzt, wo es um die Bestrafung einer »Mörderpartei« ging, nicht mehr leisten, für die Unverletzlichkeit von Bürgerrechten einzutreten. Aber er hatte sich verrechnet. Die Vorlage wurde abgelehnt, mit den Stimmen der meisten Nationalliberalen. Drei Wochen später verübte ein Anarchist, Nobiling, ein zweites Attentat auf den Kaiser; dieses Mal wurde der Monarch ernstlich verletzt. Die öffentliche Entrüstung war groß. Obwohl der Reichstag erst am 10. Januar 1877 gewählt worden war, löste Bismarck ihn sofort wieder auf und schrieb Neuwahlen aus. Jede Opposition wollte er in einer patriotischen Kampagne für »König und Vaterland« ersticken; alle Kräfte, die ihm im Wege standen, galten als Vaterlandsfeinde, als umstürzlerische Internationalisten, als Freunde und Beschützer von Mördern; die liberalen Elemente in der Beamtenschaft wurden eingeschüchtert; es sei ein Schaden für das Land, ließ der Kanzler verlauten, wenn so viele Anwälte, Beamte und Gelehrte – »Männer ohne produktive Berufe« – im Reichstag säßen.
Die Kampagne »gegen den roten Terror« führte zur Auslöschung der liberalen Reichstagsmehrheit in den Wahlen vom 30. Juli 1878. Die Nationalliberalen, die schon 1877 von 152 Abgeordneten auf 127 gefallen waren, brachten es nur noch auf 98 Sitze, die Fortschrittler auf 26 gegenüber 35 im Jahre 1877 und 49 im Jahre 1874. Die Konservativen dagegen erhielten 59 Mandate, während sie 1877 nur 40, 1874 sogar nur 21 hatten erringen können; die Mandate der Freikonservativen stiegen von 33 bzw. 38 in den vorigen Wahlen auf 56. Die Zentrumspartei konsolidierte ihre früheren Erfolge; sie behielt ihre 93 Sitze von 1877; schon 1874 waren es 91 gewesen (77). Jetzt konnte die Regierung auch mit den Konservativen und mit dem Zentrum regieren.
Die entmutigten Nationalliberalen gaben ihren Widerstand auf. Als Bismarck eine neue, nodi schärfere Gesetzesvorlage gegen die Sozialdemokratie einbrachte, stimmten sie für die Ausnahmegesetzgebung und halfen mit, das »Gesetz wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« vom 21. Oktober 1878 durchzubringen. Dieses berüchtigte »Sozialistengesetz« erklärte die Partei für gesetzwidrig und ermächtigte die Polizei zur Auflösung »sozialdemokratischer Vereine« – nämlich der Partei-Ortsgruppen – und von »Vereinen, in denen solche Bestrebungen zutage treten«; Gewerkschaften, Arbeiterclubs und praktisch alle sonstigen Organisationen waren damit der Polizeiwillkür ausgeliefert. Den Anhängern der Sozialdemokratie wurde Presse- und Versammlungsfreiheit genommen; die Polizei war befugt, »Agitatoren« (das heißt alle, in denen sie eine Gefahr für Ruhe und Ordnung sah) aus den Großstädten auszuweisen. Das Aufstellen von Wahlkandidaten blieb den Sozialisten jedoch gestattet, das Abhalten von Wahlversammlungen auch, aber nur in Anwesenheit der Polizei.
Viermal wurde das ursprünglich bis zum 31. März 1881 befristete Gesetz verlängert, jedesmal mit den Stimmen der Nationalliberalen. In ihrer Hoffnung, sich durch Zustimmung zum Sozialistengesetz die Gunst Bismarcks wieder erkaufen zu können, sahen sie sich jedoch schwer getäuscht. Sie hatten ihren politischen Feinden nur einen neuen Beweis dafür geliefert, daß es nicht mehr möglich war, gegen den Nationalismus, gegen bedingungslose Treue zu Kaiser und Reich, zu opponieren. Die konservativ-monarchischen Kräfte konnten ihre Ernte einbringen.
Kaum hatte Bismarck die Sozialdemokratie aus dem Wege geräumt, als er sich anschickte, den Liberalismus vollends niederzuringen. Die Regierung begann eine systematische Konsolidierung der Staatsverwaltung und eine Reorganisierung des Beamtentums, aus dem alle »unzuverlässigen«, das heißt alle liberalen Elemente entfernt wurden; besonders das Heer sollte vor Ansteckung durch den Liberalismus geschützt werden78). Die Konservativen aller Richtungen und das Zentrum–Bismarcks neue Reichstagsmehrheit – nahmen die Vorlage für eine neue Wirtschaftsund Sozialgesetzgebung an. Ideologisch und wirtschaftlich einigte diese Politik die Kräfte, die unter der Autorität von Thron und Altar einen »christlich-nationalen Staat« wünschten. Der Liberalismus, in die Enge getrieben durch die manipulierte Angst vor der sozialistischen Revolution, hatte ausgespielt. Sein rechter Flügel, die Nationalliberalen, war seitdem stets bereit, sich auf die Seite der herrschenden Macht zu schlagen, falls diese ihn überhaupt als Partner akzeptieren wollte. Die zusammengeschrumpfte Fortschrittspartei – »Vorfrucht der Sozialdemokratie« hatte Bismarck sie genannt79) – kam als Teilnehmer an einer parlamentarischen Mehrheit sowieso nicht in Frage.