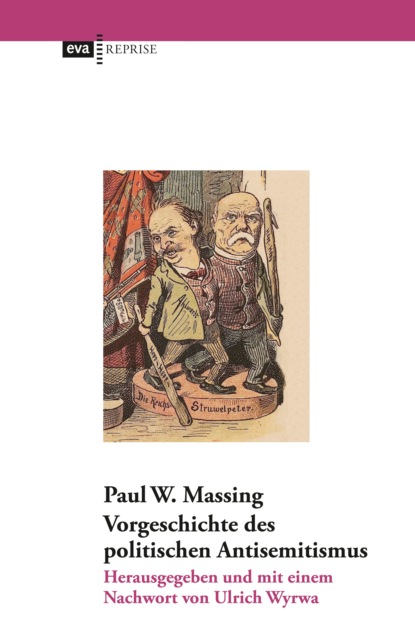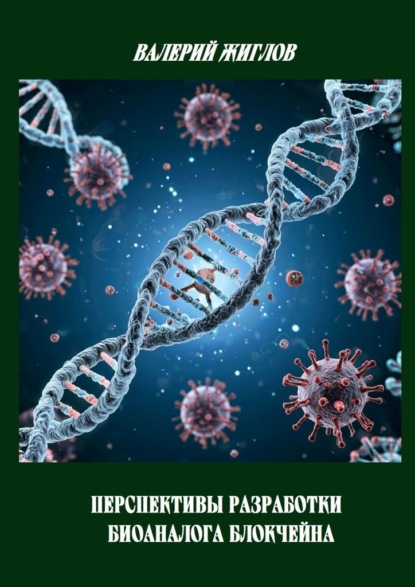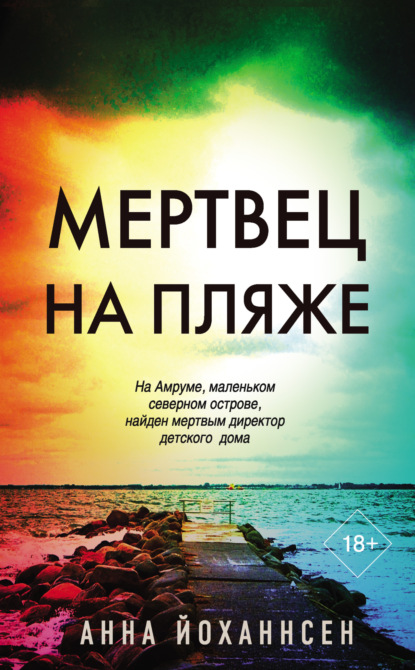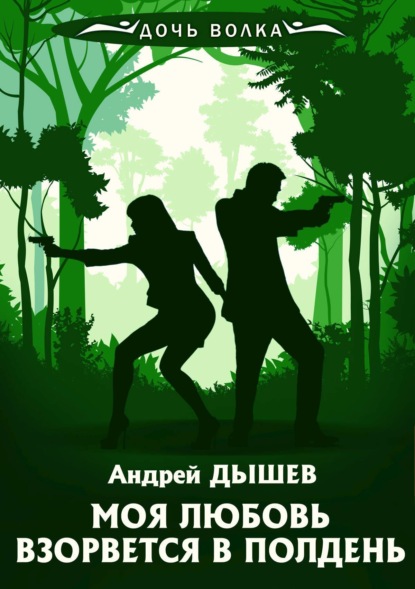- -
- 100%
- +
Solange diese Interessengemeinschaft mit der Regierung andauerte, war Stoeckers Stellung so stark, daß auch einige peinliche Vorfälle sie nicht ernstlich erschüttern konnten. Einer davon war ein Skandal, den er 1883 in London durch zwei Reden hervorrief, die Bismarck in Wut brachten und den Kaiser ungnädig stimmten. Stoecker hatte der Einladung zu einer Luther-Gedenkfeier in London Folge geleistet und dort in zwei öffentlichen Versammlungen über die Sozialreformbewegung und seine Christlichsoziale Partei gesprochen; die liberale Stadt war aufgebracht. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung zog der Lord Mayor die schon erteilte Erlaubnis für einen Vortrag im Mansion House, seiner amtlichen Residenz, zurück; die Veranstaltung mußte anderswo abgehalten werden. Deutsche Sozialdemokraten, vom Sozialistengesetz ins Exil getrieben, kamen in großer Zahl und sprengten die Versammlung. Stoecker mußte durch eine Hintertür fliehen. Der »Sozialdemokrat« berichtete darüber:
»Unsere Genossen waren hergekommen, nicht um zu diskutieren, sondern um Herrn Stoecker und in seiner Person Bismarck, seinem Patron, und den regierenden Klassen Deutschlands ihren Haß und ihre Verachtung in möglichst unzweideutiger Weise kundzugeben, auf die Mundtotmachung unserer Genossen in Deutschland zu antworten.«104)
Nicht weniger peinlich gestaltete sich ein Beleidigungsprozeß, den Stoecker 1884 gegen eine Berliner Zeitung anstrengte; sie hatte während der Wahlkampagne unter dem Titel »Hofprediger, Reichstagskandidat und Lügner« einen Artikel erscheinen lassen, in dem Stoecker unter anderem des Meineids bezichtigt wurde. Auf Monate hielt der Prozeß Berlin und ganz Deutschland in Spannung; er gestaltete sich zu einer politischen Niederlage für Stoecker, obwohl der angeklagte Redakteur schließlich wegen Formalbeleidigung zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten, herabgesetzt auf drei Wochen, verurteilt wurde. Da er als Jude einer Konfession angehöre, die der Nebenkläger Stoecker dauernd angegriffen hatte, wurden ihm mildernde Umstände zugebilligt. Das Gericht erklärte ausdrücklich:
»Derjenige müßte seinen Glauben und den seiner Väter nicht lieb haben, der schließlich nicht tief gereizt und innerlich empört würde, wenn er Angriffe sieht und wieder sieht auf seinen Glauben und die Gleichberechtigung seines Glaubens, zumal wenn diese Angriffe von einem Geistlichen kommen.«105)
Zwei hervorragende Rechtsanwälte, einer von ihnen selbst ein Jude, vertraten den Angeklagten; für die Atmosphäre der Verhandlung war es bezeichnend, daß der vorsitzende Richter sich wiederholt versprach und den Nebenkläger – Stoecker – als Angeklagten bezeichnete. Bald darauf wurde Stoecker wirklich zum Angeklagten, als ihn ein liberaler Gegner in seinem Wahlbezirk wegen Verleumdung vor Gericht brachte. Er kam mit einer Geldstrafe davon.
An Propagandamaterial gegen Stoecker fehlte es also nicht. Seine politischen Gegner ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, die Prozesse nach Kräften auszuwerten. Der Vorsitzende der Fortschrittspartei begrüßte nach dem gegen den Redakteur angestrengten Prozeß dessen Anwälte in einer öffentlichen Erklärung, in der es hieß:
»Die antisemitische Bewegung konnte durch nichts besser charakterisiert werden als durch die gerichtliche Feststellung der sittlichen Qualitäten ihres Hauptführers.«106)
Die liberale Presse begrüßte die Gerichtsentscheidung mit der größten Genugtuung; sogar die Konservative Korrespondenz, das halboffizielle Organ der Konservativen Partei, brachte einen unfreundlichen Artikel über Stoecker, und selbst der kaiserliche Hof, der sich von öffentlichen Auseinandersetzungen solcher Art fernzuhalten pflegte, sah sich schließlich gezwungen, Stellung zu nehmen. »Seine Majestät waren darauf hingewiesen worden«, daß Volksaufwiegelung unvereinbar sei mit dem Amte eines Hofpredigers, dessen »politisches Treiben geeignet sei, auf Allerhöchstdieselbe zu reflektieren«, wie aus den Akten des Kaiserlichen Zivilkabinetts hervorgeht107). In der Tat trug sich der alte Wilhelm I. ernstlich mit dem Gedanken, Stoeckers Rücktritt von seinem Amt zu verlangen, als dieser durch einen hochgestellten Bewunderer gerettet wurde, Prinz Wilhelm, den späteren Kaiser Wilhelm II. In einem handschriftlichen vierseitigen Brief an den Kaiser vom 5. August 1885, den Stoeckers Biograph Frank im Preußischen Hausarchiv später einsehen und inhaltlich wiedergeben, aber nicht textgetreu veröffentlichen durfte108), meldete der Prinz seinem Großvater, die Juden hätten den Prozeß absichtlich herbeigeführt, um Stoecker eine Falle zu stellen; als Beweismaterial für die Heimtücke der jüdischen Presse fügte er Zeitungsausschnitte bei. Er wußte auch zu berichten, das deutsche Volk sei über dieses jüdische Manöver sehr erbost, und man habe ihn selbst gebeten, seinen Großvater über den Hintergrund der Intrige aufzuklären. Gestützt und getrieben von Sozialdemokraten und Fortschrittlern – schreibt der Prinz – hätten die Juden es unternommen, Stoecker zu vernichten; es sei bedauerlich, daß das Judentum durch seine Presse im deutschen Reich genügend Macht errungen habe, um sich auf einen solchen Anschlag einlassen zu können. Er habe sich entschlossen, dem Kaiser zu schreiben, nachdem er erfahren habe, daß die Juden sogar am kaiserlichen Hof Einfluß besäßen.
Dann geht der Brief dazu über, Stoeckers Verdienste um die Sache der Monarchie zu preisen. Der Prediger habe gewiß manche Fehler, aber er sei der beste Förderer der Hohenzollernmonarchie und ihr mutigster und angriffslustigster Vorkämpfer unter dem Volke; in Berlin allein habe er den Sozialdemokraten und der Fortschrittspartei 60 000 Arbeiter abspenstig gemacht. Schließlich hob der Brief noch Stoeckers Anstrengungen für die Wohltätigkeits- und Sozialbestrebungen hervor, wodurch er die Sympathien Augusta Viktorias, der Gattin des Prinzen, gewonnen habe. Die Prinzessin machte sich den Appell ihres Gemahls zu eigen; sie flehte den Kaiser an, sie nicht eines ihrer besten Mitarbeiter auf dem Gebiete praktischen Christentums zu berauben. Der Prinz hatte Erfolg: der Kaiser erneuerte nur seine Warnung, Stoecker solle in Zukunft seine soziale und politische Tätigkeit mehr mit den Erfordernissen seiner hohen Stellung in Übereinstimmung bringen.
Aber Stoeckers Stern war im Sinken. Die ihm von oben gezeigte Gunst verebbte, als sich der Kurs der Regierungspolitik wieder einmal änderte. Zur selben Zeit ging die Führung des politischen Antisemitismus in die Hände von Männern über, die nicht von Traditionen eingeengt waren, auf die der Hofprediger Rücksicht nehmen mußte. Ein neuer Typ von Antisemitismus begann sich auszubreiten, frei von christlicher oder konservativer Färbung und oft im Gegensatz zu den Interessen der Kirche und der Junker. Das Zentrum der neuen Bewegung lag nicht mehr in Berlin, sondern in den Provinzen, besonders in Sachsen, Westfalen und Hessen.
KAPITEL IV
Stoeckers Niedergang (1886-1890)
Um die Mitte der achtziger Jahre war die Politik der kaiserlichen Regierung auf zwei Hauptziele gerichtet: auf die Erwerbung von Kolonien und die Verstärkung der Armee. Die Zentrumspartei, die seit einigen Jahren der Regierungskoalition angehörte, zögerte, sich das Regierungsprogramm zu eigen zu machen. Bismarck brauchte zur Rückendeckung eine neue parlamentarische Mehrheit. Die Nationalliberale Partei hatte sich, nach ihren großen Verlusten und der Abspaltung ihres linken Flügels (1880), unter der Führung von Johannes Miquel reorganisiert und war nun darauf bedacht, sich mit dem Kanzler wieder gut zu stellen. In ihrer »Heidelberger Erklärung« vom 23. März 1884 proklamierte sie ihre Zustimmung zu Bismarcks Wirtschafts-, Militär- und Außenpolitik. Sie werde, hieß es in der Erklärung, »unablässig für die Erhaltung einer starken deutschen Heeresmacht eintreten und kein notwendiges Opfer scheuen, um die Unabhängigkeit des Vaterlandes allen Wechselfällen gegenüber sicherzustellen«109). Die Partei befürwortete auch nachdrücklich die Fortsetzung des Kampfes gegen die Sozialdemokratie. Die Unterzeichner der Heidelberger Erklärung »werden bereitwillig der Reichsregierung die zur Abwehr staatsgefährlicher Umtriebe erforderlichen Machtmittel gewähren und erachten deshalb die Verlängerung des Sozialistengesetzes für dringend geboten«.
Reumütig und mit reorganisiertem Parteiapparat wurden die Nationalliberalen genau zu dem Zeitpunkt wieder regierungstreu, als Bismarck ihre Unterstützung am dringendsten brauchte. Sie gingen ein enges Bündnis mit den beiden konservativen Parteien ein, den Deutsch- und den Frei-Konservativen, und bildeten das sogenannte »Kartell«. Es wurde das parlamentarische Rückgrat der Regierung für das nächste Jahr und bewies seine Stärke in der »Kartell-Wahl« von 1887. Diesmal war der Reichstag aufgelöst worden, weil er dem Verlangen der Regierung, das Militärbudget wieder auf sieben Jahre im voraus zu bewilligen, nicht nachgegeben hatte110). Die Freisinnigen – so nannten sich die Fortschrittler seit ihrer Verschmelzung mit dem ehemaligen linken Flügel der Nationalliberalen – und das Zentrum waren bereit, den Heeresetat zu erhöhen, aber nur auf drei Jahre. Es war der Versuch, die parlamentarische Kontrolle über das Militär wenigstens in Spuren zu bewahren, ein schwaches Echo jenes Kampfes zwischen den Liberalen und Bismarck im Verfassungskonflikt von 1862–66. Auch diesmal setzte Bismarck seine Forderung durch. Zwanzig Jahre zuvor war ein siegreicher Krieg nötig gewesen, um die liberalen Kräfte zu spalten. Diesmal reichte schon die Kriegsdrohung. General Boulanger war französischer Kriegsminister geworden, und eine antideutsche kriegsfreundliche Gruppe gewann größeren Einfluß auf die Politik Frankreichs. Deutschlands Beziehungen zu Rußland waren zweifelhaft. Die verstärkte Propaganda für deutsche Kolonialforderungen hatte die deutsche öffentliche Meinung stark gegen England aufgebracht. »Das Vaterland ist in Gefahr!« wurde die Wahllosung der Kartellparteien. Die Einberufung der Reservisten für Wintermanöver gab der Kampagne der »Angstwahlen« die Atmosphäre eines unmittelbar bevorstehenden Kriegsausbruchs. So gelang es den drei »staatserhaltenden« Parteien des Kartells, mit 220 von 397 Reichstagssitzen eine ausreichende Mehrheit zu gewinnen. Die Freisinnigen verloren mehr als die Hälfte ihrer Mandate von 1884: von 67 blieben ihnen nur 32. Auch die Sozialdemokratie wurde durch die nationalistische Stimmung geschwächt: ihre Sitze verringerten sich von 24 auf 11. Dagegen konnten die Nationalliberalen ihre Sitze fast verdoppeln (51:99). Beim Zentrum allein änderte sich nichts: von den 99 Mandaten, die es 1884 errungen hatte, verlor es nur eins. Aber das Zentrum vermied einen ernstlichen Kampf gegen die Militärvorlage schon deswegen, weil der Papst Bismarcks Aussöhnung mit dem Katholizismus nicht gefährden wollte. Die Zentrumsabgeordneten enthielten sich der Stimme. Noch im Jahre 1887 konnte so Papst Leo XIII. den Kardinälen mitteilen, der Kulturkampf sei vorüber, und ein Jahr später, als der junge Kaiser Wilhelm II. zu einer aktiven Kolonialpolitik aufrief – »für die Abschaffung der Sklaverei« und um der christlichen Kultur willen – schwenkte das Zentrum zur Kolonialpolitik des Kartells um.
Stoecker geriet durch die Kartellbildung in eine schwierige Lage. Es war wichtig für die neue Koalition, Reibungen unter den Teilnehmern zu vermeiden. Die Nationalliberalen jedoch, die vor nicht so langer Zeit noch als die »Partei der Juden« bekannt waren, wußten, daß sie von Freisinnigen und Sozialdemokraten wegen ihres Bündnisses mit einer Partei, die Stoecker deckte, angegriffen werden konnten. »Wir müssen uns davon frei machen«, schrieb der nationalliberale Führer Rudolf von Bennigsen an Miquel, »daß eine Unterstützung des Stoeckerschen antisemitischen Demagogentums uns durch die Gegner noch weiter angehängt wird.«111) Vorsicht und Mäßigung in antisemitischer Agitation waren jetzt unumgänglich, um Konservative und Nationalliberale beieinander zu halten. Stoeckers Bewegung lag als Hindernis auf dem Wege der neuen Verbindung.
Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Bismarcks Sprachrohr, forderte am 23. September 1885 Stoecker mit scharfen Worten auf, die Tätigkeit der christlichsozialen Bewegung auf das Gebiet der kirchlichen Wohlfahrtspflege zu beschränken. Die Konservativen wurden merkbar vorsichtiger in der Auswahl von Wahlkandidaten und unterließen es, notorische Antisemiten für Berlin aufzustellen.
Stoeckers enge Verbindung mit den Konservativen wurde jetzt auch für die Christlichsoziale Partei eine schwere Belastung. Er war im preußischen Landtag und im Reichstag zu einem Wortführer der Konservativen geworden. So war die Christlichsoziale Partei durch ihren Vorsitzenden in all die politischen Gefahren verstrickt worden, die sich aus der Art und Weise ergaben, wie Bismarck mit Parteien und Parteigruppierungen umsprang. Einerseits profitierte sie von den Vorteilen, die sich aus der Unterstützung der Regierung durch die Konservativen ergaben, andererseits aber mußte sie, wenn die Konservativen gegen Bismarck auftraten, alle Nachteile einer Oppositionspartei in Kauf nehmen. Das konnte angehen, solange die Konservativen das Bündnis mit den Antisemiten nicht als Hindernis für eine vorteilhaftere politische Verbindung empfanden. Das gerade taten sie jetzt. Die konservativ-nationalliberale Allianz bedeutete den Untergang für die Berliner Bewegung als einer Koalition antiliberaler und antisemitischer Gruppen. Nur der unentwegte Kreuzzeitungsflügel polemisierte gegen das Kartell und trat für eine Zusammenarbeit der Konservativen mit dem Zentrum ein. Gestützt auf diese rechte Opposition konnte Stoecker weiterhin Bismarcks »Politik der Mitte« angreifen. Die Christlichsoziale Partei aber fand sich in einer ausweglosen Situation: solange die Regierung sich auf die Nationalliberalen stützte, eine der beliebtesten Zielscheiben für Stoeckers antisemitische Attacken, und solange das Kartell zusammenhielt, blieb der Partei nichts anderes übrig, als die Regierung selber zu bekämpfen. Aber »eine Oppositionspartei unter Führung eines Hofpredigers war … in Preußen ein unmöglicher Gedanke«112).
Noch mehr kompromittierte sich Stoecker, als er in eine Intrige gegen Bismarck verwickelt wurde; sie stand unter Graf Alfred von Waldersees Führung, der damals stellvertretender Chef des Generalstabes und Generalquartiermeister der Armee war. Bismarck hatte Waldersee im Verdacht, auf die Kanzlerstellung zu aspirieren und sich bei Prinz Wilhelm, dem Thronfolger, einzuschmeicheln. Auf Anregung des Prinzen lud Waldersee im November 1887 eine Anzahl Würdenträger ein, die darüber beraten sollten, wie Gelder für die Berliner Stadtmission aufgebracht werden könnten. Prinz und Prinzessin Wilhelm, Stoecker, der preußische Innenminister von Puttkamer und andere Minister, Hofleute und führende Konservative waren anwesend. Waldersee sprach über die Dringlichkeit, »anarchistische« Tendenzen mit geistigen und materiellen Mitteln zu bekämpfen; die Mission müsse ein Sammelbecken werden für alle diejenigen, die treu zum König hielten und patriotischen Idealen huldigten. Er regte an, aus allen Teilen des Reiches ein Komitee zur Förderung der Mission zusammenzurufen und unter das Patronat des Prinzen zu stellen. Mit Wärme ging der Prinz auf diesen Vorschlag ein, denn er sei besorgt über die geistige Verkommenheit der Berliner Massen und über die Kräfte sozialer Zerstörung, die nur durch christliche und soziale Gesinnung überwunden werden könnten.
Die liberale und regierungsfreundliche Presse zog sofort die politischen Folgerungen aus der Zusammenkunft und griff den Kreis um Waldersee als einen ehrgeizigen klerikal-konservativen Klüngel an, der versuche, den künftigen Kaiser für seine eigenen Zwecke einzuspannen.
»An demselben Abend brach in Berlin und Wien der Sturm los«, schrieb Stoecker später darüber. »Was die Berliner Juden aus Furcht vor Strafe nicht den Mut hatten, zu sagen, das sagten die Wiener; es war ein schlimmes Treiben … aber … gefährlich war es nicht. Was ging diese Fremdlinge, die Feinde unseres Glaubens, ein christliches Hilfswerk an? Man konnte ihre boshaften Äußerungen verachten und tat es auch. Da mit einem Male hörte man ein Pfeifen wie das eines herannahenden Föhns im hohen Gebirge. Die ‚Norddeutsche Allgemeine Zeitung' warf sich mit einem wilden Artikel auf die Christlich-Sozialen … Jetzt schrieb das offiziöse Blatt: die christlich-soziale Partei sei einseitig konfessionell und überhaupt keine politische Partei; sie sei das tote Gewicht der Berliner Bewegung, mit dem sich die Kartellparteien nicht amalgamieren sollten; nicht sie sei der Sauerteig der Berliner Bewegung, sondern der Antisemitismus allein. – Dieser Artikel war das Signal zum allgemeinen Angriff. Von wem er ausging, konnte nicht zweifelhaft sein …«113)
Bismarck erklärte später, weder er noch sein Sohn sei der Verfasser dieses und der darauf folgenden Artikel in der Norddeutschen Allgemeinen gewesen114). Aber wie ernst er die intime Zusammenkunft des Prinzen mit Waldersee und Stoecker nahm, zeigen seine Memoiren. Im dritten Band seiner »Gedanken und Erinnerungen«, in dem er seine Beziehungen zu Prinz Wilhelm beschreibt, befaßt sich das erste Kapitel fast nur mit der Waldersee-Angelegenheit und dem daraus entstandenen Briefwechsel mit dem Prinzen über Stoecker. Er riet dem Prinzen dringend ab, die Schirmherrschaft über die Mission zu übernehmen, und »sich vor der Thronbesteigung schon die Fessel irgendwelcher politischen oder kirchlichen Vereinsbeziehungen aufzuerlegen«115). Diese Auseinandersetzung legte den Keim für die Entfremdung zwischen dem Kanzler und dem künftigen Herrscher.
Hinter jener dringenden Warnung Bismarcks lag mehr als persönliche Rivalität mit Waldersee. Zwar sollte der Hieb auf Stoecker gewiß Waldersee als möglichen Kanzler des Prinzen Wilhelm ausschalten; es ist bekannt, wie eifersüchtig und mißtrauisch Bismarck gegen Persönlichkeiten war, in denen er potentielle Nachfolger argwöhnte, wie schonungslos er sie aus dem Wege räumte. Aber hier ging es um ernstere Fragen. Der alternde Staatsmann beobachtete mit steigender Besorgnis und Gereiztheit jede neue Entwicklung, von der die noch ungefestigte Struktur des Reiches bedroht werden könnte. Würde sie dem wachsenden Druck innerer Konflikte standhalten? Würde sein Regierungssystem, das zwar nicht parlamentarisch, aber auch nicht gegen solche Konflikte geschützt war, allen Gefahren widerstehen? Bismarcks Vertrauen in seine eigene Fähigkeit, die Zukunft des Reiches zu sichern, mag unbegrenzt gewesen sein, aber seine Macht war es nicht.
Die Stellung des Reichskanzlers war entscheidend geschwächt durch ihre strikte Abhängigkeit vom Kaiser. Da Bismarck die Parteien von oben herab zu behandeln pflegte, konnte er sich auf keine von ihnen unbedingt verlassen. Er war auch nicht der anerkannte Wortführer irgendeiner bestimmten sozialen Gruppe. Die besonders im Ausland verbreitete Annahme, er sei vor allem der Vertreter seiner eigenen Kaste, der Junker, gewesen, ist völlig abwegig. Selbst die preußische Armee blieb nur so lange ein williges Werkzeug in seiner Hand, als er das uneingeschränkte Vertrauen des Königs besaß. Wilhelm I. war allerdings völlig auf seinen Kanzler angewiesen. Solange der Kaiser lebte, durfte Bismarck hoffen, durch geschicktes Manövrieren oder, falls nötig, durch Verfassungsbruch die undemokratische Struktur des Reiches bewahren zu können. Aber sobald einmal der ehrgeizige junge Wilhelm II. Kaiser sein würde, bestand die Gefahr eines tiefen Konflikts zwischen Regierung und Reichstag, der dem jungen Staat zum Verhängnis werden könnte. Im Kartell wollte Bismarck eine repräsentative und dauernde Verbindung aller staatstreuen Kräfte schmieden, auf denen sein Reich beruhte: Aristokratie, Armee, Beamtenschaft und gemäßigt liberales, aber nationalgesinntes Bürgertum. Vereinigt sollten sie stark genug sein, die Sozialdemokraten in Schach zu halten und die Schritte des jungen Kaisers zu lenken. Das Kartell war die Voraussetzung für eine stabile Regierung. Als Bismarck es durch Stoeckers Oppositionsgruppe innerhalb der Konservativen gefährdet sah, schlug er mit aller Macht zurück. Er warnte den Prinzen:
»Es gibt Zeiten des Liberalismus und Zeiten der Reaktion, auch der Gewaltherrschaft. Um darin die nötige freie Hand zu behalten, muß verhütet werden, daß Ew. Hoheit schon als Thronfolger von der öffentlichen Meinung zu einer Parteirichtung gerechnet werden. Das würde nicht ausbleiben, wenn Höchstdieselben zur inneren Mission in eine organische Verbindung treten, als Protector.«116)
Bismarcks Autorität und die Erregung, die Waldersees Schachzüge allenthalben hervorgerufen hatten, veranlaßten den Prinzen, die Mission fallen zu lassen. Mit Sorge sah Stoeckers Kreis, wie der Kanzler den künftigen Kaiser für seine Kartellpolitik gewann. »Es hat seitdem jede persönliche Berührung des Hofes mit der Stadtmission und ihrem Leiter aufgehört. Beide sind seitdem in gewissen hohen Kreisen vervehmt«, klagte Stoeckers ergebener Biograph117).
Im März 1888 starb Wilhelm I. Friedrich III., sein schwerkranker Sohn, auf dessen liberale Gesinnung die Freisinnigen so große Hoffnungen gesetzt hatten, und dem der Ausspruch zugeschrieben wird, die antisemitische Bewegung sei »die Schmach des Jahrhunderts«, regierte nur drei Monate lang. Er war entschlossen, der antisemitischen Agitation ein Ende zu bereiten, und stellte den Fall Stoecker gleich bei der ersten Zusammenkunft seines Kronrates zur Debatte. Da Kaiser und Kanzler sich einig waren, schien Stoeckers Schicksal besiegelt. Aber wiederum kamen politische Erwägungen dazwischen. Bismarck gelang es, den Kaiser davon abzubringen, Stoecker ohne weiteres aus seinem Amt als Hofprediger zu entfernen. Zum dritten Male wurde entschieden, Stoecker bedingungslos zwischen seinem Amt und seiner politischen Tätigkeit wählen zu lassen.
Bismarcks Intervention für Stoecker kam nicht etwa aus einer plötzlichen Sympathie für seinen bisherigen Widersacher. Er wollte Stoecker beseitigen, aber nicht durch einen aufsehenerregenden Gewaltstreich, aus dem die Freisinnigen, seine alten Gegner, die schon seit langem die Entlassung des Hofpredigers verlangt hatten, Nutzen ziehen könnten. Für Bismarcks Zwecke war es ausreichend, Stoecker von der Politik fernzuhalten. Die Entscheidung des Kronrates wurde Stoecker erst im Frühjahr 1889 mitgeteilt, als Wilhelm II. schon den Thron bestiegen hatte. Stoecker entschied sich für sein Hofpredigeramt.
Das Abkommen, das er nach einer Unterredung mit einem Vertreter des Kaiserlichen Hofes selbst entwarf, hatte folgenden Wortlaut:
»Da Se. Majestät eine Tätigkeit, wie ich sie bisher im politischen Leben Berlins ausgeübt habe, mit dem Amte eines Hofpredigers für unvereinbar halten, ist es selbstverständlich, daß ich dieselbe aufgebe, so lange Se. Majestät mir dies Amt anvertrauen. Nach den gemachten Erfahrungen habe ich auch zunächst jede Freudigkeit verloren, den öffentlichen Kampf gegen den Umsturz auf politischem, sozialem und religösem Gebiete in der bisherigen Weise fortzusetzen. Es hat deshalb für mich unter den gegenwärtigen Verhältnissen keine Schwierigkeit, sondern entspricht meiner Neigung, den politischen Parteikampf überhaupt für mich wie für die christlich-soziale Partei einzustellen. Ich werde diesen Teil meiner Tätigkeit anderen überlassen und meine Vorträge nach Thema, Inhalt und Ton so einrichten, daß sie Seiner Majestät keinen Anstoß geben können. Ich werde, wenn ich öffentlich zu reden habe, nur religiöse, patriotische und soziale Gegenstände besprechen, und die letzteren nur so weit behandeln, als sie unter den Gesichtspunkt des Christentums, der Kirche und der Inneren Mission fallen. Sollte ich später von Gewissens wegen mich veranlaßt sehen, im Interesse des Vaterlandes oder der Kirche den Kampf wieder aufzunehmen, so werde ich Sr. Majestät davon pflichtmäßige Mitteilung machen und Allerhöchstderselben alles weitere untertänigst anheimstellen.«118)
Stoecker ließ sich in seiner Entscheidung von mehreren Gründen leiten. Das Kartell, glaubte er, habe bald abgewirtschaftet, ein offener Konflikt mit dem Kaiser aber könne auf seine Freunde und Förderer rückschlagen und ihre Kräfte brachlegen.
»Ein erfolgreicher agitatorischer Kampf gegen den Umsturz ist in Deutschland nicht möglich ohne die freudige Mithilfe der christlich-sozialen und starkkonservativen Kreise, die jetzt zurückgestoßen sind.«119)
Von nun an wurden Stoeckers Schritte scharf überwacht. Seine kirchlichen Vorgesetzten verweigerten ihm die Erlaubnis, im Ausland Vorträge zu halten. Bei verschiedenen Gelegenheiten wurde er verwarnt wegen Äußerungen, die nach kirchlicher Ansicht dem Geiste des Abkommens zuwiderliefen. Aber trotz der Spannungen mit Kirche und Regierung waren seine politischen Aussichten durchaus nicht hoffnungslos. Die Zeit schien für ihn zu arbeiten. Seine Warnung, die »Umstürzler« könnten nicht durch die einzige Waffe, die den Mittelparteien zur Verfügung stand, die nationale Idee, besiegt werden, begann sich zu bewahrheiten. Im Februar 1890 wurde das Kartell in den Reichstagswahlen vernichtend geschlagen. Nur ein gutes Drittel der Reichstagssitze verblieb den drei Kartellparteien; die Nationalliberalen gingen von 99 auf 42 Mandate zurück, die Deutschkonservativen von 80 auf 73, die Frei-Konservativen von 41 auf 21. Die Freisinnigen aber gewannen mehr als das Doppelte, 67 statt 32 Mandate, und die Sozialdemokraten verdreifachten ihre Sitze, von 11 auf 35. Das Zentrum war mit 106 statt 98 Mandaten zur stärksten Fraktion geworden. Die Angstpropaganda hatte ihre Zugkraft verloren. In den Großstädten hatten die Industriearbeiter ihren Protest gegen die steigenden Lebenshaltungskosten, eine Folge der Schutzzollpolitik, zum Ausdruck gebracht. In Berlin übertraf die Zahl der sozialdemokratischen Wahlstimmen die jeder anderen Partei. Ein weiteres Ansteigen der Sozialdemokratie schien unvermeidlich, denn am 1. Oktober 1890 lief das Sozialistengesetz ab, dessen Verlängerung die neue Reichstagsmehrheit – Zentrum, Freisinnige, Sozialdemokraten, 208 von 397 Abgeordneten – abgelehnt hatte120).